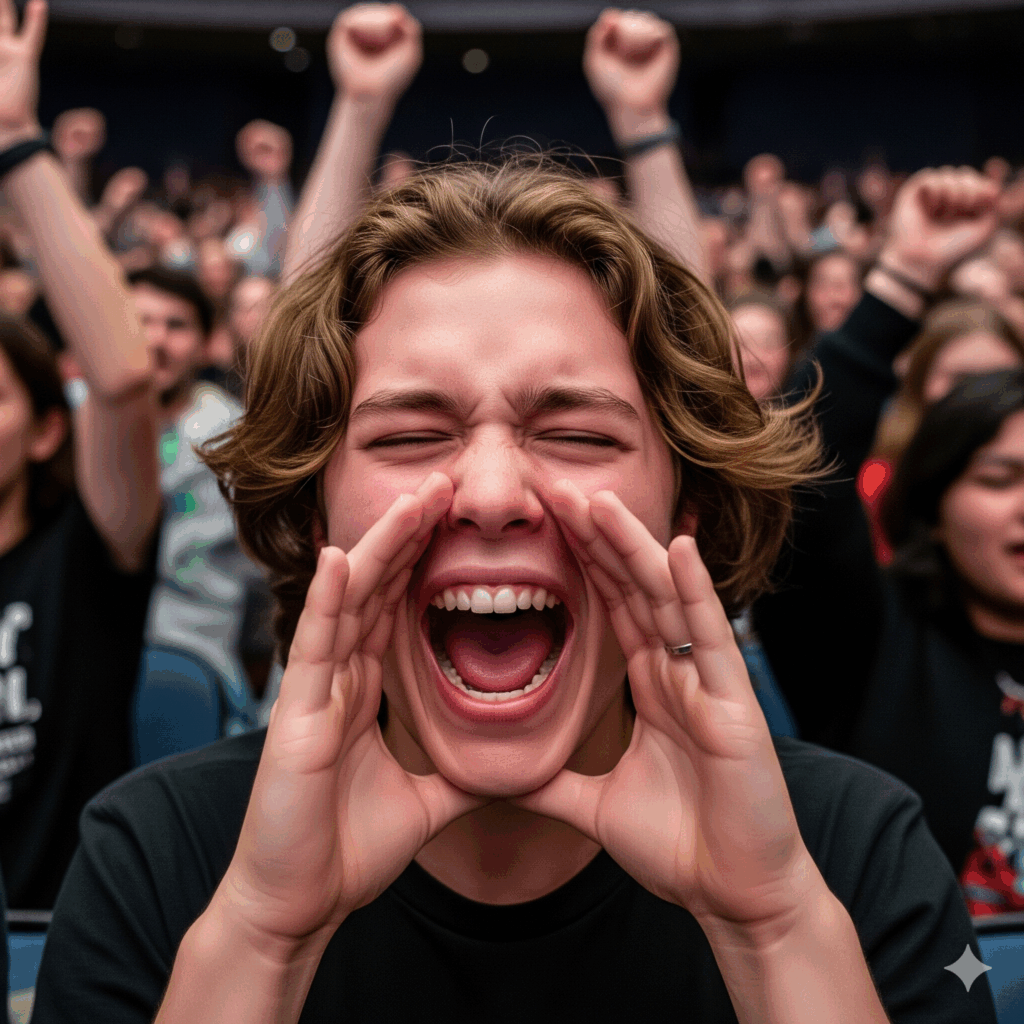In der amerikanischen Politik gibt es Rituale, die so alt sind wie die Republik selbst. Eines davon ist das Zeichnen von Wahlkreiskarten, eine technische Übung, die alle zehn Jahre nach der Volkszählung stattfindet. Doch was wir derzeit in den Vereinigten Staaten erleben, ist kein Ritual mehr. Es ist ein Krieg.
Ein parteiübergreifender, zynischer „Krieg der Neuzuschnitte“ ist entbrannt, nicht im Rhythmus der Verfassung, sondern mitten im Jahrzehnt. Angestoßen von der Trump-Administration, die ihre knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus vor den gefürchteten Midterm-Wahlen 2026 sichern will, hat ein aggressives parteipolitisches Wettrüsten begonnen. Die Republikaner ziehen mit dem Skalpell neue Grenzen, um demokratische Wählerhochburgen zu neutralisieren. Und die Demokraten, lange Zeit die Verfechter überparteilicher Reformen, sehen sich gezwungen, mit denselben Waffen zurückzuschlagen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Es ist eine Eskalation, die das Fundament des Wählerwillens untergräbt und Gemeinden zerreißt. Die zentrale These dieses Konflikts ist bitter: In einem Klima der totalen Polarisierung, befreit von den Fesseln einer mäßigenden Justiz, opfern beide Parteien die demokratische Fairness auf dem Altar der reinen Machterhaltung. Was wir beobachten, ist eine Form der „gegenseitig zugesicherten Zerstörung“ des Wählervertrauens.
Der Brandbeschleuniger: Wie das Weiße Haus den Krieg anzettelte
Gerrymandering – das manipulative Zuschneiden von Wahlkreisen – ist keine Erfindung von Donald Trump. Es ist Amerikas Erbsünde der Wahlgeometrie. Doch die aktuelle Welle bricht mit allen Konventionen. Sie ist historisch ungewöhnlich, weil sie nicht einer Volkszählung folgt, sondern einem rein parteipolitischen Kalender: der Angst vor den Zwischenwahlen 2026.
Historisch gesehen verliert die Partei des Präsidenten bei den Midterms fast immer Sitze. Für Trump, dessen republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus hauchdünn ist, wäre dies das Ende seiner legislativen Agenda. Die Lösung, wie sie vom Weißen Haus und Vize-Präsident JD Vance propagiert wird, ist nicht, mehr Wähler zu überzeugen, sondern die Wähler so zu sortieren, dass sie nicht mehr zählen.
Der Druck auf republikanisch geführte Bundesstaaten wie Texas, North Carolina, Missouri und Indiana ist immens. Die Botschaft aus Washington ist unmissverständlich: Zeichnet die Karten neu. Sichert uns die Sitze.
Möglich wurde dieser offene Angriff erst durch einen juristischen Freibrief. Im Jahr 2019 fällte der Oberste Gerichtshof eine folgenschwere Entscheidung: Er erklärte sich für unzuständig bei Klagen gegen parteiisches Gerrymandering. Die Bundesgerichte, so das Urteil, sollten sich aus diesem „politischen Dickicht“ heraushalten. Damit war der Damm gebrochen. Der Gerichtshof hatte den Parteien faktisch die Lizenz erteilt, die Karten so unverschämt parteiisch zu zeichnen, wie es ihre Macht in den jeweiligen Parlamenten zuließ.
Das Skalpell in Missouri: Anatomie einer Zerstückelung
Wie diese Strategie in der Praxis aussieht, lässt sich nirgendwo so erschütternd beobachten wie in Kansas City, Missouri. Die Stadt ist eine verlässliche blaue, demokratische Insel in einem tiefroten, republikanischen Bundesstaat. Um diese Insel zu neutralisieren, wenden die republikanischen Kartenzeichner die klassische „Cracking“-Methode an.
Stellen Sie sich eine Gemeinschaft vor, einen Stadtteil mit ähnlichen Sorgen – Armut, Kriminalität, bezahlbarer Wohnraum. Bislang wurde diese Gemeinschaft von einem einzigen Abgeordneten in Washington vertreten. Nun wird dieser Stadtteil chirurgisch zerstückelt. Ein Teil wird einem ländlichen Bezirk im Norden zugeschlagen, der zweite Teil einem Bezirk im Süden, der dritte einem im Osten.
Jede dieser neuen Einheiten ist nun eine hoffnungslose Minderheit, ertränkt in einem Meer konservativer Wähler vom Land, deren Lebensrealität und politische Prioritäten fundamental anders sind. Die einheitliche Stimme von Kansas City wird zum Schweigen gebracht, ihre Anliegen werden in Washington nicht mehr gehört. Es ist die Zerstörung von Repräsentation durch Geometrie.
Ein ähnliches Manöver sehen wir in North Carolina. Dort zielen die Republikaner auf den Swing-Distrikt des demokratischen Abgeordneten Don Davis. Der Plan ist, den Bezirk so umzugestalten, dass er für die Republikaner sicher wird. Doch hier kommt eine weitere, brisante Ebene hinzu: Der Distrikt von Davis ist historisch stark von afroamerikanischen Wählern geprägt und hat eine lange Tradition in der Entsendung schwarzer Abgeordneter.
Das Vorgehen in North Carolina ist daher nicht nur parteiisch, es provoziert unweigerlich den Vorwurf des rassistischen Gerrymandering. Und im Gegensatz zum parteiischen ist rassistisches Gerrymandering nach dem Voting Rights Act von 1965 weiterhin illegal und vor Bundesgerichten einklagbar. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, das die gesamte Karte vor Gericht zerreißen könnte.
Das Dilemma der Demokraten: Prinzipien oder Macht?
Die republikanische Aggression stürzt die Demokraten in ein tiefes ideologisches Dilemma. Jahrelang waren sie die Partei, die überparteiliche, unabhängige Reformkommissionen forderte, um das Gerrymandering zu beenden. Barack Obama und sein ehemaliger Justizminister Eric Holder machten dies zu einem Kernanliegen ihrer Post-Präsidentschaft.
Nun müssen sie zusehen, wie die Republikaner Fakten schaffen. Die Demokraten stehen vor der klassischen Frage, ob sie sich eine „unilaterale Abrüstung“ leisten können. Ist es edel, an den eigenen Prinzipien festzuhalten, während die Gegenseite das Spielfeld unwiderruflich zu ihren Gunsten neigt?
Die Antwort, die führende Demokraten nun geben, ist ein schmerzhafter Pragmatismus. In Kalifornien treiben sie „Proposition 50“ voran, ein Wählerreferendum, das ebenfalls einen parteiischen Neuzuschnitt zugunsten der Demokraten ermöglichen soll. In Virginia, einem weiteren von ihnen kontrollierten Staat, werden ähnliche Pläne geschmiedet.
Selbst Obama und Holder unterstützen diese Gegenmaßnahmen nun, wenn auch zähneknirschend. Ihre Argumentation: Dies sei ein Notfall, eine temporäre Maßnahme, um die Demokratie vor einem autoritären Zugriff zu schützen. Doch die Büchse der Pandora ist geöffnet. Wenn beide Seiten das System manipulieren, um sich vor Manipulationen zu schützen, wer stoppt die Spirale?
Diese Zerrissenheit spiegelt sich auch in der Wahlkampfstrategie wider. Demokratische Strategen wissen, dass die reine Anti-Trump-Botschaft kurzfristig Wähler mobilisiert. Doch sie birgt die Gefahr, die langfristige Notwendigkeit zu vernachlässigen, eine eigene, positive Vision zu entwickeln. Der Kampf gegen Gerrymandering wird so zu einem reinen Abwehrkampf, der die eigene Identität aufzehrt.
Die Risiken des Krieges: Vom „Dummymandering“ und dem Widerstand der Vernunft
Dieser Krieg ist jedoch nicht ohne Risiken – für beide Seiten. Politikwissenschaftler warnen vor dem Phänomen des „Dummymandering“. Wenn eine Partei ihre Wähler zu aggressiv „crackt“ – also zu dünn auf zu viele Bezirke verteilt, um überall knapp zu gewinnen – macht sie all diese Bezirke anfällig. Eine leichte Verschiebung in der Wählerstimmung, eine unerwartete „Welle“ für die Gegenpartei, und die gesamte, kunstvoll konstruierte Mehrheit bricht zusammen. Texas erlebte dies 2018, als übermütig gezeichnete republikanische Sitze plötzlich an die Demokraten fielen.
Gleichzeitig formiert sich leiser, aber bedeutsamer Widerstand. Nicht jeder Republikaner ist bereit, dem Ruf des Weißen Hauses blind zu folgen. In Indiana und Nebraska gibt es prominente republikanische Stimmen, die sich dem Druck widersetzen.
Der prominenteste von ihnen, der ehemalige Gouverneur von Indiana, Mitch Daniels, vertritt eine Haltung, die in der modernen GOP selten geworden ist. Er argumentiert, dass ein solch nackter Machtmissbrauch die Wähler abstößt und der Partei langfristig mehr schadet als nützt. Die Pflicht der Mandatsträger, so Daniels, gelte den Bürgern und der Fairness, nicht einer nationalen Parteizentrale. Es ist ein Appell an das Gewissen, der zeigt, dass der Konflikt auch die Republikaner innerlich zerreißt.
Das Urteil: Wenn die Kartenzeichner die Wähler wählen
Wir stehen an einem Scheideweg. Die Versuche, Gerrymandering auf Bundesebene zu stoppen, wie etwa durch den „Freedom to Vote Act“, sind im Kongress gescheitert. Die Reformbewegung für unabhängige Kommissionen, die in einigen Staaten erfolgreich war, wird nun durch das parteiische Wettrüsten konterkariert.
Der „Redistricting-Krieg“ von 2025 ist mehr als nur ein politisches Manöver. Er ist der Ausdruck einer tiefen Krise. Er verschärft die Polarisierung, indem er Stadt und Land gegeneinander ausspielt und Wähler in „sichere“ rote und blaue Enklaven sortiert.
Alle Augen richten sich nun wieder auf den Supreme Court. Ein Fall aus Louisiana, der derzeit verhandelt wird, könnte den Voting Rights Act weiter aushöhlen und es noch einfacher machen, die Stimmen von Minderheiten zu dilutieren.
Am Ende dieses Kampfes könnte eine Landschaft aus politisch unumkehrbaren Festungen stehen, in der die Parteien ihre Wähler wählen, und nicht umgekehrt. Die eigentliche Tragödie dieses Krieges um die Karten ist nicht, dass eine Partei ein paar Sitze mehr gewinnt. Die Tragödie ist, dass Millionen von Wählern – in den zerstückelten Vierteln von Kansas City oder den neu zugeschnittenen Bezirken von North Carolina – zu dem Schluss kommen müssen, dass ihre Stimme irrelevant geworden ist, entschieden durch den Stift eines Kartographen, lange bevor der Wahltag überhaupt begonnen hat.