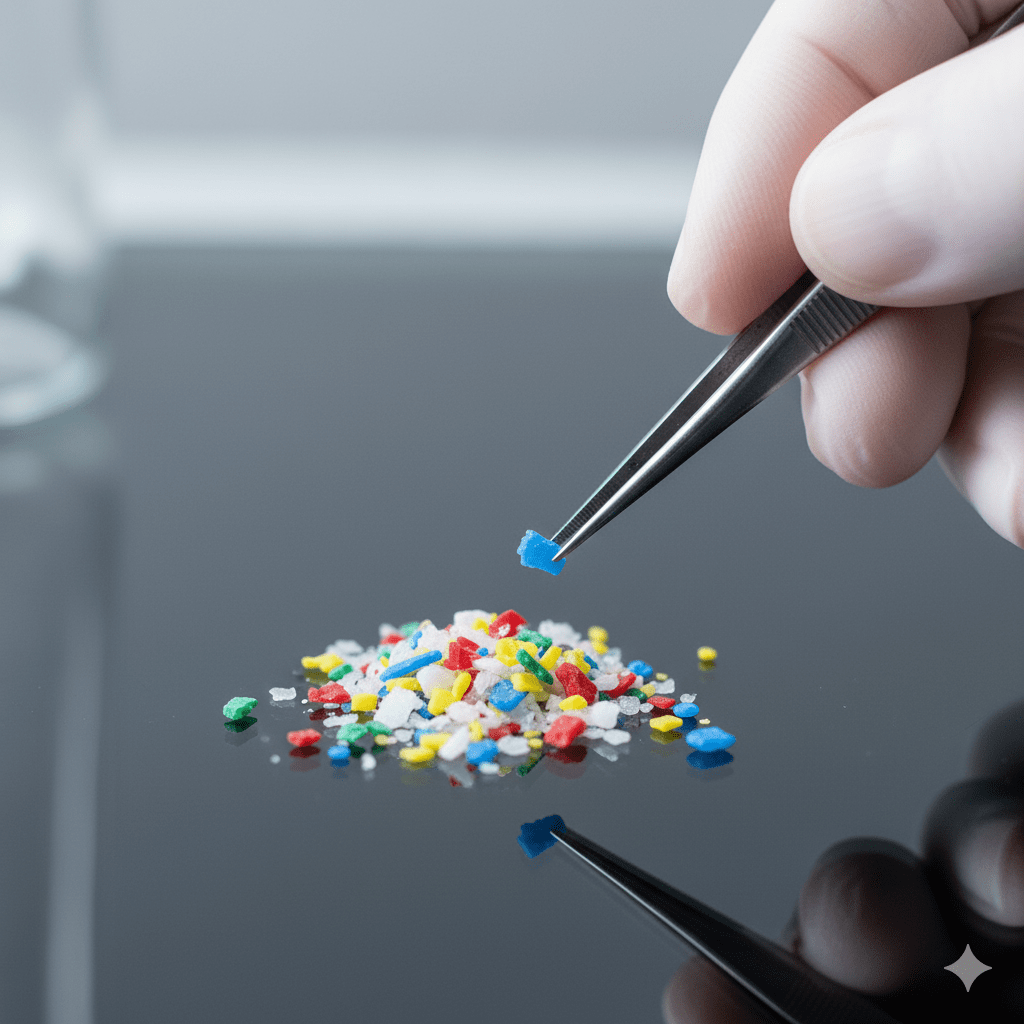In Washington herrscht in diesen Tagen eine Atmosphäre, die weniger von staatstragender Würde als von nervöser Unruhe geprägt ist. Präsident Donald Trump steht kurz vor seiner State of the Union-Rede, einem Ritual, das gewöhnlich der politischen Selbstvergewisserung dient. Doch der Boden, auf dem er steht, schwankt bedenklich. Statt mit einem Triumphzug sieht sich der Präsident mit vernichtenden Schlagzeilen und absackenden Umfragewerten konfrontiert, während die Wählerschaft Zeuge einer doppelten Turbulenz wird: Chaos im Ausland und institutionelle Risse im Inneren. Der eigentliche Paukenschlag, der die Architektur seiner zweiten Amtszeit erschüttert, kam jedoch nicht von der Opposition, sondern aus dem Herzstück der verfassungsrechtlichen Ordnung. Der Supreme Court hat Trumps weitreichende globale Zölle, die er über den International Emergency Economic Powers Act durchzusetzen versuchte, kassiert und ihm damit das zentrale Instrument seiner Wirtschaftspolitik aus der Hand geschlagen.
Es ist ein Moment tiefer Spaltung, in dem die Reibungshitze zwischen dem exekutiven Machtanspruch und der institutionellen Realität ein kritisches Niveau erreicht hat. Trump versucht, das Narrativ seiner zweiten Amtszeit in der kommenden Woche neu zu setzen, doch die Ereignisse haben eine Eigendynamik entwickelt, die sich der bloßen Rhetorik entzieht. Was wir erleben, ist nicht bloß ein juristischer Rückschlag, sondern die Kollision eines imperialen Präsidentschaftsverständnisses mit den noch funktionierenden Sicherungen der Republik.
Die Revolte der eigenen Richter
Die Ironie der Geschichte könnte kaum schärfer sein: Es sind nicht die liberalen Richter, die den Präsidenten in die Schranken weisen, sondern jene konservativen Juristen, die er selbst installiert hat, um sein Vermächtnis zu sichern. Das Urteil des Supreme Court war eindeutig: Der Präsident besitzt nicht die Autorität, ohne explizite Zustimmung des Kongresses solch umfassende Zölle zu verhängen. Doch statt diese verfassungsrechtliche Lektion als Teil der Gewaltenteilung zu akzeptieren, reagierte Trump mit einer Heftigkeit, die das Gericht nicht als unabhängige Instanz, sondern als fehlfunktionierendes politisches Werkzeug entlarvt. Er sieht den Court als ein Gremium, das ihm Gefolgschaft schuldet, weil er die Richter ernannt hat.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Besonders brisant ist die Rolle von Neil Gorsuch und Amy Coney Barrett. Ihre Entscheidung gegen die Exekutive provozierte eine Reaktion des Präsidenten, die in der amerikanischen Geschichte ihresgleichen sucht. Er bezeichnete seine eigenen Ernannten öffentlich als unpatriotisch, nannte sie eine Schande für ihre Familien und unterstellte ihnen gar, von ausländischen Interessen beeinflusst zu sein. Diese Rhetorik offenbart ein tiefes Missverständnis des amerikanischen Systems. Justice Gorsuch formulierte es in seinem Votum, das nun in ganz Washington zirkuliert, mit einer fast schon klassischen Nüchternheit: Das System sei nicht dafür gemacht, dass ein Mann so viel Macht hat.
Trumps Reaktion auf diese juristische Niederlage ist bezeichnend für seinen Regierungsstil. Noch am selben Tag verkündete er über Truth Social und vom Podium des Weißen Hauses, dass das Urteil für ihn eher symbolischen Charakter habe und er bereits neue Wege gefunden habe, das Gericht zu umgehen. Er beruft sich nun auf andere Statuten und Methoden, um seine Zollpolitik durchzusetzen, und demonstriert damit offen seinen Willen, die Entscheidung der Judikative auszuhebeln. Es ist der Versuch, das Recht durch schieren Willen zu brechen. Während vor dem Justizministerium riesige Banner mit seinem Konterfei hängen – ein visuelles Zeichen der Vereinnahmung –, wächst selbst bei Republikanern die Sorge um die Unabhängigkeit der Justiz. Trump akzeptiert keine Grenzen, auch nicht die seiner eigenen Richter.

USA Politik Leicht Gemacht: Politik in den USA – einfach erklärt.
Der ökonomische Bumerang
Hinter dem verfassungsrechtlichen Streit verbirgt sich eine ökonomische Realität, die für den Präsidenten noch gefährlicher werden könnte als jeder Richterspruch. Trump ist besessen von der Idee der Zölle; er sieht sie als Allheilmittel, als Knüppel gegen Freunde und Feinde gleichermaßen, ein Glaube, der bis in seine Zeit als Geschäftsmann in New York zurückreicht. Doch diese Obsession kollidiert nun frontal mit dem Alltag der Amerikaner. Das Wirtschaftswachstum hat sich im Jahr 2025 verlangsamt, und Ökonomen führen dies direkt auf Trumps Zölle und den Regierungs-Shutdown im Herbst zurück.
Während Trump behauptet, er habe die Erschwinglichkeit gewonnen und die Benzinpreise seien dramatisch gefallen – eine Behauptung, die faktisch falsch ist, da er weder eine hohe Inflation noch eine Arbeitslosenkrise in dem Maße geerbt hat, wie er es darstellt –, spüren die Wähler etwas anderes. Die Preise sind hoch geblieben, und die Zölle wirken wie eine Steuer auf den Konsum. Selbst in Staaten, die ihn überwältigend gewählt haben, ist der Schmerz spürbar. Demokratische Gouverneure wie J.B. Pritzker aus Illinois nutzen dies nun für eine fast schon theatralische Gegenoffensive, indem sie dem Präsidenten symbolisch Rechnungen schicken für die Mehrkosten, die den Bürgern durch seine Politik entstanden sind.
Trumps Versuch, die wirtschaftliche Verantwortung weiterhin der Biden-Administration zuzuschieben, verfängt nach über einem Jahr im Amt immer weniger. Sein eigener Wirtschaftsberater Kevin Hassett musste bereits im Dezember einräumen, dass es ab einem gewissen Punkt Trumps Wirtschaft ist – zumindest dort, wo es gut läuft. Trump reklamiert Erfolge für sich, aber Misserfolge bleiben Waisen oder werden den Vorgängern angelastet. Doch die Wähler, die unter den Kosten ächzen, kaufen ihm diese Erzählung zunehmend nicht mehr ab. Die Zölle, die er als Instrument nationaler Stärke verkauft, entpuppen sich als ökonomischer Bumerang, der genau jene Schichten trifft, die er zu schützen vorgibt.
Außenpolitik als Chaos-Management
Die aggressive Unilateralität, die Trump im Inneren zeigt, spiegelt sich spiegelbildlich in einer Außenpolitik wider, die weniger einer Strategie als einem gefährlichen Improvisationstheater gleicht. Die Verbündeten der USA sind in einem Zustand, den man nur als verängstigt beschreiben kann. In Europa herrscht die Sorge, dass die jahrzehntealte Allianz zerfasert und die Vereinigten Staaten unter Trump völlig aus der Spur geraten sind. Das Urteil des Supreme Court sorgte international kurzzeitig für Erleichterung, da es zeigte, dass es noch funktionierende Kontrollmechanismen gibt, doch Trumps sofortige Ankündigung, das Urteil zu umgehen, hat neue Wellen der Unsicherheit in die globalen Märkte gesendet.
Besonders alarmierend ist die Situation im Nahen Osten. Trump hat eine gewaltige militärische Armada in die Region entsandt, Truppen, die teilweise aus der westlichen Hemisphäre abgezogen wurden, wo sie zuvor im Kontext von Venezuela massiert waren. Doch zu welchem Zweck? Der Präsident droht mit begrenzten Schlägen gegen den Iran und lässt seine Gesandten über einen Deal verhandeln, ohne den Kongress auch nur zu konsultieren oder der Öffentlichkeit eine Strategie zu erklären. Es scheint, als wolle er den von Obama ausgehandelten Atomdeal, den er in seiner ersten Amtszeit sprengte, durch einen neuen Vertrag ersetzen, nur damit sein eigener Name darunter steht.
Gleichzeitig sendet er widersprüchliche Signale: Er spricht von Friedensgrenzen, während er einen Krieg vorbereitet. Er deutete Unterstützung für iranische Demonstranten an, ohne Taten folgen zu lassen. Diese Inkohärenz ist gefährlich. Die USA stehen am Rande eines neuen Krieges im Nahen Osten, ohne dass jemand – weder die Bürger noch der Kongress – weiß, warum oder mit welchem Ziel. Für eine Basis, die einst von Trumps Versprechen angezogen wurde, endlose Kriege zu beenden, ist dieser militärische Aufmarsch ein potenzieller Bruchpunkt. Es ist Außenpolitik als reines Ego-Projekt, losgelöst von langfristigen nationalen Interessen.
Die Erosion der Machtbasis
Die vielleicht dramatischste Entwicklung vollzieht sich jedoch im Fundament der republikanischen Machtbasis selbst. Die einstmals monolithische Unterstützung für Trump beginnt Risse zu zeigen, die nicht mehr zu kitten sind. Besonders bei weißen Männern ohne College-Abschluss, der historischen Kernklientel der MAGA-Bewegung, ist der Rückhalt eingebrochen. Stimmten diese Gruppen einst zu 70 Prozent für ihn, sind sie nun in Umfragen 50/50 gespalten. Die wirtschaftliche Realität frisst sich in die Loyalität.
Auch innerhalb der Partei gärt es. Marjorie Taylor Greene, einst eine Ikone der Bewegung, ist nicht mehr im Kongress und hat sich zu einer Nemesis des Präsidenten gewandelt. Dieser Bruch ist symptomatisch für eine Koalition, die unter dem Druck von Trumps erratischem Kurs zerbricht. Republikaner im Kongress fürchten nichts mehr als eine Abstimmung über Trumps Zölle. Sie wissen, dass ein solches Votum die fragile Allianz aus moderaten Wählern und Hardcore-Anhängern sprengen könnte, auf die sie angewiesen sind, um ihre knappe Mehrheit zu halten.
Trump scheint das Gespür für diese Stimmungen verloren zu haben. Seine einstige politische Superkraft, die Intuition für die Emotionen der Menschen, weicht einer Fixierung auf das eigene Vermächtnis. Berater berichten, dass es ihm nicht mehr darum geht, die Mehrheit im November zu sichern, sondern darum, Monumente seines eigenen Egos zu errichten. Themen wie die Epstein-Akten, Einwanderungskontroversen und bizarre Ideen wie der Kauf von Grönland schaffen zusätzliche Bruchlinien, die selbst eingefleischte Anhänger irritieren. Der Präsident agiert zunehmend isoliert in einer Blase, die sich immer weiter von den Sorgen seiner Wähler entfernt.
Ein Präsident im freien Fall
Wenn Donald Trump in der kommenden Woche vor den Kongress tritt, wird er versuchen, das Bild einer starken Nation und einer noch stärkeren Präsidentschaft zu zeichnen. Er wird eine Rede halten, die eher einer Wahlkampfveranstaltung gleicht als einer politischen Grundsatzrede, und versuchen, seine Basis mit den bekannten Parolen zu mobilisieren. Doch hinter der Kulisse der Stärke verbirgt sich ein Präsident im freien Fall. Die Versuche, die wirtschaftliche Lage schönzureden – etwa mit der Lüge, Benzin koste unter zwei Dollar –, sind Akte der Verzweiflung, nicht der Souveränität.
Trump hat den Bogen überspannt. Sein Versuch, das System der Gewaltenteilung zu umgehen, erzeugt nur noch mehr Chaos und Unsicherheit, die nun nicht mehr nur politische Gegner treffen, sondern die Geldbeutel seiner eigenen Wähler und die Stabilität der Weltmärkte. Er hat die Justiz gegen sich aufgebracht, die ökonomischen Daten sprechen gegen ihn, und der Rückhalt in seiner eigenen Partei bröckelt. Was als Triumphzug einer zweiten Amtszeit geplant war, entpuppt sich zunehmend als Lehrstück über die Grenzen der Macht. Der Präsident mag versuchen, die Realität zu ignorieren, aber wie die Rechnung des Gouverneurs von Illinois zeigt: Irgendwann muss jeder zahlen.