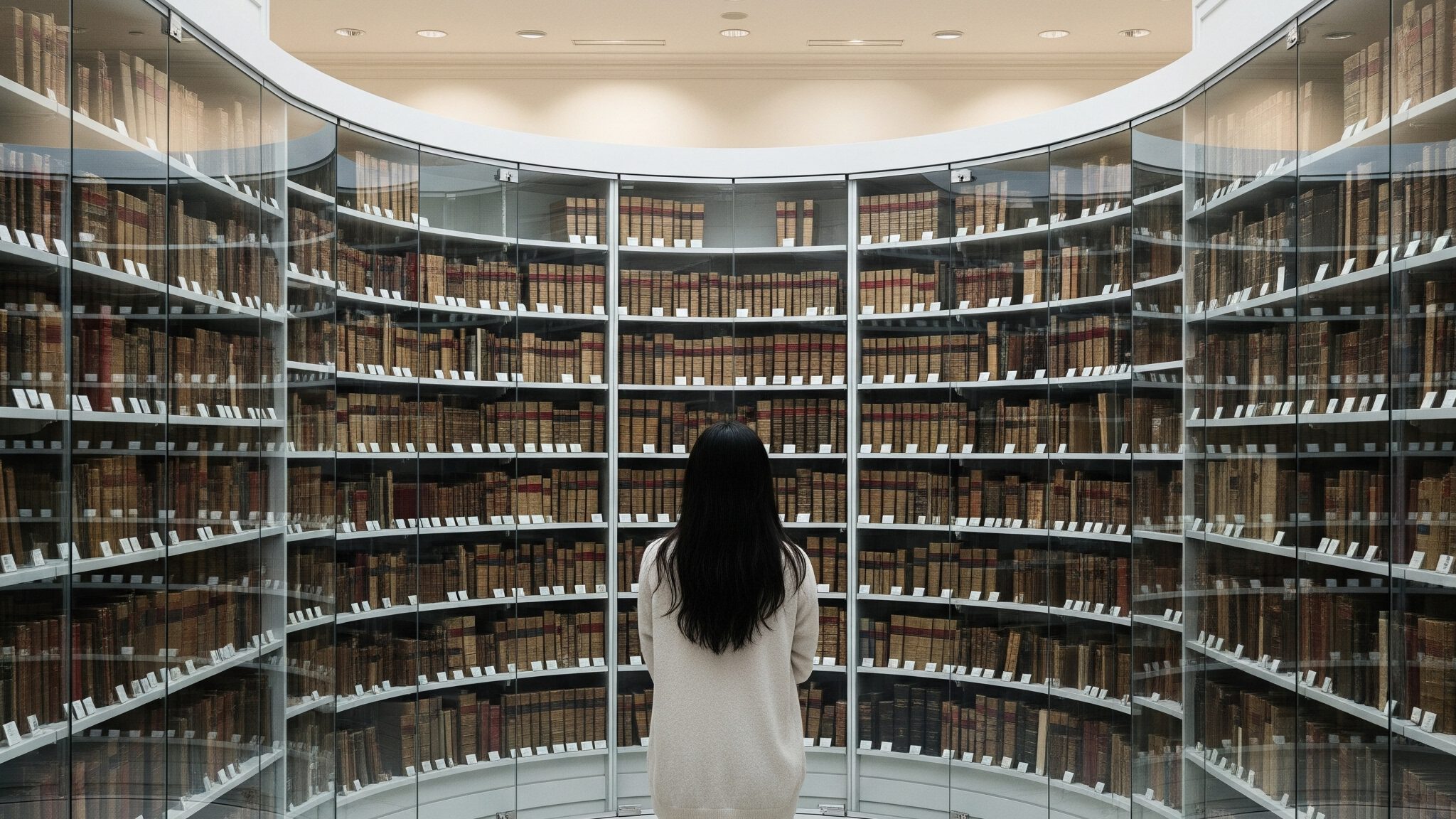
Stellen Sie sich einen digitalen Hebel vor, entworfen, um das Fundament des amerikanischen Staates zu bewegen. Ein einziger Klick, und eine gewaltige, unsichtbare Maschine beginnt, das jahrzehntelang gewachsene Dickicht aus Regeln, Vorschriften und Paragrafen zu lichten – schneller, radikaler und rücksichtsloser als jede Regierung zuvor. Dies ist keine Szene aus einem Science-Fiction-Roman, sondern der Kern eines der ambitioniertesten und zugleich heikelsten Projekte der Trump-Administration: der Plan, mithilfe einer künstlichen Intelligenz die Hälfte aller Bundesvorschriften der USA auszulöschen.
Angetrieben von der Vision einer entfesselten Wirtschaft und dem Versprechen, Billionen von Dollar freizusetzen, hat eine von Elon Musks Ideen beflügelte Spezialeinheit namens DOGE (Department of Government Efficiency) ein Werkzeug geschaffen, das die Axt an die amerikanische Bürokratie legen soll. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppt sich dieser techno-populistische Traum als ein hochriskantes Experiment. Es ist eine Geschichte, die tief in die Maschinenräume der Macht führt und eine fundamentale Frage aufwirft: Was geschieht, wenn der politische Wille zur Zerstörung auf eine Technologie trifft, deren wahre Leistungsfähigkeit und deren Konsequenzen niemand vollständig überblickt? Die Antwort darauf ist ein Lehrstück über den Zusammenprall von ideologischem Eifer, bürokratischer Beharrlichkeit und den unumstößlichen Grenzen des Rechts.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die Verheißung der Maschine: Billionen-Einsparungen per Mausklick?
Im Herzen dieses Vorhabens schlägt eine fast schon utopisch anmutende Verheißung. Ein internes PowerPoint-Dokument, das wie ein Drehbuch für eine Revolution von oben wirkt, zeichnet das Bild einer beispiellosen Effizienz. Das Ziel: die Beseitigung von rund 100.000 der etwa 200.000 Bundesvorschriften, und das innerhalb des ersten Jahres nach Trumps Amtseinführung. Die Waffe der Wahl ist das „DOGE AI Deregulation Decision Tool“, ein Algorithmus, der darauf trainiert ist, Gesetze zu lesen und Vorschriften zu identifizieren, die über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinausgehen. Die versprochene Belohnung ist astronomisch: Einsparungen von 3,3 Billionen Dollar pro Jahr und die Freisetzung von „externen Investitionen“ in nicht näher bezifferter Höhe.
Dieser technologische Kraftakt ist auch eine direkte Antwort auf eine tief sitzende Frustration im konservativen Lager. Bisherige Deregulierungsbemühungen unter Trump glichen eher dem mühsamen Abtragen eines Berges mit der Spitzhacke als einem Erdrutsch. Trotz eines erklärten Ziels, für jede neue Regel zehn alte zu streichen, war der Fortschritt enttäuschend langsam. Die Zahlen eines konservativen Think-Tanks belegen, dass die Administration weit hinter den Erfolgen ihrer ersten Amtszeit zurückblieb. Die Bürokratie erwies sich als zäher und widerstandsfähiger als erwartet. Die KI soll nun der Brandbeschleuniger sein, der diesen zähen Prozess in einen blitzschnellen Akt der Transformation verwandelt. Statt 3,6 Millionen menschlicher Arbeitsstunden, so die kühne Kalkulation, soll die KI den Prozess auf eine fast schon lächerliche Dauer von 36 Stunden reiner Menschenarbeit reduzieren. Es ist das Versprechen eines sauberen, chirurgischen Eingriffs, der den Staat von seinen Fesseln befreit.
Widerstand im Apparat: Wenn der Mensch die Maschine bremst
Doch der amerikanische Regierungsapparat ist kein lebloses Betriebssystem, das man einfach neu starten kann. Er ist ein komplexer Organismus aus Institutionen, etablierten Prozessen und vor allem Menschen – mit eigenen Expertisen, Verantwortlichkeiten und einem ausgeprägten Beharrungsvermögen. Genau hier, im menschlichen Faktor, trifft die kalte Logik des Algorithmus auf heftigen Widerstand. Die von Elon Musk inspirierte DOGE-Einheit, eine Art Fremdkörper im Regierungsgefüge, wurde von den etablierten Behördenmitarbeitern mit tiefem Misstrauen empfangen. Es waren nicht nur Sorgen um den Verlust eigener Kompetenzen, sondern handfeste Zweifel an der fachlichen Qualifikation dieser externen „Effizienz-Experten“.
Wie sollen Ingenieure, so die unausgesprochene Frage in den Fluren der Ministerien, die feinen Nuancen und die tiefere Logik von hochtechnischen Vorschriften verstehen, die oft das Ergebnis jahrelanger Abwägungen sind? Diese Skepsis führte dazu, dass der Einfluss des DOGE-Teams schwand und seine Vorstöße wiederholt zurückgewiesen wurden. Der Plan, die Entscheidungsfindung an eine Blackbox auszulagern, stieß auf die Wand einer etablierten Verwaltungskultur. So entsteht ein beinahe absurdes Paradoxon, das den Kern des Problems trifft: Der Drang der Administration, den Personalbestand drastisch zu reduzieren und den „tiefen Staat“ auszutrocknen, behindert paradoxerweise genau jene Deregulierungsbemühungen, die er vorantreiben soll. Denn um Regeln vorschriftsmäßig und rechtssicher zu ändern oder zu streichen, braucht es Personal und Zeit – Ressourcen, die durch die Entlassungskampagnen knapp geworden sind. Der Wettlauf um die Spitzenposition auf der internen Deregulierungs-Rangliste wird so zu einem Rennen mit angezogener Handbremse.
Im Schatten des Gesetzes: Lässt sich Demokratie einfach ‚weg-optimieren‘?
Die größte Hürde für den digitalen Kahlschlag ist jedoch weder technologischer noch menschlicher, sondern rechtlicher Natur. Die Abschaffung von Bundesvorschriften ist in den USA kein einfacher administrativer Akt, sondern unterliegt dem Administrative Procedure Act (APA), einem Gesetz, das als das prozedurale Rückgrat der amerikanischen Verwaltung gilt. Es schreibt einen geordneten, nachvollziehbaren und oft langwierigen Prozess vor, der öffentliche Anhörungen und gerichtliche Überprüfungen einschließt. Die Idee, diesen Prozess durch eine KI quasi zu überspringen, wird von Rechtsexperten wie Nicholas Bagley von der University of Michigan als rechtlich höchst fragwürdig, wenn nicht gar als zum Scheitern verurteilt angesehen.
Man kann Regeln, die aus gutem Grund existieren – sei es zum Schutz der Umwelt, der Lebensmittelsicherheit oder der Finanzmärkte –, nicht einfach per Dekret für nichtig erklären. Gerichte haben solche „effekthascherischen Nebenschauplätze“ in der Vergangenheit bereits gestoppt. Das Bewusstsein für diese rechtliche Klippe scheint selbst innerhalb des DOGE-Teams vorhanden zu sein. In einer bemerkenswerten Passage der internen Präsentation wird betont, dass vier Anwälte des Teams das KI-Tool „geprüft und gebilligt“ hätten – ein Schritt, der weniger wie eine juristische Selbstverständlichkeit als vielmehr wie der Versuch wirkt, einem wackeligen Konstrukt einen Anschein von Legitimität zu verleihen. Die entscheidende Frage bleibt: Wird das Rechtssystem eine Abkürzung durch einen Algorithmus erlauben, oder wird es darauf bestehen, dass auch für eine Regierung, die Disruption predigt, die Spielregeln der Demokratie gelten?
Der Realitätscheck: Ein Algorithmus auf dem Prüfstand
Wie fehleranfällig die technologische Vision in der Praxis ist, zeigt der Pilotversuch im Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD). Hier wurde das KI-Tool erstmals auf reale Vorschriften losgelassen. Das Ergebnis war ernüchternd und entlarvte die Kluft zwischen der glänzenden PowerPoint-Präsentation und der unordentlichen Wirklichkeit. Mitarbeiter, die die Vorschläge des Algorithmus überprüfen sollten, berichteten von signifikanten Fehlern. Die KI behauptete an mehreren Stellen, die Verfasser der ursprünglichen Regelungen hätten das zugrunde liegende Gesetz falsch interpretiert.
Doch bei der Überprüfung durch menschliche Experten stellte sich heraus, dass in einigen Fällen genau das Gegenteil der Fall war: Nicht die Regel war fehlerhaft, sondern die KI hatte den Gesetzestext falsch gelesen. Dieser Vorfall ist mehr als eine technische Panne. Er legt den Finger in die Wunde des gesamten Projekts. Wenn eine KI, die als unfehlbares Analyseinstrument angepriesen wird, bereits bei der Interpretation von Gesetzestexten scheitert, wie kann ihr dann die Verantwortung für die Demontage des regulatorischen Rahmens einer ganzen Nation anvertraut werden? Die offiziellen Reaktionen von HUD und dem Weißen Haus auf die Enthüllungen sind bezeichnend. Sie sprechen vage von „laufenden Diskussionen“ und betonen, der Prozess sei „weit davon entfernt, abgeschlossen zu sein“. Es ist die Sprache der Schadensbegrenzung, die verrät, dass der Plan vom Reißbrett auf dem harten Boden der Realität aufgeschlagen ist. Die KI soll die Expertise der Mitarbeiter nicht ersetzen, sondern ergänzen, heißt es nun beschwichtigend – ein deutlicher Rückzieher von der ursprünglichen Vision einer vollautomatisierten Deregulierung. Das Projekt, das angetreten war, um Amerika bis zum 20. Januar 2026 „neu zu starten“, steckt fest – gefangen zwischen seinen eigenen Ambitionen, den Tücken der Technik und den unerbittlichen Realitäten von Recht und Verwaltung.


