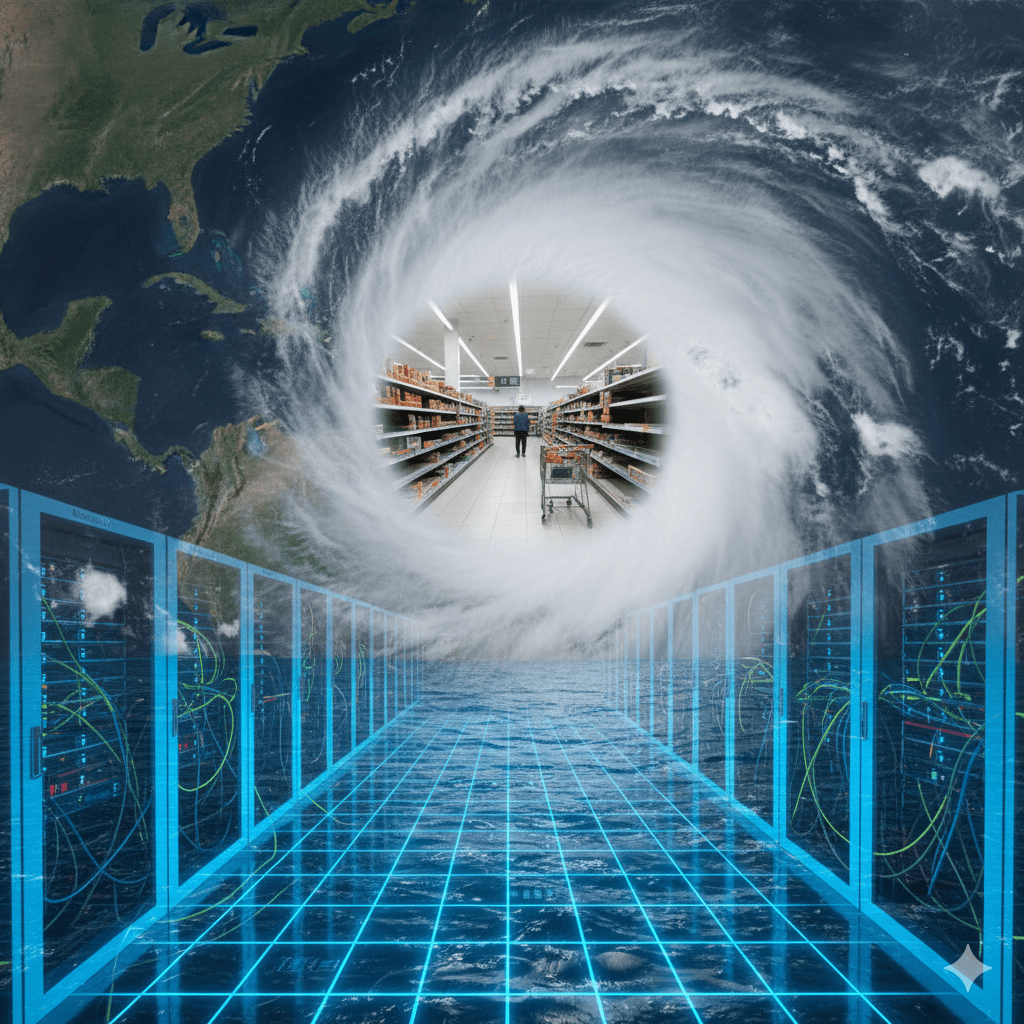Es gibt Momente in der Geschichte, in denen das Rauschen der herannahenden Katastrophe so ohrenbetäubend ist, dass die politische Stille im Zentrum der Macht fast surreal wirkt. Wer sich an den Vorabend des Irakkrieges erinnert, sieht einen Präsidenten vor sich, der das Land monatelang auf einen Konflikt einschwor. George W. Bush reiste durch die Vereinigten Staaten, sprach in der Union Terminal in Cincinnati und warnte die Öffentlichkeit im Oktober 2002 eindringlich vor der Gefahr, die von Saddam Husseins Regierung ausgehe. Er beschwor das Schreckgespenst chemischer und biologischer Waffen, verglich die Dringlichkeit der Lage mit der Kubakrise von 1962 und deklarierte Untätigkeit zur gefährlichsten aller Optionen. Dass sich ein Großteil dieser Argumente später als Resultat selektiver Geheimdienstinformationen und schlichtweg falscher Behauptungen entpuppte, ändert nichts an der Mechanik der damaligen Kriegsvorbereitung. Der Krieg, der folgte, ist als einer der schwerwiegendsten strategischen Fehler der jüngeren amerikanischen Geschichte in das kollektive Gedächtnis eingegangen.
Heute, mehr als zwei Jahrzehnte später, bereiten die Vereinigten Staaten erneut einen gewaltigen militärischen Schlag vor, den zweiten großen Angriff auf den Iran in weniger als einem Jahr, doch der amtierende Präsident verzichtet fast völlig darauf, diesen Schritt vor seinem Volk zu legitimieren. Es ist ein leiser, unheimlicher Marsch in einen Konflikt, der das Potenzial hat, den Nahen Osten in einen Flächenbrand zu verwandeln.
Das Vakuum der Strategie und der Krieg ohne Begründung
Während sich am Horizont des Persischen Golfs eine massive militärische Streitmacht sammelt, hüllt sich das Weiße Haus in ein strategisches Vakuum. Präsident Donald Trump droht mit einem erneuten Angriff, ohne auch nur im Ansatz zu erklären, wie akut die Bedrohung tatsächlich ist. Noch beunruhigender ist die offene Widersprüchlichkeit der vorgebrachten Motive. Man müsse erneut zuschlagen, obwohl der Präsident nach der letzten Offensive noch triumphierend verkündet hatte, die ins Visier genommenen Atomanlagen des Irans seien bereits ausgelöscht worden.
Wenn überhaupt über Ziele gesprochen wird, dann in einem flüchtigen Nebel aus beiläufigen Bemerkungen. Mal geht es dem Präsidenten und seinen Beratern um das iranische Atomwaffenprogramm, mal um den Schutz jener Demonstranten, die im vergangenen Monat zu Tausenden von iranischen Sicherheitskräften getötet wurden. Dann wieder lautet das Ziel, das Raketenarsenal zu vernichten, mit dem Teheran Israel bedrohen könnte, oder die finanzielle Nabelschnur zu kappen, die Hamas und Hisbollah am Leben hält. Es stellt sich die unausweichliche Frage, ob militärische Gewalt, der Hammer, nach dem in Washington derzeit so rasch gegriffen wird, diese komplexen politischen Ziele überhaupt erreichen kann. Die Vorstellung, dass Luftschläge iranischen Demonstranten unmittelbar helfen oder die Terrorfinanzierung stoppen könnten, entbehrt jeder strategischen Logik. Ein Großteil des fast waffenfähigen Urans liegt ohnehin seit dem letzten Angriff im Juni sicher unter der Erde begraben.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die Diskrepanz zur historischen Konfliktbewältigung ist eklatant. Es gibt keine präsidialen Reden, die eine amerikanische Öffentlichkeit auf einen Schlag gegen eine Nation mit rund 90 Millionen Einwohnern vorbereiten. Der Kongress wurde nicht um Zustimmung gebeten. Es ist, als würde man die Prinzipien der post-vietnamesischen Außenpolitik bewusst ignorieren. Robert S. Litwak beschreibt dieses Vorgehen als Bruch mit dem sicherheitspolitischen Konsens der Powell-Doktrin, da die Vielzahl der genannten Begründungen, von Nichtverbreitung über den Schutz von Demonstranten bis hin zum Regimewechsel, jede klare strategische Linie vermissen lässt.
Besonders paradox wird diese Fixierung auf den Iran, wenn man den Blick auf andere Weltregionen richtet. Nordkorea hat nach den gescheiterten Verhandlungen in der ersten Amtszeit Trumps sein Arsenal auf schätzungsweise 60 oder mehr Atomsprengköpfe ausgebaut und arbeitet aktiv daran, dass diese Waffen amerikanisches Festland erreichen können. In der nationalen Sicherheitsstrategie der aktuellen Administration wird Nordkorea dennoch mit keinem einzigen Wort erwähnt.
Alleingang im Pulverfass und Verbündete im Dunkeln
Es ist eine Konstante der modernen amerikanischen Kriegsführung, dass sie sich auf Koalitionen stützt. Vor der Invasion des Iraks versammelte George W. Bush hochrangige westliche Alliierte, angeführt von Großbritannien, auf den Azoren, um der Welt eine geschlossene Front zu präsentieren und ein freies Irak zu planen. Die aktuelle Konfrontation mit dem Iran hingegen ist durch eine beispiellose diplomatische Isolation gekennzeichnet. Keiner der traditionellen Verbündeten scheint in die militärische Planung der USA involviert zu sein, mit der einzigen Ausnahme Israels.

USA Politik Leicht Gemacht: Politik in den USA – einfach erklärt.
Auf der Münchner Sicherheitskonferenz äußerten Vertreter engster NATO-Verbündeter tiefes Unbehagen darüber, dass Washington sie fast vollständig im Dunkeln lässt. Hinter vorgehaltener Hand äußerten Diplomaten massive Zweifel daran, dass die USA überhaupt überzeugend darlegen könnten, warum ein militärisches Eingreifen zum jetzigen Zeitpunkt notwendig sei. Die Entfremdung von den Verbündeten nimmt dabei konkrete Züge an. Der britische Premierminister Keir Starmer verweigerte Berichten zufolge die Nutzung der britischen Militäreinrichtungen auf Diego Garcia und einer Basis in Gloucestershire für jegliche Operationen gegen den Iran. Die Antwort aus Washington ließ nicht lange auf sich warten. Der US-Präsident kritisierte öffentlich scharf das geplante britische Abkommen über eine hundertjährige Pacht für den Stützpunkt Diego Garcia.
Der einzige verbliebene Partner in diesem riskanten Spiel ist Israel. Premierminister Benjamin Netanjahu drängt vehement auf einen entscheidenden Schlag, um die Fähigkeiten Teherans, Raketen auf Israel abzufeuern, nachhaltig zu schwächen und das iranische Regime ein für alle Mal zu zerschlagen. Das israelische Sicherheitskabinett verlegte sogar eigens eine Sitzung vor, und die israelischen Streitkräfte bereiten sich in höchster Alarmbereitschaft auf einen möglichen gemeinsamen Angriff vor. Das Kalkül ist ein tagelanges, schweres Bombardement, das den Iran zu Zugeständnissen am Verhandlungstisch zwingen soll.
Die Armada bringt sich in Stellung für ein Spiel auf Zeit
Während die diplomatischen Fronten verhärten, spricht die logistische Realität eine deutliche Sprache. Die militärische Maschinerie der Vereinigten Staaten hat sich derart massiv im Nahen Osten positioniert, dass ein Angriff theoretisch an jedem kommenden Wochenende befohlen werden könnte. Die Armada, die sich zusammenzieht, ist gewaltig . Neben Dutzenden von Tankflugzeugen, die für eine längere Luftkampagne unabdingbar sind, wurden über 50 zusätzliche Kampfjets der Typen F-35, F-22 und F-16 aus den USA über Europa in die Region verlegt. B-2-Tarnkappenbomber, die bereits im vergangenen Jahr gegen den Iran eingesetzt wurden, befinden sich in erhöhter Alarmbereitschaft.
Im Zentrum dieser Machtdemonstration stehen zwei Flugzeugträgerkampfgruppen. Die U.S.S. Gerald R. Ford, eben noch vor der Küste Venezuelas im Einsatz, um Druck auf die dortige Regierung auszuüben, eilt in Richtung Mittelmeer, um sich der Flotte um die U.S.S. Abraham Lincoln anzuschließen. Strategisch soll die Ford offenbar zunächst vor der Küste Israels positioniert werden, um Städte wie Tel Aviv zu verteidigen. Die Liste der anvisierten Ziele im Iran ist umfassend. Sie reicht von Kurzstrecken- und Mittelstreckenraketen über nukleare Anlagen bis hin zu den Hauptquartieren der einflussreichen Islamischen Revolutionsgarden.
Doch dieser Aufmarsch offenbart auch Schwächen. Noch vor einem Monat stand das Pentagon schlecht da, als der Präsident mit Schlägen drohte. Die 30.000 bis 40.000 in der Region stationierten US-Soldaten verfügten kaum über ausreichende Luftabwehrsysteme, um sich gegen einen zu erwartenden iranischen Gegenschlag zu verteidigen. Erst in den vergangenen Wochen wurden eilig Patriot- und THAAD-Systeme herbeigeschafft, die ballistische Raketen abfangen können. Experten wie Vali Nasr warnen jedoch vor einer gefährlichen Illusion. Die laufenden indirekten diplomatischen Verhandlungen verschaffen den USA zwar die nötige Zeit für diesen militärischen Aufbau, doch sie geben gleichzeitig dem Iran denselben Raum, um weitreichende und verheerende Vergeltungsschläge zu planen. Ob die amerikanische Armee für einen langen, zermürbenden Krieg jenseits einer kurzen Kampagne wirklich gerüstet ist, bleibt in Militärkreisen eine offene und beunruhigende Frage.
Die paradoxe Frage der 500 Milliarden Dollar
Dieser dräuende Konflikt findet vor dem Hintergrund eines internen budgetären Erdbebens statt. Verteidigungsminister Pete Hegseth hat im Weißen Haus eine schwindelerregende Aufstockung des Verteidigungsetats um 500 Milliarden Dollar durchgesetzt. Ein beispielloser Vorgang, der die Administration vor massive logistische und politische Probleme stellt. Der Widerstand im eigenen Lager ist beträchtlich. Der Direktor der Haushaltsbehörde, Russell Vought, warnt eindringlich vor den Folgen für das ohnehin ausufernde Staatsdefizit, das im vergangenen Jahr bereits 1,8 Billionen Dollar erreichte.
Die schiere Dimension dieser Summe überfordert selbst das Pentagon. Die Veröffentlichung des Haushaltsentwurfs verzögert sich, weil man schlichtweg nicht weiß, wie man zusätzliche 500 Milliarden Dollar derart kurzfristig sinnvoll allozieren soll. Es entspinnt sich ein Richtungsstreit. Sollen die Mittel in den massiven Nachschub verbrauchter Munition wie Tomahawk-Marschflugkörper und teure SM-6-Raketen sowie in traditionelle Großprojekte wie den 700 Millionen Dollar teuren B-21-Bomber und Columbia-Klasse-U-Boote für jeweils neun Milliarden Dollar fließen? Oder erfordert die Zukunft Investitionen in hochmoderne Technologien wie Künstliche Intelligenz?
Das eigentliche Paradoxon liegt jedoch im eklatanten Widerspruch zur hauseigenen Strategie. Erst im Januar verkündete Hegseths Team eine neue nationale Verteidigungsdoktrin, die den Fokus massiv auf die westliche Hemisphäre legt und das Engagement im Nahen Osten, Afrika und Europa zurückfahren soll. Militäranalysten wie der pensionierte Marine-Colonel Mark Cancian bezeichnen es als absurd, Budgets drastisch zu erhöhen, wenn man sich strategisch eigentlich aus diesen Regionen zurückziehen will. Sollten diese 500 Milliarden Dollar jährlich bewilligt werden, entspräche dies über ein Jahrzehnt hinweg fünf Billionen Dollar, Kosten, die jedes innenpolitische Projekt, wie etwa die Erweiterung von Medicare um zahnmedizinische Leistungen für 350 Milliarden Dollar, zwergenhaft erscheinen lassen. Experten warnen bereits vor einem gigantischen Schmiergeldfonds, in dem Milliarden unkontrolliert versickern könnten, da das Pentagon nach wie vor bei simplen Wirtschaftsprüfungen scheitert.
Das Schweigen der Kritiker und die mutierte Basis
Vielleicht das erstaunlichste Phänomen in diesem lautlosen Marsch in Richtung Krieg ist das völlige Verstummen jener politischen Basis, die ewige Kriege im Ausland einst am schärfsten verurteilte. Noch im vergangenen Juni, als der Präsident die ersten Luftschläge gegen den Iran erwog, schlugen prominente Köpfe der MAGA-Bewegung Alarm. Der einflussreiche und mittlerweile ermordete Aktivist Charlie Kirk saß im Oval Office und erklärte dem Präsidenten unmissverständlich, dass seine Basis überhaupt keinen Krieg wolle und sich aus Konflikten in fremden Ländern, die man nicht verstehe, heraushalten müsse. Auch Persönlichkeiten wie Steve Bannon und Tucker Carlson warnten öffentlich vor Tausenden toten Amerikanern und den unkalkulierbaren Risiken eines Regimewechsels.
Ein knappes Jahr später ist von diesem Widerstand wenig zu spüren. Der Ton in der MAGA-Sphäre ist gedämpft, fast resigniert. Die Gründe für diese psychologische Mutation der Basis sind vielschichtig. Zum einen glauben viele Anhänger nach den punktuellen und verlustfreien Operationen im Iran und in Venezuela blind an die Doktrin des Präsidenten, die angeblich auf präzisen Aktionen ohne Bodentruppen basiert. Man vertraut darauf, dass die Bombardements aus der Ferne den Gegner niederzwingen werden, solange kein amerikanisches Soldatenblut vergossen wird.
Zum anderen grassiert hinter den Kulissen die pure Angst vor politischer Exkommunikation. Die Meinungsmacher haben aus dem Schicksal von Kritikern wie Marjorie Taylor Greene und Tucker Carlson gelernt, denen der Präsident schlichtweg nicht mehr zuhört. Tucker Carlson wurde für seine falschen, apokalyptischen Prognosen verspottet, woraufhin sich selbst Bannon anpasste und auf seinem Kanal nun lediglich Szenarien diskutiert, anstatt fundamentale Kritik zu üben. Man ergibt sich der Tatsache, dass der Präsident letztlich ohnehin tut, was er will. Es ist eine fatale Kombination aus unbedingtem Gehorsam und der Illusion, man könne die komplexe Tektonik des Nahen Ostens mit chirurgischen Schlägen aus der Luft steuern.
In der diplomatischen Falle unter Obamas Schatten
Während das Militär auf den Befehl wartet, versuchen Unterhändler in Genf in letzter Minute das Schlimmste zu verhindern. Doch der Präsident hat sich in eine diplomatische Falle manövriert, die er selbst aufgestellt hat. Getrieben von seinem tiefen Verlangen, die außenpolitischen Errungenschaften seines Vorgängers Barack Obama auszulöschen, zerriss er 2018 das bestehende Atomabkommen und nannte es den schlechtesten Deal aller Zeiten. Nun lastet ein enormer Druck auf ihm. Er muss in den indirekten Verhandlungen ein Abkommen erzwingen, das weit über den Kompromiss von 2015 hinausgeht.
Die Forderungen der US-Verhandlungsführer Steve Witkoff und Jared Kushner sind absolut. Der Iran müsse jegliche Fähigkeit zur Urananreicherung dauerhaft aufgeben. Für Teheran, das sich auf sein Recht zur zivilen Nutzung nach dem Atomwaffensperrvertrag beruft, ist dies inakzeptabel. Man bietet lediglich eine Aussetzung der Produktion für ein Jahrzehnt an. Auch tiefgreifende Inspektionen durch die Internationale Atomenergiebehörde bleiben ein massiver Streitpunkt. Die Zeit für einen diplomatischen Mittelweg rinnt unaufhaltsam durch das Sandglas.
Sollten die Verhandlungen scheitern, drängen Stimmen auf einen totalen Regimewechsel. Doch selbst treue Weggefährten wie Außenminister Marco Rubio räumen ein, dass ein solcher Eingriff unvergleichlich komplexer und gefährlicher wäre als die Operation in Venezuela. Der ehemalige CIA-Direktor John O. Brennan warnt eindringlich davor, dass die Idee, das Problem Iran durch die Enthauptung des Regimes zu lösen, schlichtweg absurde Argumentation sei.
Es scheint, als sei der amerikanische Präsident den Verlockungen kurzfristiger, asymmetrischer Erfolge erlegen. Experten für Außenpolitik vergleichen seine Psychologie mit der eines Spielers am Roulettetisch, der nach einem spektakulären, verlustfreien Gewinn wie der Verhaftung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro im Rausch der Unbesiegbarkeit glaubt, seine Glückssträhne würde niemals enden. Doch ein groß angelegter Krieg gegen den Iran unterscheidet sich fundamental von allem, was in letzter Zeit militärisch unternommen wurde. Wer auf einen raschen Regimewechsel in Teheran spekuliert, ignoriert den langen, unkalkulierbaren Zeithorizont eines solchen Unterfangens. Am Ende dieses blinden Fluges droht den Vereinigten Staaten genau das, was ihre wählerstärkste Basis eigentlich am tiefsten verabscheut, ein weiterer, offener und zermürbender Krieg im Nahen Osten, aus dem es kein einfaches Entkommen gibt.