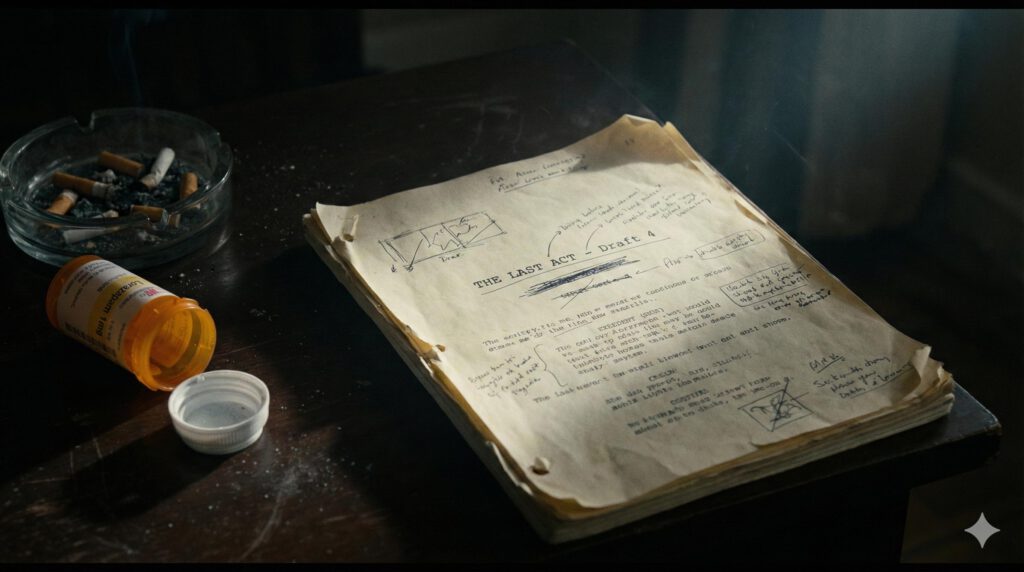Ein Gespenst geht um in Europa – und es hat zwei Gesichter. Das eine gehört Wladimir Putin, dessen revanchistisches Russland den Kontinent in einen Zustand permanenter Furcht versetzt hat. Das andere, nicht minder beunruhigende, gehört Donald Trump. Der amerikanische Präsident, dessen Haltung zur transatlantischen Allianz zwischen Verachtung und Desinteresse schwankt, zwingt Europa vor dem NATO-Gipfel in Den Haag in eine beispiellose Aufrüstungsspirale. Das neue Mantra, das wie ein Befehl aus Washington über den Atlantik hallt, lautet: Fünf Prozent. Fünf Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung sollen die Alliierten für ihre Sicherheit aufwenden.
Was auf den ersten Blick wie ein klares Bekenntnis zur gemeinsamen Verteidigung wirkt, entpuppt sich bei genauerer Analyse als das exakte Gegenteil: Es ist das Dokument eines tiefen Misstrauens, der Katalysator für eine fundamentale und schmerzhafte Neuordnung der NATO und der Beginn einer Ära, in der Europa gezwungen wird, für eine Sicherheit zu bezahlen, deren amerikanischer Garant noch nie so unzuverlässig erschien. Der Gipfel in Den Haag ist keine routinierte Krisensitzung. Er ist eine Zäsur. Er markiert den Moment, in dem Europas Verteidigungspolitik nicht mehr von strategischer Weitsicht, sondern von der nackten Angst vor dem russischen Feind und dem unberechenbaren amerikanischen Freund diktiert wird. Die erzielte Einigung ist ein fragiles Konstrukt, ein Kompromiss, der mit semantischen Tricks, kreativer Buchführung und flexiblen Fristen zusammengehalten wird und doch die tiefen Risse im Bündnis nicht zu kitten vermag. Europa erwacht in einer neuen, härteren Realität – und der Preis dafür ist astronomisch.
Eine Zahl, die Gehorsam fordert: Das 5-Prozent-Ziel als politisches Machtinstrument
Die Zahl fünf ist keine, die aus den strategischen Schubladen der NATO-Militärs stammt. Sie ist keine rationale Ableitung aus den neuen, umfassenden Verteidigungsplänen der Allianz. Sie ist eine politische Zahl, geboren aus Donald Trumps simpler Forderung, die Europäer sollten gefälligst so viel für ihre Sicherheit ausgeben wie die USA. Deren Ausgaben liegen bei 3,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – und genau an diesem Wert orientiert sich der Kern der neuen europäischen Verpflichtung von 3,5 Prozent für reine Militärausgaben. Fachleute im Bündnis halten diese Zahl ohnehin für willkürlich und schätzen den tatsächlichen Bedarf eher auf vier Prozent.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Um die politisch motivierte Fünf-Prozent-Marke zu erreichen, wurde ein buchhalterischer Kniff angewendet: Weitere 1,5 Prozent des BIP sollen für „verteidigungsrelevante“ Investitionen ausgegeben werden können. Was darunter fällt, ist bewusst vage gehalten und öffnet der kreativen Anrechnung Tür und Tor: der Ausbau von Infrastruktur wie Brücken und Häfen, Cyberabwehr, Küstenschutz oder die Stärkung der zivilen Resilienz. Italien brachte sogar den Bau einer Brücke nach Sizilien ins Spiel. Ein Analyst nannte diese Aufweichung treffend ein „Taschenspielertrick“ und einen „PR-Schachzug für Trump“. Es geht weniger um den gezielten Aufbau von militärischer Schlagkraft als um das Erreichen einer symbolischen Zahl, die den Präsidenten in Washington besänftigen soll. Trump selbst unterstrich den transaktionalen Charakter der Forderung, indem er erklärte, das Ziel gelte für die Europäer, aber nicht für die USA. Die Botschaft ist klar: Dies ist keine gemeinsame Anstrengung, sondern eine Rechnung, die Europa zu begleichen hat.
Die zerrissene Allianz: Osteuropas Furcht gegen Westeuropas Zaudern
Die Debatte um die neue Ausgabenquote legt die tiefen Bruchlinien innerhalb des Bündnisses schonungslos offen. Es existiert ein erhebliches Ost-West-Gefälle, das sich direkt aus der unterschiedlichen geografischen Nähe zu Russland und der daraus resultierenden Bedrohungswahrnehmung speist. An der Ostflanke, wo die Gefahr am greifbarsten ist, herrscht eine gänzlich andere Dringlichkeit. Polen, das bereits jetzt mit 4,7 Prozent seiner Wirtschaftsleistung vorangeht, hat Milliarden in neue Waffensysteme von Drohnen bis zu Kampfjets investiert. Litauen strebt sogar bis zu sechs Prozent an, und auch die anderen baltischen Staaten planen, die Fünf-Prozent-Marke schnell zu erreichen oder zu übertreffen. Für diese Länder, die über solide Staatsfinanzen verfügen, ist massive Aufrüstung keine Frage der Priorität, sondern der Existenz.
Ganz anders stellt sich die Lage im Westen und Süden des Kontinents dar. In Ländern mit hoher Staatsverschuldung und einer Bevölkerung, die den Fokus auf den Sozialstaat legt, trifft die Forderung auf erheblichen Widerstand. In Belgien, mit einer Verschuldung von 105 Prozent, bezeichnete der Vorsitzende der wallonischen Liberalen die fünf Prozent als Ausdruck „kollektiver Hysterie“. In Frankreich unterstützt Präsident Macron zwar die Aufrüstung, hat aber bisher keine Antwort auf die Frage geliefert, wie diese angesichts einer Schuldenquote von 113 Prozent und ohne parlamentarische Mehrheit finanziert werden soll.
Am deutlichsten wurde der Widerstand aus Spanien. Ministerpräsident Pedro Sánchez bezeichnete das Ziel in einem Brief an NATO-Generalsekretär Mark Rutte als „unangemessen“ und „kontraproduktiv“. Es sei „unvereinbar mit unserem Sozialstaat und unserer Weltanschauung“. Sánchez, dessen Regierung auf die Unterstützung kleinerer Parteien angewiesen ist, kämpft an allen Fronten und kann sich eine unpopuläre Kürzung von Sozialleistungen kaum leisten. Dieser fundamentale Konflikt zwischen Sicherheitsnotwendigkeit und innenpolitischen Realitäten prägt die Debatte und zwingt die Allianz zu Kompromissen, die die Schlagkraft der Vereinbarung untergraben.
Zeitenwende 2.0: Wie Trumps Schockwellen Deutschlands Dogmen brechen
Nirgendwo wird der seismische Schock, den Trumps Präsidentschaft in Europa ausgelöst hat, deutlicher als in Deutschland. Die größte Volkswirtschaft des Kontinents, über Jahre hinweg an die Doktrin der „Schwarzen Null“ und eine zurückhaltende Außenpolitik gekettet, erlebt eine politische Kehrtwende von historischem Ausmaß. Die zentrale Figur in diesem Drama ist der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz, der als überzeugter „Schuldenfalke“ in den Wahlkampf gezogen war.
Sein Umdenken wurde durch eine Serie von Schockmomenten ausgelöst, die ihm die Unzuverlässigkeit des amerikanischen Partners drastisch vor Augen führten. Es begann mit dem Auftritt von US-Vizepräsident JD Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, der nicht nur zur Inklusion rechter Populisten aufrief, sondern sich, wie Merz später erfuhr, heimlich mit der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel getroffen hatte. Der endgültige Auslöser war jedoch ein Ereignis im Oval Office: Merz sah auf seinem iPad, wie Präsident Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor laufenden Kameras wie einen Schuljungen demütigte und beschimpfte.
Für Merz war dies der Moment, in dem seine Welt zusammenbrach. Er erkannte, dass die USA drohten, nicht nur die Ukraine, sondern alle ihre Verbündeten im Stich zu lassen. In geheimen Gesprächen mit seinem Vorgänger Olaf Scholz, der ihm Geheimdiensterkenntnisse über das immense Ausmaß der russischen Aufrüstung präsentierte, reifte die Überzeugung: Deutschland muss seine Verteidigung neu aufbauen, „so schnell wie möglich und um jeden Preis“. Angetrieben von der Information einer vertrauenswürdigen amerikanischen Quelle, Trump könnte in Kürze den Austritt der USA aus der NATO verkünden, orchestrierte Merz eine beispiellose politische Volte. Er stimmte einem Billionen-Euro-Sondervermögen für die Verteidigung zu und brach damit das Dogma der Schuldenbremse, das er selbst über Jahre verteidigt hatte. Diese radikale Wende zeigt, wie tief die amerikanische Unberechenbarkeit die Grundfesten der deutschen Politik erschüttert hat und welche zentrale Rolle Deutschland künftig beim Schließen der durch einen möglichen US-Rückzug entstehenden Lücken spielen muss.
Einigung um jeden Preis: Die flexiblen Klauseln des Haager Gipfels
Angesichts des erheblichen Widerstands aus Ländern wie Spanien war klar, dass eine starre Verpflichtung auf das Fünf-Prozent-Ziel den Gipfel zum Scheitern verurteilt hätte. Die resultierende Einigung ist daher ein Meisterstück der diplomatischen Flexibilität – oder, kritisch betrachtet, der strategischen Aushöhlung. Um alle Mitgliedstaaten an Bord zu holen, wurden eine Reihe von aufweichenden Klauseln in die Abschlusserklärung eingearbeitet.
Die ursprünglich von NATO-Generalsekretär Rutte vorgeschlagene Frist von sieben Jahren zur Erreichung des Ziels wurde auf zehn Jahre, also bis 2035, verlängert. Zudem wird kein stetiger, linearer Anstieg der Ausgaben mehr gefordert; stattdessen soll jedes Land seinen eigenen Weg dorthin in nationalen Plänen festlegen dürfen, die jährlich überprüft werden. Dies gibt Regierungen erheblichen Spielraum, unliebsame Ausgabensteigerungen in die fernere Zukunft zu verschieben.
Ein weiterer entscheidender Punkt ist eine geplante Überprüfung des Ausgabenziels im Jahr 2029. Dies bietet eine offizielle Ausstiegsklausel, sollte sich die Bedrohungslage durch Russland bis dahin vermeintlich entspannt haben – eine Hoffnung, die von den meisten Fachleuten allerdings als unrealistisch eingeschätzt wird. Der vielleicht raffinierteste Kompromiss wurde für Spanien gefunden. Um Ministerpräsident Sánchez einen gesichtswahrenden Ausweg zu bieten, wurde die Formulierung im Abschlusstext geändert: Statt von „allen Verbündeten“ ist nun nur noch allgemeiner von „den Verbündeten“ die Rede, die das Ziel anstreben. Dieser semantische Trick erlaubte es Spanien, dem Kompromiss zuzustimmen, ohne sich formal auf eine Prozentzahl festzulegen, die es innenpolitisch nicht durchsetzen kann. All diese Flexibilisierungen erkaufen die Einheit auf dem Papier mit der Gefahr, dass die Umsetzung in der Realität uneinheitlich und unzureichend bleibt.
Geld ist nicht alles: Europas Rüstungsindustrie am Limit
Selbst wenn die europäischen Nationen den politischen Willen aufbringen und die astronomischen Summen in ihren Haushalten freischaufeln, steht die nächste, vielleicht noch größere Hürde bevor: die Umsetzung. Die europäischen Friedensökonomien müssen sich in Rekordzeit auf eine massive Produktionssteigerung umstellen, doch die Realität ist von Engpässen und Ineffizienz geprägt. Die Verteidigungsindustrie kann die plötzliche Geldschwemme kaum absorbieren, was befürchten lässt, dass vor allem die Preise steigen, nicht aber die Anzahl der verfügbaren Waffensysteme.
Die Probleme sind struktureller Natur. Ein Mangel an Koordination und ein Wust aus Bürokratie führen zu Verzögerungen und Verschwendung. Es fehlt an Standardisierung: So gibt es vom gleichen Hubschraubertyp NH90, der von zwölf europäischen Nationen genutzt wird, sage und schreibe 17 verschiedene Versionen. Eine in Deutschland gefertigte Komponente für ein französisches Flugzeug benötigt eine separate Exportlizenz, was die Lieferung um Monate verzögern kann.
Hinzu kommen handfeste Ressourcenkonflikte. So konnte der norwegische Munitionshersteller Nammo seine für die Ukraine so wichtige Produktion nicht hochfahren, weil ein nahegelegenes TikTok-Rechenzentrum bereits den gesamten überschüssigen Strom der Region aufgekauft hatte. Die Industrie beklagt sich über die Langsamkeit der politischen Mühlen und fordert klare, langfristige Aufträge, um Investitionen in neue Produktionskapazitäten zu rechtfertigen. Der Aufbau neuer Fabriken wird durch langwierige Genehmigungsverfahren, die bis zu fünf Jahre dauern können, zusätzlich erschwert. All dies zeigt: Geld allein schießt keine Granaten. Ohne eine tiefgreifende Reform der Beschaffungs- und Produktionsprozesse droht die europäische Aufrüstung zu einer der teuersten, aber ineffektivsten der Geschichte zu werden.
Abschied von der Schutzmacht: Europas ungewisse Selbstständigkeit
Das Diktat aus Washington erzwingt eine Neudefinition der transatlantischen Beziehungen, die weit über finanzielle Fragen hinausgeht. Die USA haben klargemacht, dass sie ihren strategischen Fokus künftig auf die Bedrohung durch China legen werden. Die Europäer müssen folglich die Hauptverantwortung für die konventionelle Sicherheit auf ihrem eigenen Kontinent übernehmen. Dies impliziert einen teilweisen Rückzug Amerikas. Es wird fest damit gerechnet, dass Trump die 20.000 Soldaten, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Europa verlegt wurden, wieder abziehen wird. NATO-Diplomaten halten es bereits für einen Erfolg, wenn die Hälfte der derzeit 100.000 US-Soldaten auf dem Kontinent verbleiben würde.
Dieser Wandel zwingt Europa zur Selbstständigkeit, doch die Abhängigkeit bleibt in entscheidenden Bereichen bestehen. Ein NATO-Diplomat listet auf, was unverzichtbar ist: der nukleare Schutzschirm der USA, die Air Force in Ramstein, die Raketenabwehrsysteme in Polen und Rumänien sowie die Sechste Flotte im Mittelmeer. Washington hat zwar intern zugesichert, den Abbau eigener Fähigkeiten mit dem Aufbau europäischer Kapazitäten zu synchronisieren, doch von Trump selbst gibt es dazu keine öffentliche Bestätigung. Diese Unsicherheit zwingt Europa in einen Spagat: Es muss eine eigenständige Verteidigungsfähigkeit aufbauen, die die amerikanischen Lücken füllt, kann aber auf die strategischen Kernkompetenzen der USA auf absehbare Zeit nicht verzichten. Die Ära der bedingungslosen Sicherheitsgarantie ist vorbei; an ihre Stelle tritt ein transaktionales Verhältnis, dessen Bedingungen jederzeit neu verhandelt werden können.
Opfer auf dem Altar des Appeasements: Die Ukraine wird zur Nebensache
Die dramatischste und für viele moralisch fragwürdigste Konsequenz dieser Neuordnung der NATO unter Trump ist die Marginalisierung der Ukraine. Während auf früheren Gipfeln nach der Invasion Präsident Selenskyj ein Ehrenplatz eingeräumt und der Ukraine ein „unumkehrbarer Weg“ in die NATO versprochen wurde, wird das Thema in Den Haag bewusst kleingehalten. In der geplanten, nur wenige Absätze umfassenden Abschlusserklärung soll die NATO-Perspektive für Kiew kein einziges Wort mehr Erwähnung finden.
Der Grund für diese 180-Grad-Wende ist der Wunsch der Trump-Administration, sich für mögliche Friedensverhandlungen mit Wladimir Putin „Handlungsspielraum“ zu bewahren. Eine zu starke Anbindung der Ukraine an die NATO wird als Hindernis für einen von Trump angestrebten Deal gesehen. Die Konsequenzen für Kiew sind verheerend: Selenskyj wird auf eine Nebenrolle reduziert. Der NATO-Ukraine-Rat findet nur noch auf Außenministerebene statt. Noch schlimmer ist die wachsende Unsicherheit bei der Militärhilfe. Seit Trumps Amtsantritt wurden keine neuen US-Hilfspakete genehmigt, und es gab bereits einen kurzzeitigen Stopp von Waffenlieferungen und Geheimdienstinformationen. Die Europäer stehen damit vor der doppelten Herausforderung, nicht nur ihre eigene Verteidigung zu finanzieren, sondern auch die wachsende Last der Ukraine-Unterstützung zu schultern, während ihr mächtigster Verbündeter auf Distanz geht. Die Ukraine wird so zum Kollateralschaden des Versuchs, einen unberechenbaren US-Präsidenten bei Laune zu halten.
Der wahre Feind im Osten: Putins Russland als unumgängliche Triebfeder
Trotz der dominanten Rolle Donald Trumps darf nicht vergessen werden, was die europäische Aufrüstung im Kern antreibt: die reale und wachsende Bedrohung durch Wladimir Putins Russland. Während Trump die Debatte auf eine Frage der Lastenteilung reduziert, ist für die Europäer klar, dass der russische Imperialismus eine existenzielle Gefahr darstellt. Geheimdienstberichte, die auch der deutschen Regierung vorliegen, zeichnen ein düsteres Bild: Russland rüstet trotz der enormen Verluste in der Ukraine massiv auf und könnte in nur wenigen Jahren über mehr Panzer und Raketen verfügen als vor dem Krieg. Militärplaner der NATO gehen davon aus, dass Russland innerhalb von fünf bis zehn Jahren fähig sein könnte, einen Angriff auf ein Bündnismitglied zu wagen.
Diese Einschätzung ist die eigentliche Legitimation für die gigantischen Verteidigungsausgaben, die den europäischen Gesellschaften abverlangt werden. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass der Satz, der Russland als „unmittelbarste und gefährlichste Bedrohung“ bezeichnet, den Europäern von den Amerikanern erst abgerungen werden musste, um ihn in das kurze Gipfel-Kommuniqué aufzunehmen. Für viele europäische Staaten, insbesondere an der Ostflanke, ist die Aufrüstung keine Option, sondern eine Notwendigkeit, um sich auf einen permanenten Zustand der Konfrontation mit einem revanchistischen Russland vorzubereiten, das den Westen als seinen ewigen Feind betrachtet. Die Angst vor Putin ist der Kitt, der das Bündnis trotz der von Trump verursachten Zentrifugalkräfte noch zusammenhält.
Am Ende des Gipfels von Den Haag wird eine Einigung stehen, die als Erfolg verkauft werden wird. Doch hinter der Fassade der Einheit verbirgt sich eine Allianz in ihrer tiefsten Krise seit dem Kalten Krieg. Europa wird gezwungen, einen historisch hohen Preis für seine Sicherheit zu zahlen, aber es kauft sich damit keine verlässliche Garantie, sondern lediglich Zeit. Zeit, um zu versuchen, eine eigene Verteidigungsfähigkeit aufzubauen, während es gleichzeitig von einem unzuverlässigen Verbündeten abhängig bleibt, der die Regeln des Spiels jederzeit ändern kann. Die große Frage, die nach Den Haag unbeantwortet im Raum stehen wird, ist, ob der Kontinent die politische Kraft und die wirtschaftliche Resilienz aufbringen kann, um diese Zerreißprobe zu bestehen. Der Weckruf ist erfolgt, doch der Weg zu echter strategischer Autonomie ist lang, steinig und mit Opfern gepflastert, auf die die europäischen Gesellschaften noch nicht vorbereitet sind.