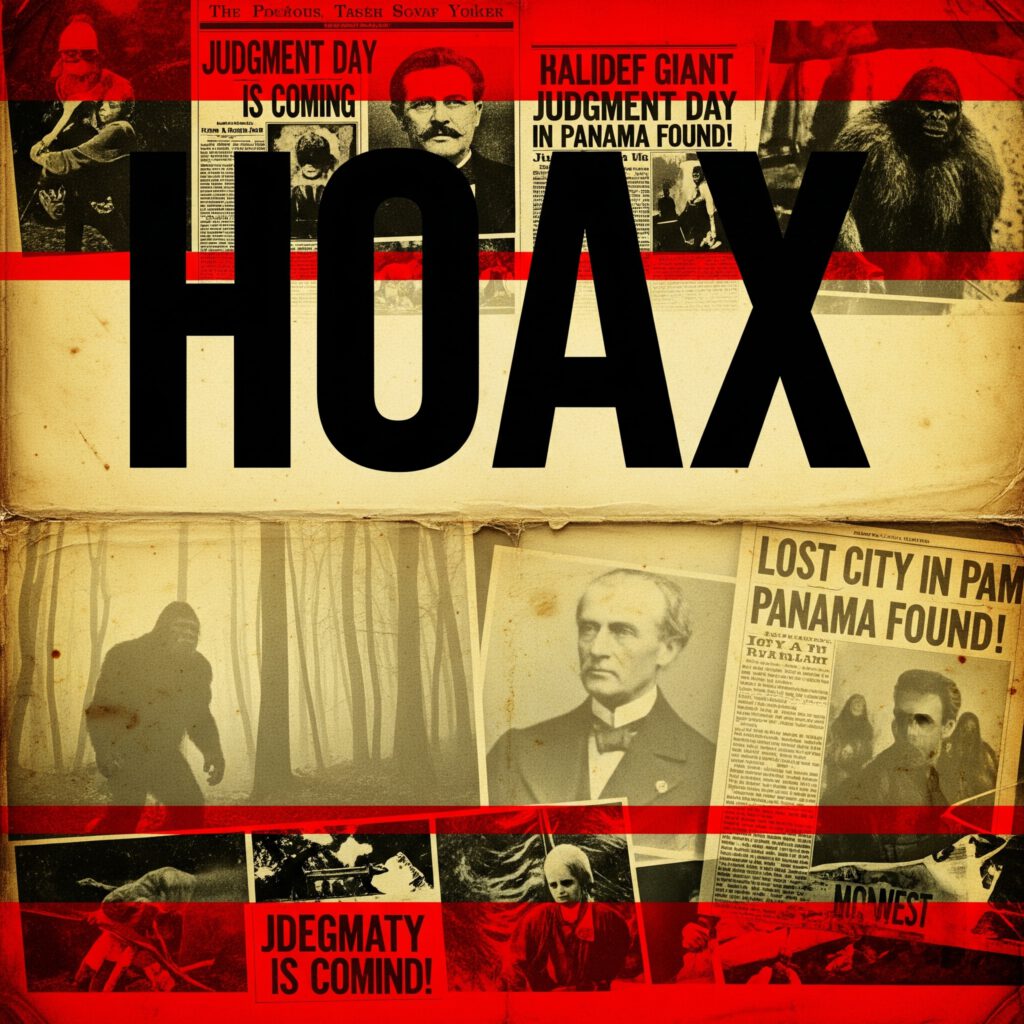Die Demokratische Partei der USA durchlebt eine Phase tiefgreifender Verunsicherung und strategischer Neuorientierung. Nach spürbaren elektoralen Rückschlägen und angesichts rumorender interner Debatten gleicht die Partei einem Schiff in schwerer See, das verzweifelt nach einem navigierbaren Kurs sucht. Im Zentrum dieser Selbstfindung stehen die schmerzhafte Bewertung wirtschaftspolitischer Experimente wie „Bidenomics“, die ungelösten Herausforderungen durch ein alterndes Führungspersonal und ein sich abzeichnender Generationenwechsel sowie die alarmierende Entfremdung von einstigen Kernwählergruppen, insbesondere Männern und der traditionellen Arbeiterklasse. Die Analyse der Ursachen ist vielschichtig, die Lösungsansätze sind umstritten, und die Gefahr einer Zersplitterung in einem hyperpolarisierten politischen Umfeld ist real.
Bidenomics im Kreuzfeuer: Wirtschaftspolitisches Erbe oder elektoraler Ballast?
Der wirtschaftspolitische Ansatz, der unter dem Schlagwort „Bidenomics“ firmierte, markierte einen deutlichen Bruch mit dem jahrzehntelang dominierenden „Neoliberalismus“. An die Stelle einer übermäßigen Rücksichtnahme auf freie Märkte sollte eine aktivere Rolle des Staates treten, insbesondere durch großangelegte öffentliche Investitionen und eine gezielte Industriepolitik. Das Ziel war ambitioniert: die Wiederbelebung der heimischen Produktion, die Schaffung gut bezahlter Arbeitsplätze, die Bekämpfung des Klimawandels und nicht zuletzt die Rückgewinnung der von den Demokraten entfremdeten Arbeiterschicht.
Tatsächlich konnten auf dem Papier beachtliche Erfolge verbucht werden. Private Investitionen in Schlüsselsektoren wie Computer- und Elektronikfertigung sowie in saubere Energietechnologien schnellten in die Höhe. Die Gesetzespakete – der Inflation Reduction Act (IRA), der CHIPS and Science Act und das Infrastructure Investment and Jobs Act – schienen ihre Wirkung zu entfalten, indem sie Kapital mobilisierten und insbesondere in Regionen mit unterdurchschnittlichem Medianeinkommen investierten. Die Befürworter sahen darin den Beweis, dass eine „Post-Neoliberale“ Agenda nicht nur nationale Ziele erreichen, sondern auch politische Dividenden abwerfen könnte.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Doch die Realität gestaltete sich komplexer und ernüchternder. Der versprochene Boom an Industriearbeitsplätzen blieb zunächst aus; stattdessen setzte sich der langfristige Rückgang der Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe fort. Viele der angekündigten Großprojekte, von Ladestationen für Elektroautos bis zum Breitbandausbau in ländlichen Gebieten, verzögerten sich erheblich oder kamen über das Planungsstadium kaum hinaus. Die „Politik der Ergebnisse“ („politics of delivery“), auf die die Biden-Administration setzte, entfaltete ihre Wirkung zu langsam, um vor dem nächsten Wahltermin spürbar zu werden. Selbst einstige Architekten dieser Politik räumten ein, dass man die bürokratischen Hürden und die Komplexität großer Infrastrukturprojekte unterschätzt habe.
Gravierender noch wog der Vorwurf, Bidens Wirtschaftspolitik, insbesondere das massive Konjunkturpaket des American Rescue Plan (ARP), habe die Inflation angeheizt und damit die Lebenshaltungskostenkrise für viele Amerikaner verschärft. Kritiker wie Jason Furman, ehemaliger Vorsitzender des Council of Economic Advisers unter Barack Obama, sprachen von einer „post-neoliberalen Illusion“ und warnten davor, ökonomische Grundprinzipien zugunsten „phantasievoller heterodoxer Lösungen“ zu ignorieren. Die Folge sei ein Backlash gewesen, der Donald Trump zurück ins Weiße Haus getragen habe. Verteidiger von Bidenomics konterten, die Inflation sei ein globales Phänomen gewesen, primär verursacht durch die Corona-Pandemie und nicht durch nationale Konjunkturprogramme. Die Debatte über den tatsächlichen Beitrag des ARP zur Inflation – Schätzungen reichten von 0,5 bis zu 3 Prozentpunkten – überlagerte jedoch die Frage, ob das Programm überhaupt genuin „post-neoliberal“ motiviert war oder schlicht ein Ergebnis risikomanagementorientierter Krisenbekämpfung darstellte. Die politische Beständigkeit von Maßnahmen wie dem IRA, der gezielt auch republikanisch dominierte Kongressdistrikte begünstigte, wurde zwar als potenzieller Erfolg verbucht. Doch die erhoffte Rückeroberung der Arbeiterschicht blieb aus; im Gegenteil, diese Wählergruppe wandte sich 2024 noch stärker von den Demokraten ab als acht Jahre zuvor.
Die Schatten der Vergangenheit: Bidens Alter und die Führungskrise
Die wirtschaftspolitische Debatte wurde überlagert und verschärft durch eine weitere, tiefgreifende Krise: die Frage nach der Amtsfähigkeit und dem Alter von Präsident Joe Biden. Berichte über einen spürbaren kognitiven und physischen Abbau verdichteten sich, insbesondere im Jahr 2023. Beobachtungen von demokratischen Abgeordneten und Mitarbeitern, wie die des Illinois-Parlamentariers Mike Quigley während einer Irlandreise Bidens, zeichneten das Bild eines Präsidenten, der hinter den Kulissen oft erschöpft, kraftlos und nicht immer präsent wirkte. Quigleys persönliche Erfahrungen mit seinem an Parkinson verstorbenen Vater ließen ihn Parallelen im Verhalten des Präsidenten erkennen. Auch andere, wie der New Yorker Kongressabgeordnete Brian Higgins, dessen Vater an Alzheimer litt, bemerkten beunruhigende Anzeichen.
Diese Beobachtungen, die von den Betroffenen in Trauer und nach bestem Wissen und Gewissen geteilt wurden, nährten parteiintern die Sorge, der Präsident sei der Herausforderung einer weiteren Amtszeit und eines harten Wahlkampfes nicht gewachsen. Doch die Furcht, durch öffentliche Äußerungen dem Präsidenten zu schaden oder als illoyal gebrandmarkt zu werden, führte zu einer Art Schweigespirale. Die Parteiführung und das Weiße Haus schienen Bedenken aktiv zu unterdrücken oder als parteiische Manöver abzutun. Selbst als der Sonderermittler Robert Hur in seinem Bericht Bidens Gedächtnisprobleme thematisierte, reagierte das demokratische Establishment mit scharfer Zurückweisung.
Die Entscheidung Bidens, erneut anzutreten, wurde von vielen Demokraten im Nachhinein als „Erbsünde“ („original sin“) betrachtet. Sie habe nicht nur die Wahlchancen der Partei massiv geschmälert, sondern auch das Vertrauen in die Urteilskraft der Führung untergraben. Die desaströse Debattenperformance Bidens im Juni 2024 war für Eingeweihte wie Quigley keine Überraschung mehr, sondern die öffentliche Bestätigung längst gehegter Befürchtungen. Die Episode legte schonungslos die Risiken einer alternden Führung offen und befeuerte die bereits schwelende Debatte über einen notwendigen Generationenwechsel.
Verlorene Söhne: Warum die Demokraten Männer und die Arbeiterklasse nicht mehr erreichen
Parallel zu den Führungs- und Wirtschaftspolitikdebatten ringt die Demokratische Partei mit einem weiteren existentiellen Problem: dem dramatischen Schwund an Unterstützung bei männlichen Wählern, insbesondere bei jungen Männern. Donald Trump konnte diese Gruppe mit einem Vorsprung von rund 12 Prozentpunkten für sich gewinnen, darunter 57 Prozent der Männer unter 30. Diese Entwicklung hat parteiintern zwei Denkrichtungen für Gegenstrategien hervorgebracht. Die eine setzt auf eine verbesserte kulturelle Ansprache, die Männlichkeit eher umarmt als kritisiert und positive, heroische Leitbilder anbietet, ohne dabei in plumpe Anbiederung zu verfallen. Vertreter dieser Linie, wie Senator Chris Murphy, beklagen eine „Wortpolizei“ auf der linken Seite, die eine offene Diskussion über Geschlechterunterschiede und männliche Bedürfnisse erschwere. Es gehe darum, traditionelle Wege, auf denen Männer Wert und Bedeutung fänden – etwa durch das Übernehmen von Verantwortung, Risikobereitschaft oder Stolz auf körperliche Arbeit – nicht per se als illegitim abzutun.
Die andere Denkschule fokussiert stärker auf klassische ökonomische Botschaften, in der Annahme, dass Männer einer Agenda für das „Blue-Collar America“ folgen würden, wenn diese nur glaubwürdig genug wäre. Der Abgeordnete Jake Auchincloss plädiert für eine Wirtschaft, die wie „Legos, nicht Monopoly“ funktioniere, mit mehr technischen Berufsschulen und einer größeren Wertschätzung für handwerkliche Fähigkeiten, um jungen Männern Autonomie und das Gefühl, Versorger sein zu können, zu ermöglichen. Ruben Gallego, der erfolgreich im traditionell männlich geprägten Umfeld von Boxhallen und Rodeos Wahlkampf betrieb, argumentiert, dass es ein Fehler sei, die spezifischen Probleme von Männern – etwa geringere College-Abschlussraten – zu ignorieren, nur weil es sich um Männer handle.
Beide Ansätze bergen jedoch Fallstricke. Eine zu starke Betonung traditioneller Männlichkeitsbilder könnte weibliche Wählerinnen verprellen, eine entscheidende Stütze der demokratischen Koalition. Zudem wirkt die hypermaskuline Inszenierung der MAGA-Bewegung für viele Demokraten abschreckend und schwer zu kontern, ohne die eigenen Werte zu verraten. Die Fokussierung auf reine Wirtschaftsargumente wiederum übersieht oft, dass die Republikaner es geschafft haben, viele Männer über kulturelle Ressentiments und das Gefühl, abgehängt zu sein, zu erreichen. Die Demokratin Marie Gluesenkamp Perez, die selbst einen Autoreparaturbetrieb führt, betont die Notwendigkeit von Authentizität und einer Repräsentation, die die Lebensrealität der Arbeiterklasse widerspiegelt und nicht von oben herab agiert. Die Schwierigkeit, eine Sprache zu finden, die sowohl progressive soziale Anliegen als auch die Sorgen traditionellerer Wählergruppen adressiert, ohne als unglaubwürdig empfunden zu werden, bleibt eine Kernherausforderung. Das Problem der schwindenden Unterstützung der Arbeiterklasse beschränkt sich dabei längst nicht mehr nur auf weiße Wähler, sondern hat auch auf die lateinamerikanische und afroamerikanische Arbeiterschaft übergegriffen.
Generationenkonflikt und die Sehnsucht nach Erneuerung: Wer spricht für die Zukunft der Demokraten?
Die Führungskrise um Präsident Biden und die Entfremdung von Wählergruppen fallen zusammen mit einer wachsenden Ungeduld jüngerer Demokraten gegenüber der etablierten Garde. Eine Welle von Rücktrittsankündigungen älterer Senatorinnen und Senatoren wie Gary Peters (66) und Tina Smith (68) oder Jeanne Shaheen (78) und Dick Durbin (80) wurde von vielen in der Partei nicht mit dem üblichen Bedauern, sondern mit spürbarer Erleichterung und Dankbarkeit aufgenommen. Diese Reaktionen signalisieren eine tiefe Sehnsucht nach personeller Erneuerung und frischen Impulsen. Progressive Organisationen wie „Run for Something“, geleitet von Amanda Litman, fordern offen, dass alle demokratischen Kongressabgeordneten über 70 ihre jetzige Amtszeit zur letzten machen sollten. Die Logik dahinter: Alte und als „out-of-touch“ wahrgenommene Repräsentanten seien ein größeres Problem als die Parteibotschaft selbst und würden die Marke der Demokraten beschädigen. Der Fall der Senatorin Dianne Feinstein, die trotz sichtbaren Abbaus bis zu ihrem Tod im Amt blieb, dient hier als mahnendes Beispiel.
Auch Initiativen wie die von David Hogg, dem neu gewählten Vizevorsitzenden des Democratic National Committee, der 20 Millionen Dollar für Vorwahlherausforderer gegen „abgehobene, ineffektive“ Demokraten mobilisieren will, zeugen vom wachsenden Druck. Auch wenn Hogg betont, es gehe nicht primär ums Alter, sondern um mangelnde Tatkraft und Bürgernähe, zielt die Strategie doch darauf ab, ältere Amtsinhaber zum Rückzug zu bewegen. Die Hoffnung ist, durch neue Gesichter auch die öffentliche Wahrnehmung der Partei zu verändern. Dieser Drang nach Erneuerung stößt jedoch auf die traditionell stark im Senioritätsprinzip verankerten Machtstrukturen der Demokraten. Insbesondere für nicht-weiße Demokraten war lange Dienstzeit oft der einzige Weg zu Einfluss, was zu einer Verteidigung des Systems durch etablierte Kräfte wie Mitglieder des Congressional Black Caucus führt. Aussagen wie die von James Clyburn, der die Frage nach seinem Rücktritt mit der Gegenfrage konterte, ob man von ihm erwarte, sein Leben aufzugeben, illustrieren den Widerstand. Die Enttäuschung jüngerer, ambitionierter Politiker wie Alexandria Ocasio-Cortez, die angesichts der unveränderten Machtverhältnisse im Caucus auf eine erneute Kandidatur für einen wichtigen Ausschussvorsitz verzichtete, verdeutlicht das Ausmaß des internen Generationenkonflikts.
Zwischen Problem-Analyse und Lähmung: Die schwierige Suche nach einer kohärenten Strategie
Die Demokratische Partei leidet nicht an einem Mangel an Problem-Diagnosen – im Gegenteil. Von einem „Vertrauensproblem“ über ein „Narrativproblem“ und ein „Visionsproblem“ bis hin zu spezifischen Defiziten bei bestimmten Wählergruppen wie der Arbeiterklasse, Gen Z, Männern oder Frauen – die Liste der selbst und fremd attestierten Schwachstellen ist lang und erdrückend. Diese ständige Nabelschau, die typisch ist für Parteien nach Wahlniederlagen, birgt die Gefahr, in Selbstzerfleischung und Lähmung zu münden. Sie kann das Vertrauen der eigenen Wähler weiter untergraben und das Image einer Partei festigen, die mehr mit sich selbst als mit den Problemen des Landes beschäftigt ist.
Die Suche nach einer kohärenten nationalen Strategie wird zusätzlich erschwert durch das extrem polarisierte politische Klima, in dem die Republikaner mit aggressiven legislativen Taktiken agieren und dabei oft früheres Verhalten der Demokraten als Rechtfertigung anführen. Dies schafft ein Umfeld, in dem Kompromisse kaum möglich sind und die eigene Agenda nur schwer durchzusetzen ist. Die zahlreichen internen Verwerfungen und die Schwierigkeit, eine authentische Stimme zu finden, die über verschiedene Wählerdemografien hinweg Resonanz erzeugt, sind Haupthindernisse auf dem Weg zu einer erneuerten demokratischen Erzählung. Manch einer mag hoffen, dass, wie in der Vergangenheit, gute neue Kandidaten und ein günstiger Wahlzyklus viele der aktuellen Probleme lösen könnten. Doch die Tiefe der aktuellen Krise legt nahe, dass kosmetische Korrekturen nicht ausreichen werden. Die Demokraten stehen vor der fundamentalen Aufgabe, ihre Identität neu zu definieren, ihre Botschaft zu schärfen und eine glaubwürdige Verbindung zur amerikanischen Bevölkerung wiederherzustellen, wenn sie nicht riskieren wollen, zu einer permanenten Minderheit zu werden – eine Befürchtung, die zwar oft geäußert wird, aber angesichts der aktuellen Bruchlinien bedrohlich real erscheint.