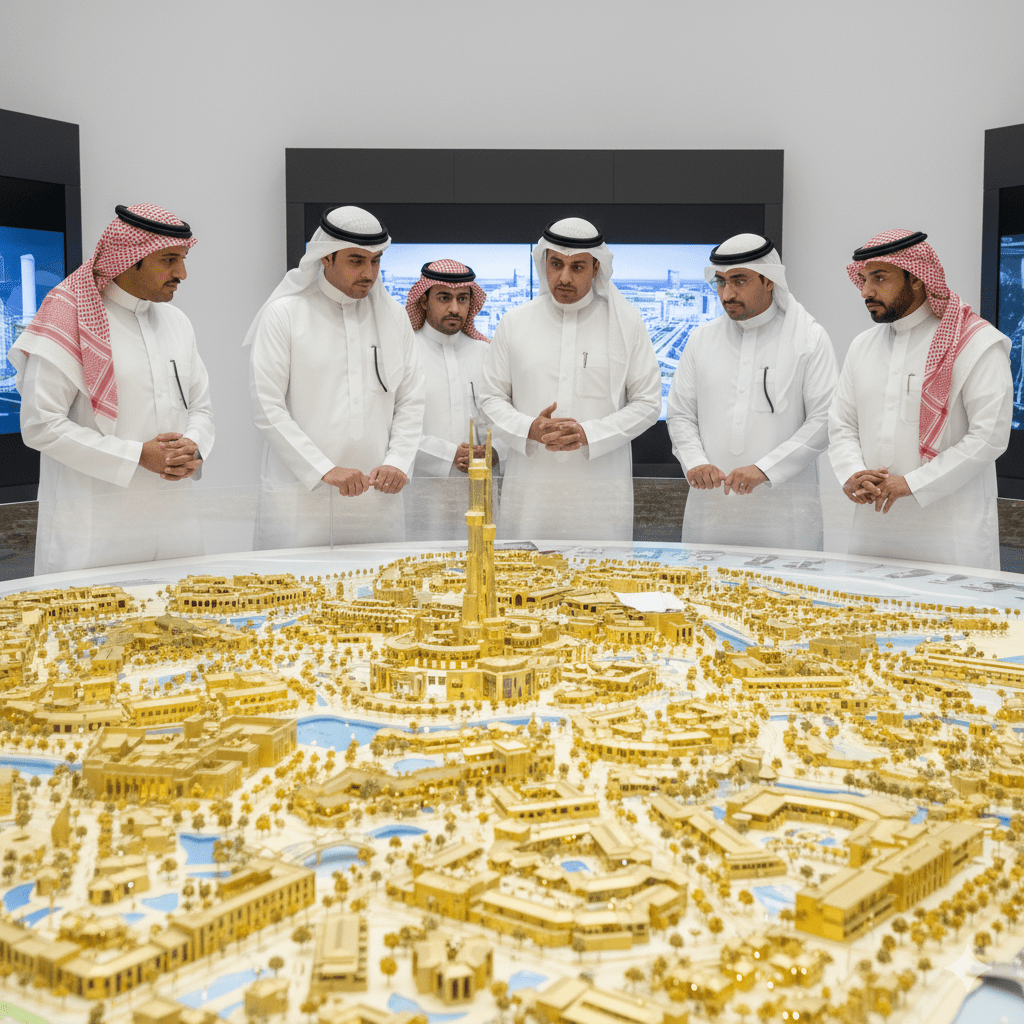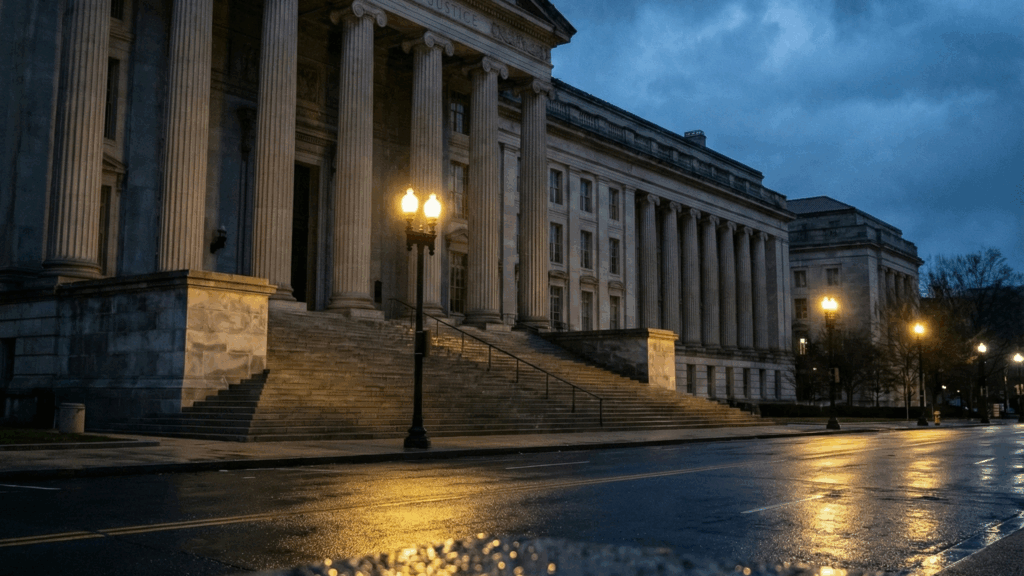
Es ist ein seltenes Schauspiel in der Welt der hohen Justiz, wenn das Schwert des Staates, gerade erhoben zum Schlag gegen politische Gegner, nicht am Schild der Verteidigung abprallt, sondern am eigenen Griff zerbricht. Die Entscheidung von Bundesrichterin Cameron McGowan Currie, die strafrechtlichen Anklagen gegen den ehemaligen FBI-Direktor James Comey und die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James abzuweisen, ist mehr als ein bloßer Verfahrenssieg für die Angeklagten. Sie ist ein grelles Schlaglicht auf die Mechanik einer Exekutive, die versucht, die Institutionen des Rechtsstaats für persönliche Vergeltung zu instrumentalisieren – und dabei über die eigenen Füße stolpert.
Das Urteil markiert einen vorläufigen Höhepunkt in einem Drama, das die Grenzen zwischen politischem Willen und rechtsstaatlicher Prozedur neu vermisst. Im Kern steht nicht die Frage nach Schuld oder Unschuld der Angeklagten, sondern die Legitimität der Ankläger selbst. Richterin Currie demontierte mit ihrem Urteil die Konstruktion des Justizministeriums, indem sie feststellte, dass Lindsey Halligan, die treibende Kraft hinter den Anklagen, ihren Posten als Interims-Bundesanwältin widerrechtlich innehatte.
Die Anatomie einer illegalen Ernennung
Um zu verstehen, warum dieser Fall implodierte, muss man tief in die bürokratischen Eingeweide des amerikanischen Regierungsapparats blicken. Hier, im Kleingedruckten des Federal Vacancies Reform Act, entschied sich das Schicksal der Anklage. Dieses Gesetz fungiert als eine Art Stoppuhr für die Macht des Präsidenten: Es erlaubt dem Justizministerium, vakante Posten vorübergehend für 120 Tage mit Interims-Kandidaten zu besetzen. Doch was geschieht, wenn die Uhr abläuft?

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die Rechtsauffassung der Richterin war eindeutig und stand in scharfem Kontrast zur Interpretation der Regierung. Während das Justizministerium argumentierte, man könne quasi endlos neue Interims-Anwälte für jeweils 120 Tage ernennen, bis der Senat irgendwann einen Kandidaten bestätigt, zog das Gericht hier eine rote Linie. Richterin Currie machte deutlich, dass dies den Geist des Gesetzes pervertieren würde. Würde man der Logik der Regierung folgen, könnte eine Administration den Bestätigungsprozess durch den Senat – eine essenzielle Kontrolle der Gewaltenteilung – für eine volle vierjährige Amtszeit komplett umgehen.
Die Chronologie der Ereignisse verrät dabei viel über die Intention hinter den Personalentscheidungen. Erik S. Siebert, der Vorgänger auf dem Posten, war kein politischer Neuling, sondern ein erfahrener Staatsanwalt, der bereits eine reguläre 120-Tage-Frist absolviert hatte und von den Gerichten bestätigt worden war. Sein „Vergehen“ in den Augen der Administration war offenbar seine professionelle Integrität: Er sah keine ausreichenden Beweise für eine Anklage gegen Comey und musste deshalb weichen. An seine Stelle trat Lindsey Halligan – eine ehemalige persönliche Anwältin des Präsidenten ohne nennenswerte Erfahrung als Staatsanwältin. Dieser Wechsel war kein üblicher Personaltausch, sondern wirkte wie das Austauschen eines klemmenden Zahnrads in einer Maschine, die um jeden Preis liefern soll.
Der Schatten der Rache: „Vindictive Prosecution“
Doch die Abweisung aufgrund der fehlerhaften Ernennung ist nur die Spitze eines weitaus dunkleren Eisbergs. Unter der juristischen Oberfläche brodelt der Vorwurf der „vindictive prosecution“ – der rachsüchtigen Strafverfolgung. Es ist der Vorwurf, dass das Justizministerium hier nicht als blindes Organ der Gerechtigkeit agierte, sondern als verlängerter Arm eines zornigen Präsidenten.
Die Indizienkette, die Comeys Verteidiger und kritische Beobachter knüpften, ist dicht. Sie verweisen auf eine langjährige Historie, in der Trump immer dann nach Strafverfolgung rief, wenn Comey Kritik äußerte. Besonders schwer wiegen dabei die digitalen Fußabdrücke des Präsidenten selbst. In einem bemerkenswerten Social-Media-Post wies er Justizministerin Pam Bondi fast unverholen an, gegen seine politischen Gegner vorzugehen: „Wir können nicht länger warten… SIE SIND ALLE SCHULDIG WIE DIE HÖLLE“, schrieb er und forderte, der Gerechtigkeit müsse „JETZT“ Genüge getan werden.
Diese Posts waren mehr als nur rhetorisches Poltern; sie wurden vor Gericht zu Beweismitteln für die Motivation der Anklage. Die zeitliche Nähe ist frappierend: Nur Tage nach diesen öffentlichen Forderungen und der Ernennung der unerfahrenen Halligan wurde die Anklage gegen Comey präsentiert. Für die Verteidigung war Halligan damit zur „Strohfrau“ oder zum „Stalking Horse“ degradiert – eine bloße Erfüllungsgehilfin, eingesetzt, um den Willen des Weißen Hauses in juristische Form zu gießen. Dass sie handelte, „was ihr gesagt wurde“, wie Anwalt Michael Dreeben es formulierte, ließ die Unabhängigkeit der Justiz zur Farce verkommen.
Das Chaos im Grand-Jury-Zimmer
Wenn die politische Motivation das Fundament der Anklage untergrub, so brachte die handwerkliche Inkompetenz das Gebäude endgültig ins Wanken. Der Mangel an staatsanwaltlicher Erfahrung bei Lindsey Halligan manifestierte sich auf fast tragikomische Weise im Umgang mit der Grand Jury.
Ein Grand-Jury-Verfahren ist normalerweise eine Einbahnstraße zugunsten der Staatsanwaltschaft; das Sprichwort, eine Grand Jury würde auch ein „Schinkenbrot anklagen“, kommt nicht von ungefähr. Doch Halligan gelang das Kunststück, selbst diesen prozessualen Heimvorteil zu verspielen. Das Desaster begann, als die Grand Jury einen der drei ursprünglich geforderten Anklagepunkte zurückwies. Anstatt, wie üblich, eine korrigierte Anklageschrift erneut zur Abstimmung vorzulegen, wählte Halligan eine Abkürzung, die sich als fatal erweisen sollte.
Die Staatsanwaltschaft gestand ein, dass die finale Version der Anklageschrift, die nur noch zwei Punkte enthielt, der vollzähligen Grand Jury niemals gezeigt wurde. Stattdessen unterschrieb lediglich die Vorsitzende das Dokument – ein gravierender Bruch des Protokolls. Die Versuche der Staatsanwaltschaft, dieses Versäumnis später als bloße „klerikale Inkonsistenz“ herunterzuspielen, wirkten verzweifelt. Widersprüchliche Aussagen der Anklagevertreter vor verschiedenen Richtern verstärkten den Eindruck des Chaos noch.
Magistrate Judge William Fitzpatrick fand für dieses Vorgehen drastische Worte. Er sprach von einem „verstörenden Muster tiefgreifender ermittlerischer Fehltritte“ und potenziell staatlichem Fehlverhalten. Dass Halligan zudem der Grand Jury gegenüber suggerierte, sie müssten sich nicht allein auf die vorliegenden Beweise verlassen, sondern könnten auf „bessere Beweise“ beim späteren Prozess vertrauen, war eine fundamentale Falschdarstellung der Rechtslage. Die Aussagen der Jury-Vorsitzenden, die später zur Entlastung herangezogen wurden, blieben juristisch wertlos, da sie so mehrdeutig waren, dass sie kaum als Beweis für eine ordnungsgemäße Abstimmung dienen konnten.
Der offene Krieg gegen die Richter
In einer Strategie, die eher an politische Kampagnen als an juristische Zurückhaltung erinnert, ging die Staatsanwaltschaft unter Halligan dazu über, die Richter selbst anzugreifen. Als Richter Nachmanoff in einer Anhörung fragte, ob Halligan als „Marionette“ (puppet) des Präsidenten agiere, reagierte diese nicht mit juristischen Argumenten, sondern mit einer öffentlichen Medienschelte.
In einem ungewöhnlichen Schritt maßregelte Halligan den Richter öffentlich und warf ihm vor, gegen richterliche Verhaltensregeln verstoßen zu haben. Diese aggressive Verteidigungshaltung, flankiert von Statements eines DOJ-Sprechers auf der Plattform X, offenbart ein tiefes Missverständnis der Gewaltenteilung. Anstatt die Position des Gegners zu attackieren, wurde der Schiedsrichter attackiert – ein Manöver, das in juristischen Kreisen als „Poking the Bear“ (den Bären reizen) gilt und selten von Erfolg gekrönt ist.
Ein Sieg ohne Frieden? Die Folgen des Urteils
Die Entscheidung von Richterin Currie, die Klagen „ohne Vorurteil“ (without prejudice) abzuweisen, lässt theoretisch die Tür für eine erneute Anklageerhebung offen. Doch in der Praxis dürfte diese Tür fest verschlossen sein. Das liegt weniger am politischen Willen, der in der Trump-Administration ungebrochen scheint, als vielmehr an den unerbittlichen Fristen des Gesetzes.
Zum Zeitpunkt der ursprünglichen Anklageerhebung stand die Verjährung der Vorwürfe gegen Comey kurz bevor. Da die nun abgewiesene Anklage juristisch als null und nichtig betrachtet werden muss – da sie von einer unbefugten Person eingebracht wurde –, dürfte die Verjährungsfrist in der Zwischenzeit abgelaufen sein. Ein neuer, rechtmäßig ernannter Staatsanwalt stünde somit vor dem Nichts.
Was bleibt, ist ein Trümmerhaufen. Der Fall Comey/James wird als Lehrstück dafür dienen, dass selbst eine aggressive Exekutive nicht die Grundregeln der administrativen Ordnung außer Kraft setzen kann. Die Strategie, das Justizministerium durch loyale, aber unerfahrene Interims-Kräfte zu steuern, ist durch dieses Urteil empfindlich getroffen worden. Es ist eine deutliche Zurückweisung des Versuchs, Strafverfolgung als Werkzeug persönlicher Abrechnung zu etablieren.
Dennoch bleibt ein bitterer Beigeschmack. Die Tatsache, dass das System erst durch eklatante handwerkliche Fehler der Angreifer gerettet wurde, zeigt, wie fragil die Barrieren gegen politischen Missbrauch sein können. Die Administration mag diesen Kampf verloren haben, doch die Bereitschaft, die Institutionen bis zum Bruch zu dehnen, bleibt bestehen. Für den Moment jedoch hat sich die Justiz als widerstandsfähig erwiesen – nicht durch heldenhafte Gesten, sondern durch das sture Beharren auf ihren eigenen Regeln.