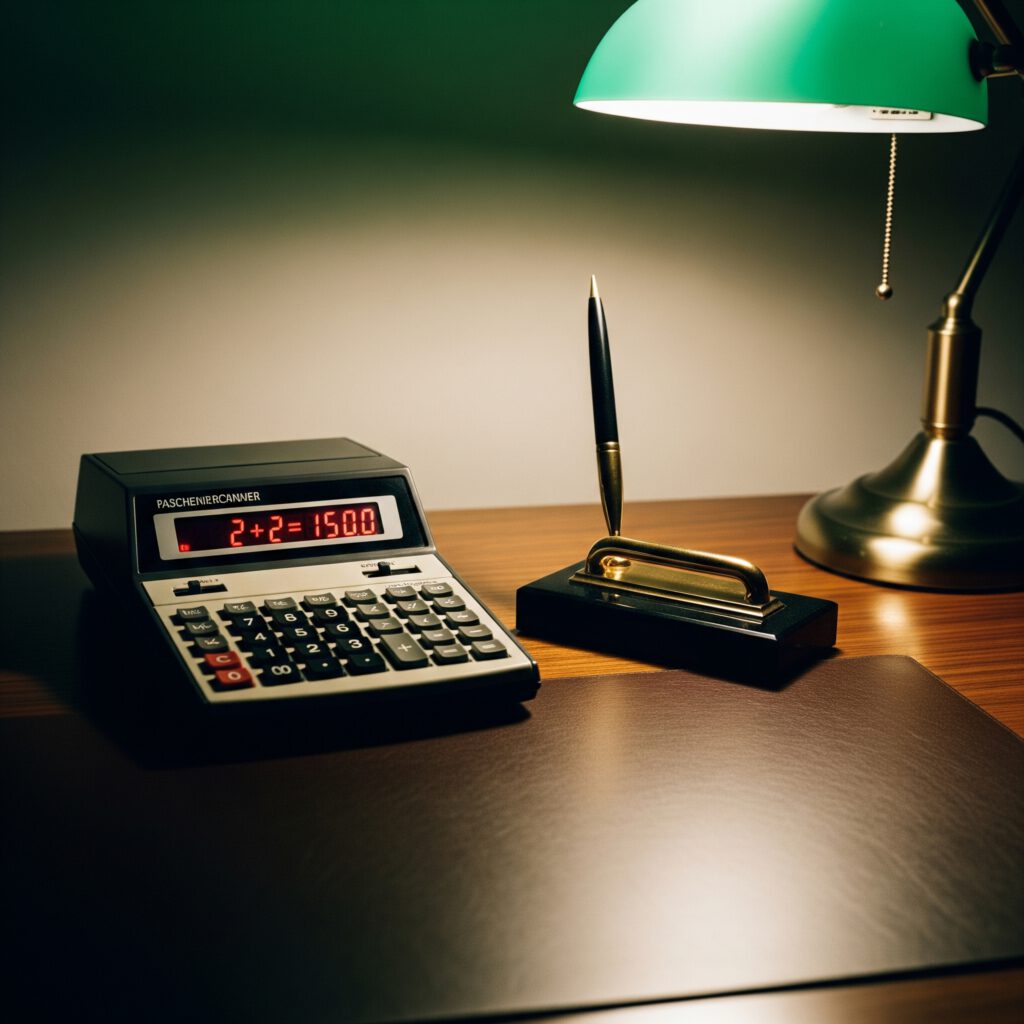Ein Schock, der durch die amerikanische Medienlandschaft hallt und weit über die Grenzen der Unterhaltungsindustrie hinaus spürbar ist. Am 17. Juli 2025 wurde bekannt gegeben, dass „The Late Show with Stephen Colbert“ nach ihrer Saison 2026 eingestellt wird. Doch es ist nicht nur das Ende der Amtszeit eines Moderators; es ist das Ende einer Institution, die David Letterman einst als sarkastisches Gegengewicht zum Establishment schuf und die Colbert in ein Forum für politische Schärfe und menschliche Tiefe verwandelte. Der Sender CBS präsentierte eine Erklärung, die so klar wie unterkühlt war: eine „rein finanzielle Entscheidung“. Doch in den stillen Gängen der Macht, in den Redaktionen und unter den wachsamen Augen der Öffentlichkeit formt sich eine andere, weitaus beunruhigendere Erzählung.
Diese Geschichte handelt nicht nur von Bilanzen und Einschaltquoten in einer sich auflösenden Fernsehlandschaft. Sie handelt von der subtilen, aber unerbittlichen Erosion der medialen Unabhängigkeit in einer Zeit, in der politischer Druck und Unternehmensinteressen zu einer toxischen Melange verschmelzen. Die Absetzung von Stephen Colbert, dem schärfsten und populärsten Kritiker des amtierenden Präsidenten im Abendprogramm, ist mehr als ein betriebswirtschaftlicher Vorgang. Sie ist ein alarmierendes Symptom dafür, wie kritische Satire in einem Klima der Angst als zu teuer – oder gefährlicher noch, als zu riskant – eingestuft wird. Es ist ein Lehrstück über den Preis der freien Rede und die Frage, was eine Gesellschaft verliert, wenn sie ihre unbequemsten Stimmen zum Schweigen bringt.
Die offizielle Bilanz: Eine kalte Rechnung in einer sterbenden Branche?
Auf dem Papier scheint die Argumentation von CBS wasserdicht. Das Late-Night-Fernsehen, einst ein goldenes Kalb der Werbeindustrie und ein kultureller Fixpunkt des amerikanischen Abends, befindet sich im freien Fall. Die Werbeeinnahmen für das Genre sind dramatisch eingebrochen, von 439 Millionen Dollar im Jahr 2018 auf nur noch 220 Millionen im letzten Jahr. Die Zuschauer, insbesondere die jüngeren und für Werbekunden wertvollsten, sind längst zu Streaming-Diensten und den schnellen, mundgerechten Clips auf YouTube und Social-Media-Plattformen abgewandert. Ganze Episoden linear zu konsumieren, fühlt sich für viele an wie ein Relikt aus einer vergangenen Zeit.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die Produktionskosten für eine Hochglanz-Show wie die von Colbert sind exorbitant und übersteigen oft 100 Millionen Dollar pro Jahr. Berichten zufolge machte die Sendung bereits Verluste in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar jährlich. Dieser Trend ist kein isoliertes Phänomen. CBS selbst hat erst kürzlich die Nachfolgesendungen „The Late Late Show“ nach James Cordens Abgang und „After Midnight“ mit Taylor Tomlinson ersatzlos gestrichen. Bei der Konkurrenz sieht es nicht besser aus: NBC musste bei Seth Meyers die Hausband streichen und bei Jimmy Fallon die Sendewoche kürzen, um Kosten zu sparen. Selbst Jon Stewart, eine Ikone des Genres, kehrte nur noch für einen Abend pro Woche zur „Daily Show“ zurück.
Die offizielle Erklärung ist also nicht aus der Luft gegriffen; sie ist in einer unbestreitbaren Branchenrealität verankert. Doch sie erzählt nur die halbe Wahrheit. Denn sie lässt eine entscheidende Frage unbeantwortet: Warum trifft es ausgerechnet die quotenstärkste und kulturell relevanteste Sendung des Genres? Warum kappt man das eigene Flaggschiff in einem Sturm, anstatt es mit allen Mitteln zu verteidigen? Die kühle Logik der Zahlen liefert hierfür eine plausible, aber seltsam unbefriedigende Antwort. Es ist, als würde man ein Meisterwerk aus dem Museum entfernen, weil die Versicherung zu teuer geworden ist. Die Begründung mag stimmen, doch sie ignoriert den eigentlichen Wert des Objekts – und die wahren Gründe, die hinter der Entscheidung stehen könnten.
Die Schatten des Deals: Ein politisches Opfer auf dem Altar des Geldes?
Um die tiefere Dimension dieser Entscheidung zu verstehen, muss man den Kalender betrachten. Der Zeitpunkt der Absetzung ist so brisant, dass er den Verdacht einer politischen Inszenierung nährt. Nur wenige Tage vor der Bekanntgabe hatte Stephen Colbert in seinem Monolog etwas getan, was im modernen Mediengeschäft einem Tabubruch gleichkommt: Er kritisierte seine eigene Muttergesellschaft, Paramount, scharf und unmissverständlich. Der Anlass war ein Vergleich in Höhe von 16 Millionen Dollar, den Paramount an Donald Trump zahlte, um eine Klage bezüglich eines Interviews der Sendung „60 Minutes“ mit Kamala Harris beizulegen. Colbert nannte diesen Deal öffentlich einen „fetten Bestechungsgeldbetrag“.
Diese Worte waren mehr als nur ein provokanter Scherz; sie waren ein direkter Angriff auf die Integrität seiner Vorgesetzten in einem extrem heiklen Moment. Denn Paramount befindet sich mitten in den Verhandlungen über eine milliardenschwere Fusion mit Skydance Media. Ein solcher Deal bedarf der Zustimmung der amtierenden Regierung – also der von Donald Trump. Die Vermutung liegt nahe, dass der Konzern alles tun würde, um diese Genehmigung nicht zu gefährden. Der 16-Millionen-Dollar-Vergleich wird von vielen Beobachtern und sogar CBS-Insidern als Geste des guten Willens, als vorauseilender Gehorsam oder, wie es Jon Stewart formulierte, als „Lehenstreue“ gegenüber der Macht interpretiert.
In diesem Kontext wirkt Colberts Absetzung nicht mehr wie eine rein betriebswirtschaftliche Maßnahme. Sie erscheint als logische Konsequenz, als das Entfernen eines Störfaktors, der die unternehmerischen Interessen gefährdete. Die öffentliche Kritik eines prominenten Mitarbeiters am eigenen Haus war das eine; dass dieser Mitarbeiter zugleich der beharrlichste Kritiker des Mannes war, dessen Wohlwollen man für ein Milliardengeschäft benötigte, könnte das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Es zeichnet das Bild eines Unternehmens, das unter dem Druck steht, sich zwischen journalistischer Unabhängigkeit und finanziellem Überleben entscheiden zu müssen. Der Verdacht, dass man sich für Letzteres entschieden und Colbert geopfert hat, wird durch die fast schon verzweifelt klingende Beteuerung von CBS, die Entscheidung habe „nichts mit dem Inhalt der Sendung oder anderen Vorgängen bei Paramount zu tun“, nur noch verstärkt.
Der Colbert-Code: Die Metamorphose eines unbequemen Geistes
Wer war dieser Mann, dessen Absetzung solch politische Wellen schlägt? Stephen Colbert war ein Paradoxon im Herzen des Mainstream-Fernsehens. Viele kannten ihn noch aus seiner Zeit bei „The Colbert Report“, wo er von 2005 bis 2014 die Figur eines reaktionären, aufgeblasenen Pundits spielte – eine brillante Parodie, die ihre Interviewpartner durch übertriebene Zustimmung entlarvte. Sein Witz war dort wild gegnerisch, sein Intellekt bestechend und seine Methode verstörend.
Als er 2015 „The Late Show“ von David Letterman übernahm, stand er vor der Herausforderung, diese scharfe, satirische Klinge für ein breiteres Publikum zu entschärfen, das einen authentischen Gastgeber erwartete, keinen Charakter. Einigen Beobachtern zufolge musste er sich für das Format „verwässern“. Doch Colbert gelang eine bemerkenswerte Metamorphose. Er tauschte die Maske des Demagogen gegen die Rolle eines nachdenklichen, oft „väterlichen“ Moderators, der fähig war zu tiefgreifenden, empathischen Gesprächen. Unvergessen bleibt sein Interview mit dem Schauspieler Andrew Garfield über Trauer, in dem er dem Schmerz einen Raum gab, der im grellen Licht der Unterhaltung sonst kaum existiert. Er zelebrierte seine unverfrorene Nerdhaftigkeit in Gesprächen mit Paul Giamatti über Science-Fiction und bewies moralischen Kompass, als er die Vorwürfe sexueller Belästigung gegen seinen damaligen Chef Les Moonves direkt in seiner Sendung ansprach und betonte, dass Rechenschaftspflicht für jeden gelten müsse, auch für „den eigenen Mann“.
Gleichzeitig verlor er nie seine politische Schärfe. Gerade durch den Aufstieg Donald Trumps fand er zu seiner vollen Stärke und machte die Sendung zu einer zentralen Plattform für Kritik an der Regierung. Er war derjenige, der die Widersprüche, Lügen und Absurditäten der Politik Nacht für Nacht aufspießte – und wurde damit zur meistgesehenen Stimme der Late Night. Diese einzigartige Mischung aus intellektueller Brillanz, moralischer Integrität und menschlicher Wärme machte ihn für sein Publikum unverzichtbar – und für seine Gegner vermutlich unerträglich.
Das Echo der Angst: Wenn Konzerne vor der Macht kapitulieren
Die Causa Colbert steht nicht isoliert da. Sie ist, so argumentieren mehrere Kommentatoren, ein Menetekel für den Zustand der amerikanischen Medienlandschaft. Die Bereitschaft von Paramount, sich einem Rechtsstreit, den sie wahrscheinlich gewonnen hätte, durch eine Millionenzahlung zu entziehen, wird als alarmierendes Zeichen der Unterwerfung interpretiert. Der Medienmogul Barry Diller fasste diese Haltung in die resignative Formel, man müsse eben „das Knie beugen, wenn eine Guillotine über dem Kopf schwebt“. Diese „Guillotine“ ist keine physische Bedrohung, sondern der drohende Verlust eines Milliardengeschäfts – was für die Akteure offenbar einer Enthauptung gleichkommt.
Dieser vorauseilende Gehorsam weckt düstere historische Assoziationen. Die Journalistin Molly Jong-Fast zieht eine beklemmende Parallele zur McCarthy-Ära, in der ihr Großvater sich weigerte, Namen zu nennen und dafür ins Gefängnis kam. Sie stellt fest, dass es oft nicht einmal einer direkten Drohung bedarf, um Menschen zur Anpassung zu bewegen; der Zwang des Autoritären wirkt subtiler. Ein anderer Beitrag erinnert an die russische Satiresendung „Kukly“ („Puppen“), die Wladimir Putin missfiel und Anfang der 2000er Jahre abgesetzt wurde – ein Vorbote der Gleichschaltung der russischen Medien.
Diese Vergleiche mögen drastisch klingen, doch sie verweisen auf einen Kern der Wahrheit: Wenn mächtige Medienkonzerne aus Angst vor politischen oder wirtschaftlichen Konsequenzen beginnen, ihre kritischsten Stimmen zu opfern, gerät das Fundament einer freien Presse ins Wanken. Die Absetzung von Colbert, so die Befürchtung, könnte einen „Chilling Effect“ auslösen, eine abschreckende Wirkung auf andere Journalisten und Satiriker. Die öffentliche Forderung von Senatoren und der Writers Guild of America nach einer Untersuchung der wahren Hintergründe zeigt, dass hier mehr auf dem Spiel steht als nur ein Sendeplatz. Es geht um die Frage, ob die vierte Gewalt ihre Kontrollfunktion noch ausüben kann, wenn ihre Eigentümer durch Geschäftsinteressen erpressbar sind.
Jenseits des Schreibtischs: Das verwaiste Erbe der Late-Night-Kultur
Was bleibt, ist ein Gefühl des Verlusts, das über die Person Colbert hinausgeht. Es ist das tragische Gefühl, dass eine Institution „durch nichts ersetzt wird“. Das Ende von „The Late Show“ markiert den vorläufigen Höhepunkt des Niedergangs einer Fernsehkultur, die über Jahrzehnte ein fester Bestandteil des öffentlichen Gesprächs war. Sie war ein Ort, an dem, wie es eine Kommentatorin ausdrückte, „Kommentar auf Gemeinschaft trifft, Nacht für Nacht“. Dieser Ort wird nun stillgelegt.
Für Stephen Colbert persönlich mag es neue Wege geben. Die moderne Medienwelt bietet Alternativen wie Podcasts oder Streaming-Angebote, wie es das Beispiel von Conan O’Brien zeigt. Doch ob er dort jemals wieder die gleiche kulturelle Reichweite und institutionelle Macht erlangen kann wie auf dem Stuhl bei CBS, ist fraglich. Die Absetzung ist auch ein Signal an die verbliebenen Late-Night-Moderatoren. Jimmy Kimmel, dessen Vertrag ebenfalls nächstes Jahr ausläuft, hat bereits öffentlich über das Ende seiner Karriere nachgedacht. Die Frage ist nicht mehr nur, wer am längsten durchhält, sondern ob das Genre selbst eine Zukunft hat.
Letztendlich offenbart die Absetzung von Stephen Colbert eine bittere Wahrheit über das heutige Amerika. Die unbestreitbaren ökonomischen Zwänge der Medienbranche bieten einen willkommenen und plausiblen Vorwand, um eine Entscheidung zu rechtfertigen, die im tiefsten Inneren politisch sein könnte. Sie verschleiern die unangenehme Realität, dass in der Konfrontation zwischen kritischem Geist und konzentrierter Macht oft die Macht gewinnt – nicht durch offene Zensur, sondern durch die kalte, unerbittliche Logik des Kapitals. Der größte Verlust ist daher nicht der einer Fernsehsendung. Es ist der Verlust einer Stimme, die es wagte, der Macht mit einem Lächeln die Wahrheit zu sagen – und die Erkenntnis, dass der Preis dafür offenbar zu hoch geworden ist.