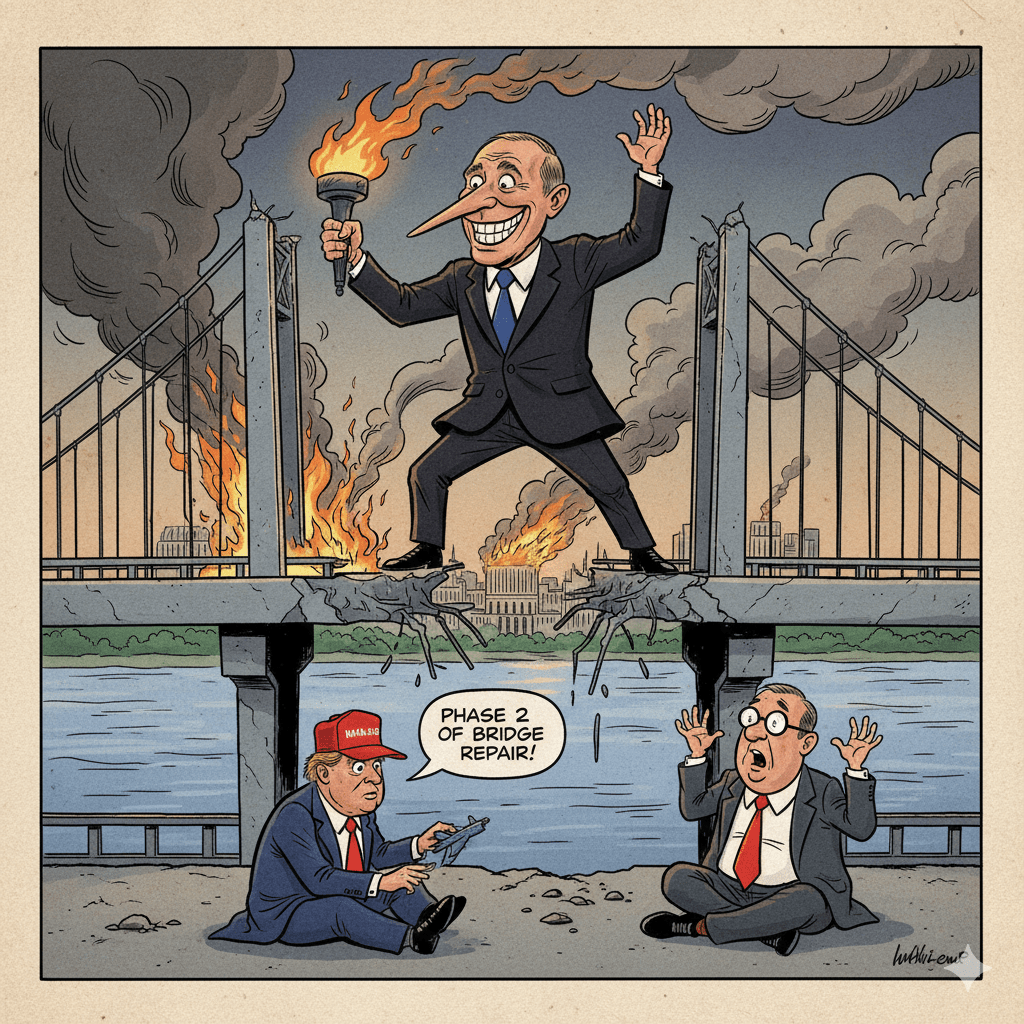Es ist ein Geräusch, das eine ganze Generation im kollektiven Gedächtnis gespeichert hat. Eine kakofonische Symphonie aus Pfeifen, Rauschen und einem schrillen Kratzen, die das Tor zu einer neuen Welt öffnete. Die Einwahlsequenz eines 56k-Modems war in den Neunzigerjahren der Soundtrack zum Aufbruch, das akustische Versprechen, Teil von etwas Großem zu sein: dem Internet. AOL, damals noch America Online, war für Millionen der Zeremonienmeister dieses Übergangs. Mit seiner aggressiven Verteilung von Gratis-CDs in jedem Briefkasten und einer Benutzeroberfläche, die selbst technische Laien an die Hand nahm, schuf der Konzern einen Massenmarkt, wo zuvor nur eine Domäne für Universitäten und Forschungseinrichtungen existiert hatte. Der berühmte Ausruf „You’ve got mail!“ wurde zum kulturellen Phänomen, unsterblich gemacht in einem Hollywood-Film mit Tom Hanks und Meg Ryan.
Nun, Jahrzehnte später, hat AOL in einer knappen, fast beiläufigen Notiz auf seiner Webseite das Ende dieses Dienstes für den 30. September angekündigt. Für die meisten ist dies eine amüsante Nachricht, ein nostalgischer Blick zurück auf eine längst überwundene technologische Epoche. Doch hinter dieser nostalgischen Fassade verbirgt sich eine unbequeme Wahrheit, die im politischen Klima der zweiten Trump-Administration eine besondere Brisanz entfaltet. Das leise Sterben von AOLs Einwahldienst ist weit mehr als das Ende einer Technik; es ist das Symptom eines tiefgreifenden politischen Versäumnisses. Es offenbart einen Staat, der seine Verantwortung für eine flächendeckende digitale Infrastruktur an den Markt delegiert hat und nun zusieht, wie die unbarmherzige Logik der Effizienz die letzten verbliebenen Nutzer im digitalen Niemandsland zurücklässt.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Ein Abschied ohne Fanfaren
Die unternehmerische Entscheidung von Yahoo, der Muttergesellschaft von AOL, ist auf den ersten Blick vollkommen rational. Ein Unternehmen, so heißt es in der offiziellen Verlautbarung, evaluiere regelmäßig seine Produkte und Dienstleistungen. Die Einstellung des Dial-up-Dienstes ist schlicht ein Akt der betriebswirtschaftlichen Hygiene. Warum eine Infrastruktur aufrechterhalten, deren Nutzerzahl von einst 25 Millionen in der Spitze auf wenige Tausend geschrumpft ist? Die Welt hat sich weitergedreht. Breitband und Glasfaser bieten heute Geschwindigkeiten, die hunderte, wenn nicht tausende Male schneller sind als die quälend langsamen 56 Kilobit pro Sekunde des alten Modems. AOL folgt damit nur einem Trend: Auch andere Relikte der frühen Internet-Ära wie der Internet Explorer oder der hauseigene AOL Instant Messenger (AIM) wurden längst zu Grabe getragen.
Doch diese kühle, betriebswirtschaftliche Logik übersieht den Menschen. Sie ignoriert die Tatsache, dass Technologie niemals nur neutrales Werkzeug ist, sondern immer auch soziale und politische Implikationen hat. Die Entscheidung, den Dienst einzustellen, wurde nicht im luftleeren Raum getroffen, sondern in einem Amerika, das tiefer gespalten ist als je zuvor – auch digital. Die Frage ist nicht nur, ob sich der Dienst für AOL noch rechnet, sondern wer die Kosten für seine Abschaltung trägt. Und die Antwort darauf ist politisch.
Die Vergessenen am Rande der Datenautobahn
Während die meisten von uns über die Erinnerung an blockierte Telefonleitungen schmunzeln, ist der Einwahlzugang für eine kleine, aber hartnäckige Minderheit noch immer die einzige verfügbare Nabelschnur zur digitalen Welt. Daten des US Census Bureau aus dem Jahr 2023 schätzen, dass rund 163.400 Haushalte in den USA ausschließlich über eine Dial-up-Verbindung online gehen. Das ist zwar nur ein Bruchteil aller Internetnutzer, aber es sind eben keine Nerds, die aus Retro-Liebe am alten System festhalten. Es sind Menschen in ländlichen, abgelegenen Regionen, die der Breitbandausbau schlicht vergessen hat. Für sie ist der Markt, der dem Rest des Landes blitzschnelles Internet beschert hat, ein Versprechen geblieben.
Die Diskrepanz zwischen den allgemeinen Zensus-Daten und den vagen Angaben von AOL über die „wenigen Tausend“ betroffenen Kunden deutet auf eine Nische hin, die für große Konzerne statistisch irrelevant, für die Betroffenen aber existenziell ist. Diese Menschen stehen nun vor einer drastischen Hürde. Ihre einzige Alternative ist oft das Internet per Satellit – eine Technologie, die zwar schneller ist, aber in der Regel auch deutlich teurer in der Einrichtung und im Unterhalt. Die Abschaltung von AOLs Dienst ist für sie keine Modernisierung, sondern eine Form der digitalen Enteignung. Sie werden von einer kostengünstigen Basisversorgung abgeschnitten und gezwungen, für ein Grundrecht des 21. Jahrhunderts einen deutlich höheren Preis zu zahlen. Hier manifestiert sich der digitale Graben nicht als Frage der Geschwindigkeit, sondern als knallharte soziale und ökonomische Barriere.
Der Markt als Richter: Ein politisches Vakuum
An dieser Stelle wird die unternehmerische Entscheidung von AOL zu einem politischen Lehrstück, insbesondere in der Ära einer Trump-Regierung, die staatliche Regulierung und soziale Verantwortung traditionell dem freien Spiel der Marktkräfte unterordnet. Die Annahme, der Markt werde es schon richten, erweist sich hier als Trugschluss. Der Markt richtet es – aber nur dort, wo es sich lohnt. In dünn besiedelten Gebieten, dem „Rostgürtel der Digitalisierung“, versagt diese Logik. Private Anbieter haben kein Interesse daran, teure Glasfaserkabel in Gegenden zu verlegen, in denen die Rendite gering ist.
So entsteht ein politisches Vakuum. Der Staat zieht sich aus der Verantwortung für eine universelle Daseinsvorsorge zurück und überlässt das Feld Konzernen, deren primäres Ziel nicht das Gemeinwohl, sondern die Profitmaximierung ist. Ist der Zugang zum Internet ein Luxusgut, das man sich leisten können muss, oder ein grundlegendes Recht wie der Zugang zu Wasser und Strom? Die stille Abschaltung des AOL-Dienstes liefert eine deprimierende Antwort. Sie zeigt, dass in der aktuellen politischen Landschaft Amerikas diejenigen, die nicht profitabel sind, schlicht vom Netz genommen werden – im wahrsten Sinne des Wortes. Es fehlt an politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die sicherstellen, dass niemand zurückgelassen wird. Anstatt Anreize oder Verpflichtungen für eine flächendeckende Versorgung zu schaffen, überlässt man das Schicksal der digitalen Abgehängten einer kurzen Mitteilung auf einer Hilfe-Seite im Internet.
Was bleibt, wenn die Verbindung abbricht?
Der Lebenszyklus von AOLs Einwahldienst ist eine Parabel auf den unerbittlichen Marsch der Technologie. Er begann mit dem genialen Marketing-Kniff, den Zugang zum Netz so einfach zu machen, dass selbst der deutsche Tennisstar Boris Becker ihn mit dem Satz „Bin ich schon drin?“ bewerben konnte. AOL sprach nicht die Experten an, sondern die Masse, die Neugierigen, die Zögerlichen. Dieser kometenhafte Aufstieg endete mit der katastrophalen Fusion mit Time Warner und dem Siegeszug des Breitbands.
Die Lehre aus diesem Niedergang ist heute relevanter denn je. Was passiert, wenn andere, heute allgegenwärtige Technologien veralten? Was geschieht mit den Nutzern von 3G-Netzen, wenn diese zugunsten von 5G und 6G abgeschaltet werden? Der Fall AOL zeigt, dass der Übergang nicht reibungslos verläuft. Er erzeugt Verlierer, und die Kommunikation mit diesen Verlierern ist oft mangelhaft, wie die karge 106-Wort-Ankündigung von AOL beweist.
Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass das nostalgische Geräusch des Modems zwei sehr unterschiedliche Geschichten erzählt. Für die einen ist es die süße Melodie einer aufregenden Vergangenheit. Für die anderen ist es das abrupte Ende einer Verbindung zur Gegenwart. Und solange die Politik keine Antwort darauf findet, wie sie diese letzte, leise Gruppe schützen kann, wird der digitale Graben in den USA weiter wachsen. Das letzte Piepen von AOL ist somit auch ein Alarmsignal – ein schwacher, aber unüberhörbarer Ruf aus den vergessenen Ecken einer Nation, die Gefahr läuft, einen Teil ihrer eigenen Bürger offline zu lassen.