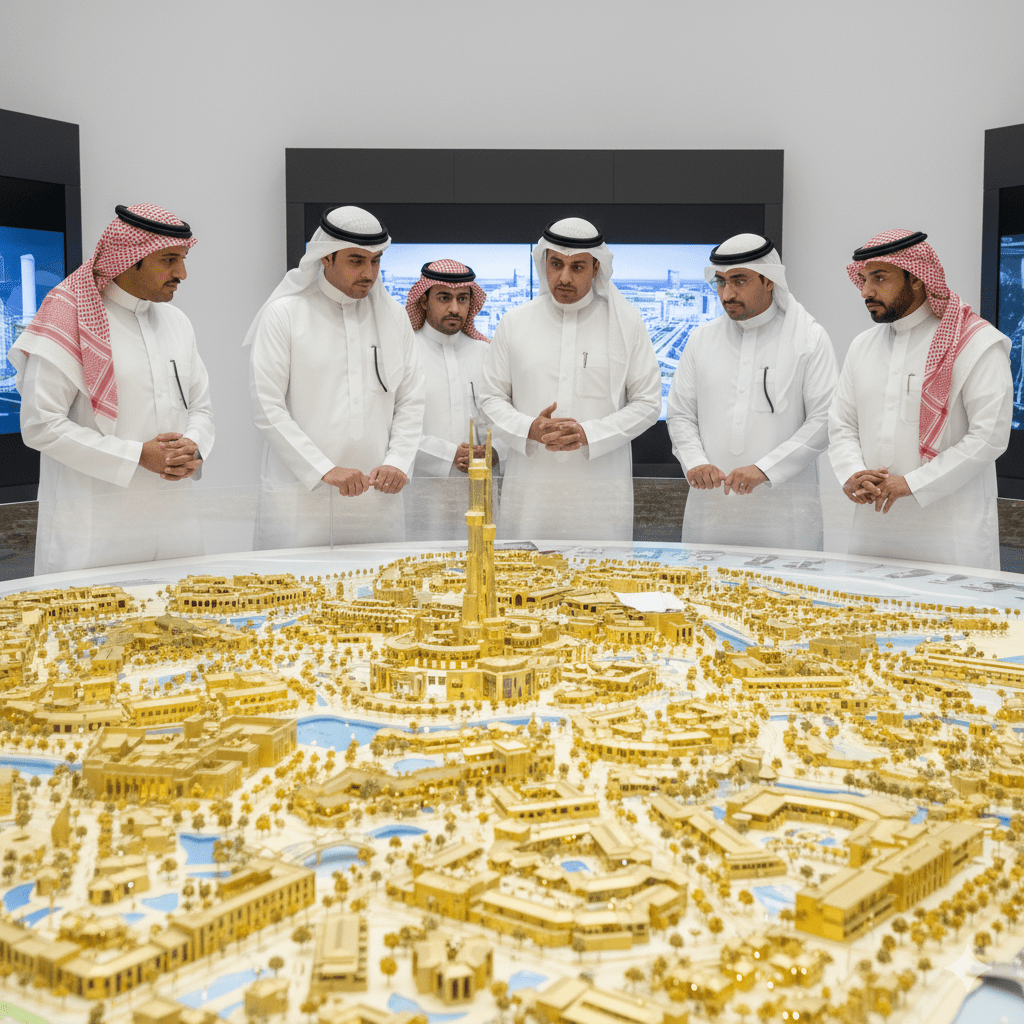In den ehrwürdigen Hallen des Pentagons, jenem fünfzackigen Symbol amerikanischer Militärmacht, hat sich ein tiefes, beunruhigendes Schweigen ausgebreitet. Es ist nicht die Stille konzentrierter strategischer Planung, sondern die gelähmte Ruhe, die einem Erdbeben vorausgeht. Seit dem Amtsantritt von Verteidigungsminister Pete Hegseth, einem ehemaligen Fernsehmoderator und Kriegsveteranen, wird das Fundament dieser Institution von innen heraus erschüttert. Seine Amtsführung ist mehr als nur eine Serie kontroverser Entscheidungen; sie ist das Abbild eines gezielten politischen Projekts, das darauf abzielt, die traditionelle, unpolitische Seele des US-Militärs durch ein neues Credo zu ersetzen: bedingungslose persönliche Loyalität gegenüber dem Minister und dem Präsidenten. Die Konsequenzen dieses Experiments sind nach nur sechs Monaten verheerend: ein Klima aus Paranoia und Misstrauen, eine Organisation in ständiger Unruhe und die wachsende Sorge, dass die Verteidigungsfähigkeit der Nation selbst zum Kollateralschaden wird.
Die Säuberung: Wenn Loyalität mehr wiegt als Erfahrung
Der Fall von Generalleutnant Douglas A. Sims II ist wie ein Brennglas, das die neue Realität im Pentagon scharfzeichnet. Ein Offizier mit einer makellosen, 34-jährigen Karriere, gehärtet in fünf Einsätzen in Afghanistan und im Irak, dessen Beförderung zum Vier-Sterne-General als sicher galt. Doch Hegseth verweigerte seine Zustimmung. Zuerst hegte er den unbelegten Verdacht, Sims könnte Informationen an die Presse durchgestochen haben. Als diese Anschuldigung in sich zusammenfiel, fand der Minister einen neuen Grund: Sims sei General Mark Milley zu nahegestanden, dem ehemaligen Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff, den Präsident Trump der Illoyalität bezichtigt. Selbst eine seltene und direkte Intervention des amtierenden Vorsitzenden, General Dan Caine, konnte Hegseth nicht umstimmen. Sims, so heißt es, wird nun in den Ruhestand gehen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Diese Entscheidung ist kein Einzelfall, sondern Teil eines erkennbaren Musters. Sie ist der sichtbarste Ausdruck einer systematischen Säuberung, die darauf abzielt, jede Form von wahrgenommener Abweichung oder unabhängigem Denken aus den Führungsrängen zu entfernen. Kurz nach Amtsantritt wurde General Charles Q. Brown Jr., der erste schwarze Vorsitzende der Joint Chiefs, entlassen. Der Vorwurf Hegseths: Brown habe Diversität über die Kampfkraft der Truppe gestellt. In einer beispiellosen Entlassungswelle mussten weitere hochrangige Frauen ihre Posten räumen, darunter die erste weibliche Kommandeurin der Navy, Admiralin Lisa Franchetti, und die erste Frau an der Spitze der Küstenwache, Admiralin Linda Fagan. All dies geschah unter dem Banner der Wiederherstellung eines „Kriegerethos“ und der Ausmerzung von Programmen für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion. Die Botschaft ist unmissverständlich: Fachliche Exzellenz und eine vielfältige, moderne Führungskultur werden als Hindernisse auf dem Weg zu einer Armee betrachtet, die vor allem eines sein soll – loyal.
Die Festung des Misstrauens: Paranoia, Lügendetektoren und die Jagd auf Phantome
Dieses neue Primat der Loyalität hat das Pentagon in eine Festung des Misstrauens verwandelt. Die Angst vor Verrat und Leaks ist zur Obsession geworden und hat zu Maßnahmen geführt, die man eher aus Spionageromanen kennt als aus dem Führungszirkel einer demokratischen Supermacht. Hegseth begann, sein Umfeld mit Lügendetektortests zu überziehen, um undichte Stellen zu finden. Die Drohung, selbst hochrangige Generäle wie den Vize-Vorsitzenden der Joint Chiefs an einen Polygraphen anzuschließen, schwebte im Raum. Die Praxis wurde erst gestoppt, als ein als loyal geltender Berater sich beim Weißen Haus beschwerte, weil er fürchtete, selbst ins Visier zu geraten – ein bezeichnender Einblick in die internen Machtkämpfe und das sich selbst zerfleischende System.
Die Paranoia richtet sich nicht nur gegen das Militär-Establishment, sondern auch gegen die eigenen zivilen Mitarbeiter. Drei hochrangige Berater Hegseths wurden im April abrupt entlassen und aus dem Gebäude eskortiert, begleitet von dem öffentlichen, aber bis heute unbelegten Vorwurf, sie hätten geheime Informationen an die Medien weitergegeben. Dieses Vorgehen hinterlässt verbrannte Erde. Es schafft ein Arbeitsklima, in dem offene Beratung unmöglich wird und Angst die Initiative erstickt. Die hohe Personalfluktuation hat Hegseths Büro personell ausgezehrt; zeitweise agierte er ohne formellen Stabschef, weil das Weiße Haus Bedenken gegen seinen Wunschkandidaten hatte. Wie soll eine derart komplexe und kritische Organisation wie das US-Verteidigungsministerium effektiv geführt werden, wenn sein Leiter in einem permanenten Krieg mit den eigenen Leuten zu stehen scheint? Die Antwort liegt in den zunehmenden Berichten über Chaos und Dysfunktion, wie bei der kurzzeitigen Aussetzung von Waffenlieferungen an die Ukraine, die offenbar ohne ausreichende Abstimmung erfolgte und vom Präsidenten dramatisch korrigiert werden musste.
Signalgate: Wenn die nationale Sicherheit zur Nebensache wird
Nichts offenbart die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit in Hegseths Pentagon so sehr wie die „Signalgate“-Affäre. Es ist die Geschichte eines Sicherheitsverstoßes, der in seiner Dreistigkeit fast schon absurd anmutet. Vor einem US-Luftangriff auf Huthi-Milizen im Jemen wurden präzise Details zur Operation – darunter der genaue Zeitpunkt, die eingesetzten Flugzeugtypen und Waffen – über den unverschlüsselten Messenger-Dienst „Signal“ geteilt. Brisant wurde der Vorfall, weil sich in einer der Chatgruppen versehentlich ein Journalist befand.
Die eigentliche Enthüllung, die das ganze Ausmaß des Problems beleuchtet, kam jedoch erst später ans Licht: Die geteilten Informationen stammten aus einer als „SECRET/NOFORN“ klassifizierten E-Mail. Diese Markierung bedeutet, dass eine unbefugte Veröffentlichung geeignet ist, ernsten Schaden für die nationale Sicherheit zu verursachen, und die Informationen nicht einmal für enge Verbündete bestimmt sind. Die Reaktion der Administration auf diese Enthüllungen ist ein Lehrstück in Verleugnung. Anstatt den Fehler einzugestehen und aufzuklären, beharrten das Pentagon und das Weiße Haus darauf, es seien keine klassifizierten Informationen geteilt worden – eine Behauptung, die durch die Faktenlage widerlegt wird. Dieser Umgang mit einem schwerwiegenden Sicherheitsverstoß zeigt eine beunruhigende Missachtung etablierter Protokolle und legt den Verdacht nahe, dass der Schutz des eigenen politischen Images wichtiger ist als der Schutz operativer Geheimnisse und der beteiligten Soldaten. Die Affäre ist nun Gegenstand einer Untersuchung des Generalinspekteurs des Pentagons, ein weiteres Zeichen für die tiefen Risse im System Hegseth.
Der Performer: Zwischen medialer Inszenierung und politischer Realität
Um Pete Hegseth zu verstehen, muss man seine Vergangenheit als Fernsehmoderator bei Fox News berücksichtigen. Er ist ein Mann, der die Macht der Bilder kennt und die „performativen Aspekte“ seines Amtes sichtlich genießt. Seine Social-Media-Kanäle sind gefüllt mit professionell produzierten Videos, die ihn beim Training mit Truppen zeigen. Diese als „troop touches“ bekannten Foto-Termine sind zentraler Bestandteil seiner öffentlichen Auftritte. Ein besonders umstrittenes Bild zeigt ihn, wie er bei den D-Day-Gedenkfeiern in der Normandie eine Krankentrage mit einem Soldaten mitträgt – eine Inszenierung, die von vielen im Pentagon als eigennützige Imagepflege und Ablenkung vom Wesentlichen kritisiert wird.
Diese glänzende Fassade steht im scharfen Kontrast zur politischen Realität seiner Amtsführung. Während die PR-Maschine das Bild eines zupackenden Anführers zeichnet, beschreiben Insider das Bild eines Ministers, der führungsschwach und überfordert ist. Ein republikanischer Senator, der für Hegseths Bestätigung gestimmt hatte, nannte ihn „out of his depth“, also seiner Aufgabe nicht gewachsen. Der Widerspruch zwischen öffentlicher Darstellung und interner Wahrnehmung wurde bei den Luftschlägen gegen iranische Atomanlagen besonders deutlich. Während das Weiße Haus Hegseth öffentlich für die „makellose Ausführung“ lobte, berichten Militärquellen, dass Präsident Trump seinen Verteidigungsminister in den entscheidenden Tagen weitgehend umging und sich stattdessen direkt auf seine Generäle verließ. Hegseths Wert für den Präsidenten scheint weniger in seiner strategischen Kompetenz zu liegen als in seiner Fähigkeit, die anschließende Pressekonferenz kämpferisch zu meistern.
Am Ende bleibt das Bild einer tief gespaltenen Institution. Das Chaos im Pentagon ist kein Betriebsunfall, sondern die logische Konsequenz eines politischen Experiments, das eine der wichtigsten Säulen der amerikanischen Demokratie neu ausrichten will. Der Versuch, eine professionelle, auf die Verfassung vereidigte Militärführung durch ein System zu ersetzen, das auf dem brüchigen Fundament persönlicher Gunst und politischer Ideologie gebaut ist, hat bereits jetzt enorme Schäden angerichtet. Die entscheidende Frage, die über den Hallen des Pentagons schwebt, lautet daher: Was geschieht mit einem Land, dessen Schild und Schwert von einem Mann geführt wird, der seinen eigenen Generälen mehr misstraut als den Gegnern der Nation?