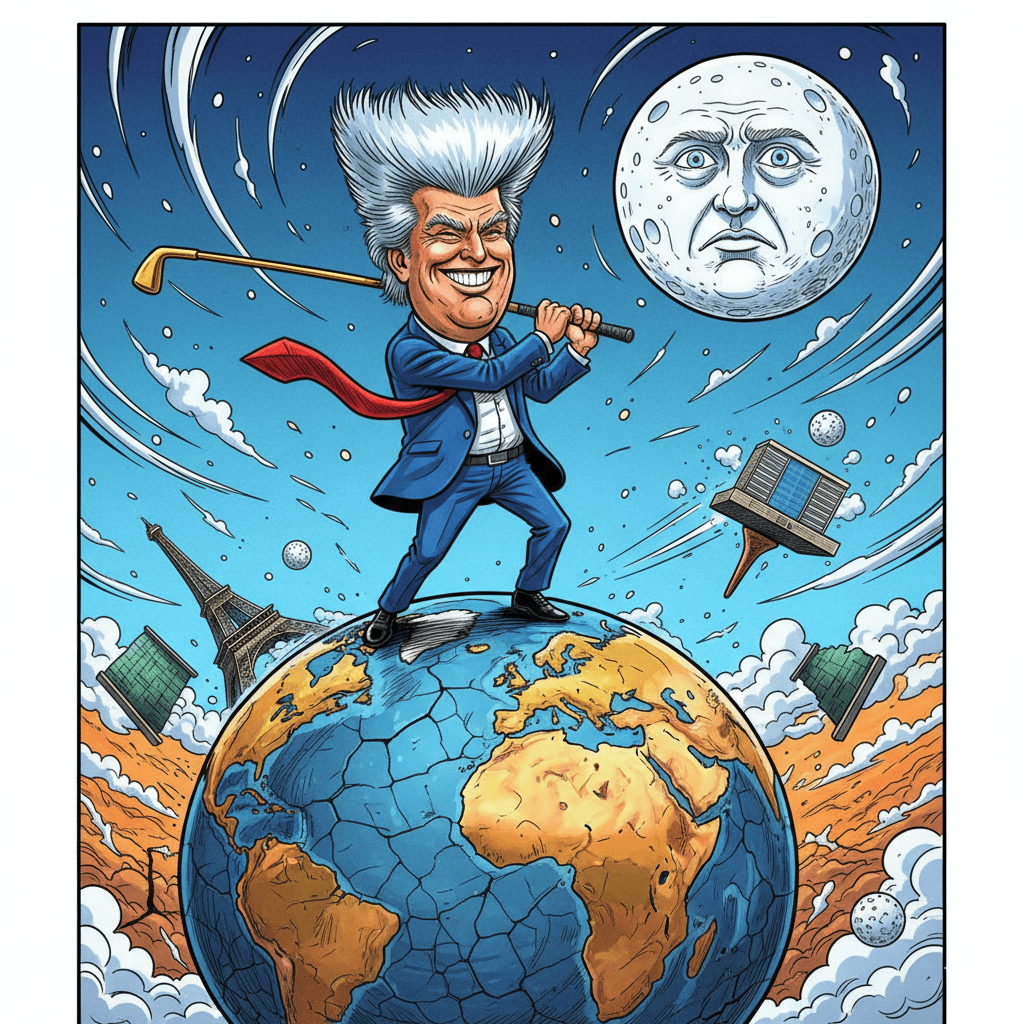Es war der Moment, in dem die imperiale Aura endgültig verblasste: Am Montagabend schickten die Anwälte von Bill und Hillary Clinton eine E-Mail, die einem militärischen Waffenstillstandsgesuch gleichkam. Nach Monaten des Widerstands, der juristischen Scharmützel und der öffentlichen Empörung beugte sich das einst mächtigste Paar der amerikanischen Politik dem Druck des republikanischen Kongressausschusses. Sie werden aussagen. Ohne Bedingungen. Ohne Schutzschirm. Es ist das Ende einer Ära der Unberührbarkeit.
Lange Zeit wirkte es wie ein Ritual aus einer vergangenen Epoche: Die Clintons, konfrontiert mit Vorwürfen, zogen die Wagenburg hoch, ließen ihre Staranwälte juristische Salven abfeuern und vertrauten darauf, dass der Sturm vorüberziehen würde. Doch diesmal zog er nicht vorüber. Am Montagabend, nur Stunden bevor das US-Repräsentantenhaus formell darüber abstimmen wollte, die beiden wegen „Missachtung des Kongresses“ (Contempt of Congress) strafrechtlich verfolgen zu lassen, schwenkten Bill und Hillary Clinton die weiße Flagge.
In einer knappen Nachricht an den Ausschussvorsitzenden James R. Comer signalisierten ihre Anwälte, dass ihre Mandanten zu eidesstattlichen Befragungen erscheinen würden – zu „gegenseitig genehmen Terminen“. Die Drohkulisse, die Comer aufgebaut hatte, war zu mächtig geworden: Bei einer Verurteilung wegen Missachtung des Kongresses drohen Geldstrafen von bis zu 100.000 Dollar und Haftstrafen von bis zu einem Jahr. In einer Zeit, in der ehemalige Trump-Berater wie Peter Navarro und Steve Bannon tatsächlich Gefängniszellen von innen sehen mussten, war das Risiko kein bloßes theoretisches Konstrukt mehr, sondern eine greifbare Gefahr für die persönliche Freiheit zweier Menschen, die ihr Leben im Zentrum der Macht verbracht haben.
Der Belagerungszustand
Die Kapitulation markiert das Ende eines monatelangen Nervenkriegs, den man als Lehrstück moderner politischer Asymmetrie bezeichnen kann. James Comer, der republikanische Vorsitzende des House Oversight Committee, hatte ein klares, fast chirurgisches Ziel: Den Fokus der Epstein-Ermittlungen weg von Donald Trump und dessen Justizministerium zu lenken und stattdessen die Verbindungen prominenter Demokraten zu dem verurteilten Sexualstraftäter ins grelle Scheinwerferlicht zu zerren. Es war der Versuch, das Narrativ zu kapern, indem man die Scheinwerfer von der eigenen Seite weg und auf die Gegner richtete.
Die Clintons hatten versucht, diesen Angriff mit den Mitteln der alten Schule abzuwehren. Sie argumentierten über Monate hinweg, die Vorladungen seien „ungültig und rechtlich nicht durchsetzbar“. Sie sahen darin einen Missbrauch der Kongressgewalt zur Belästigung politischer Gegner, eine „unzulässige Anmaßung exekutiver Strafverfolgungsbefugnisse“. Sie boten Kompromisse an, die in einer weniger polarisierten Zeit wohl akzeptiert worden wären: schriftliche eidesstattliche Erklärungen, ähnlich jenen, die Comer von anderen ehemaligen Regierungsbeamten wie Jeff Sessions oder Alberto Gonzales akzeptiert hatte. Zuletzt boten sie sogar ein persönliches Interview in Bill Clintons Büro in New York an – allerdings unter der Bedingung, dass kein offizielles Transkript angefertigt würde.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Doch Comer lehnte ab. Er roch die Schwäche. Er bestand auf einem „Transcribed Interview“ vor dem gesamten Ausschuss, ohne thematische Einschränkungen. Er bezeichnete das Verhalten der Clintons als den arroganten Versuch, basierend auf ihrem Nachnamen eine Sonderbehandlung einzufordern. „Sie haben in gutem Glauben verhandelt. Sie nicht“, ließen die Sprecher der Clintons verbittert verlauten, als klar wurde, dass Comer nicht von seiner Forderung nach totaler Transparenz – oder totaler Demütigung – abrücken würde. Comer argumentierte, dass ohne ein offizielles Transkript keine Aufzeichnung für das amerikanische Volk existiere, was er als „unhaltbare Forderung“ zurückwies. Moral gewinnt keine Machtkämpfe in Washington, und Comer wusste, dass er am längeren Hebel saß.
Bilder einer Ausstellung
Was die Position des Ex-Präsidenten dramatisch schwächte, war nicht nur die juristische Zange, sondern eine parallel laufende Kampagne der visuellen Demontage. Das von der Trump-Administration kontrollierte Justizministerium hatte im Dezember eine „Lawine“ von über 13.000 Akten und Fotos zum Fall Epstein veröffentlicht – selektiv, wie Kritiker anmerken, da Trump selbst in den Dokumenten kaum auftauchte, Bill Clinton aber omnipräsent war. Die politischen Motive des Weißen Hauses waren offensichtlich: Ablenkung durch Fingerzeigen.
Die Bilder zerstörten mühsam gepflegte Narrative mit der Wucht eines Vorschlaghammers. Da war Bill Clinton, der sich in den letzten 25 Jahren als weltgewandter Philanthrop und Elder Statesman neu erfunden hatte, plötzlich wieder auf das reduziert, was seine Gegner immer in ihm sahen: „Slick Willy“. Ein Foto zeigt ihn lächelnd auf Epsteins Privatjet, eine junge Blondine auf der Armlehne seines Sessels. Ein anderes Bild präsentiert ihn entspannt und oberkörperfrei in einem Whirlpool, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, das Gesicht der Person neben ihm durch einen schwarzen Balken unkenntlich gemacht. Man sieht ihn grinsend neben Mick Jagger oder Schulter an Schulter mit Jeffrey Epstein selbst.
Die Reaktion der politischen Rechten war gnadenlos und orchestriert. Steven Cheung, Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, verbreitete das Whirlpool-Foto auf der Plattform X mit dem hämischen Kommentar „Slick Willy! (…) Little did he know…“, und bediente sich damit eines Spitznamens, der bis in Clintons Zeit als Gouverneur von Arkansas zurückreicht. Die New York Post, das verlässliche Sprachrohr des Boulevard-Konservatismus, titelte brutal: „Tubba Bubba“. Es war eine konzertierte Aktion, um Clinton nicht als Staatsmann, sondern als moralisch kompromittiertes Relikt darzustellen. Clinton selbst hatte in seinen Memoiren geschrieben, er wünschte, er hätte Epstein nie getroffen , doch die Flugbücher erzählen eine andere Geschichte als die „wenigen Treffen“, die er einräumt: Vier internationale Reisen in den Jahren 2002 und 2003 sind dokumentiert. Das Bild des Elder Statesman zerfiel zu Staub, und darunter kam der Mann zum Vorschein, dessen Urteilsvermögen schon immer sein größter Feind war.
Der Verrat der eigenen Partei
Doch der entscheidende Dolchstoß, der die Kapitulation unvermeidlich machte, kam nicht von den Republikanern. Er kam aus den eigenen Reihen. Als der Ausschuss über die Empfehlung zur Anklage wegen Missachtung des Kongresses abstimmte, hielt die demokratische Brandmauer nicht. Neun Demokraten stimmten gemeinsam mit den Republikanern dafür, Bill Clinton zur Rechenschaft zu ziehen. Selbst bei Hillary Clinton, deren Verbindung zum Fall Epstein weitaus tenuer ist, brachen drei Demokraten – Summer Lee, Melanie Stansbury und Rashida Tlaib – aus der Parteilinie aus und stimmten für die Contempt-Resolution.
Dies ist der wohl tiefgreifendste Wandel in der amerikanischen Polit-Landschaft, ein tektonisches Beben im Fundament der Demokratischen Partei. In den 90er Jahren verteidigten Demokraten und Feministen Bill Clinton noch vehement gegen Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens. Heute, in der Ära nach #MeToo, ist diese Reflex-Loyalität verschwunden. Jüngere Abgeordnete sind nicht mehr bereit, ihre Glaubwürdigkeit für die „Altlasten“ der Clintons zu opfern. Die Partei versucht leise, den ehemaligen Präsidenten und sein Gepäck hinter sich zu lassen.
„Ich werde jeden wegen Missachtung belangen, der uns Informationen vorenthält“, erklärte die Abgeordnete Rashida Tlaib und fügte hinzu: „Aber Schande über uns, dass wir Bondi nicht vor diesen Ausschuss zwingen“. Zwar kritisierten die Demokraten die Heuchelei der Republikaner, die eigene Leute wie Trump oder Justizministerin Pam Bondi schonten und eine Doppelmoral an den Tag legten, doch das reichte nicht mehr als Entschuldigung, um Clinton blind zu decken. Die Abgeordnete Summer Lee nannte das Verfahren zwar ein „Kangaroo Court“, stimmte aber dennoch für die Bestrafung der Clintons. Die Botschaft ist klar: Transparenz wiegt schwerer als dynastische Loyalität. Die Clintons sind politisch heimatlos geworden.
Kollateralschaden Hillary
Besonders zynisch wirkt in diesem Schachspiel die Rolle, die Hillary Clinton zugewiesen wurde. Sie hat stets beteuert, Jeffrey Epstein nie getroffen zu haben und sich an keinerlei Interaktionen erinnern zu können. Selbst demokratische Kritiker wie der Abgeordnete Kweisi Mfume zeigten sich verwundert über ihre Vorladung: „Ich sehe nichts, was darauf hindeutet, dass sie in irgendeiner Weise Teil davon sein sollte“.
Für Comer und die Republikaner scheint sie jedoch vor allem eines zu sein: ein „Bargaining Chip“, ein Verhandlungspfand, um ihren Ehemann in die Zange zu nehmen. Indem man auch sie ins Visier nahm und mit Gefängnis bedrohte, erhöhte man den Druck auf Bill Clinton exponentiell. Mfume nannte es beim Namen: Man wolle sie einfach „ein bisschen aufmischen“ („dust her up“), wenn man sie schon mal vor den Ausschuss bekäme. Dass nun selbst für dieses transparente Manöver drei demokratische Stimmen zu gewinnen waren, zeigt, wie sehr der Respekt vor der ehemaligen Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin in Teilen der eigenen Basis erodiert ist. Ihr Sprecher warnte vergebens, die Republikaner sollten es sich zweimal überlegen, „Familie zum Freiwild zu erklären“. In der heutigen Arena ist niemand mehr tabu.
Das Gesetz des Dschungels
Juristisch gesehen betreten die USA mit diesem Vorgang Neuland. Seit Gerald Ford im Jahr 1983 freiwillig vor dem Kongress erschien, um über die Zweihundertjahrfeier der Verfassung zu sprechen, hat kein ehemaliger Präsident mehr vor dem Kapitol ausgesagt. Donald Trump hatte Vorladungen während seiner Zeit nach dem Amt – etwa durch den Ausschuss zum 6. Januar – stets bekämpft und ignoriert, bis sie zurückgezogen wurden. Dass nun ausgerechnet Bill Clinton der erste Ex-Präsident sein wird, der sich einer solchen Befragung unterziehen muss, ist eine Ironie der Geschichte.
Die Doppelmoral ist greifbar: Während Trump und seine Gefolgschaft Vorladungen als unverbindliche Empfehlungen behandelten, wird bei den Clintons die volle Härte des Gesetzes demonstriert. Philippe Reines, ein langjähriger Berater der Clintons, verglich Comers Suche nach der Wahrheit bissig mit O.J. Simpsons Suche nach dem „wahren Killer“: „Jeder wusste, dass O.J. sich selbst schützte. Jeder weiß, wen Jim Comer schützt“. Die Clintons argumentierten vergeblich, dass der Oberste Gerichtshof eine Verbindung („Nexus“) zwischen den legislativen Zielen einer Untersuchung und den Zeugen verlangt.
Doch juristische Feinheiten zählen wenig, wenn die politische Deckung fehlt. Die Clintons mussten erkennen, dass die Institutionen und Präzedenzfälle, auf die sie sich einst verließen, nicht mehr als Schutzschilde taugen. Die Drohung, den Fall an das Justizministerium zu überweisen, war real, und die Strafen für Missachtung – bis zu einem Jahr Haft – waren keine leeren Worte. Die „Sonderbehandlung“, die Comer den Clintons vorwarf, existiert faktisch nicht mehr; sie wurde ersetzt durch eine gezielte Härte, die an Peter Navarro und Steve Bannon vorexerziert wurde.
Das Ende der Unberührbarkeit
Die bevorstehende Aussage der Clintons wird ein Spektakel werden, egal wie die Rahmenbedingungen am Ende im Detail aussehen. Comer hat bereits angekündigt, Fragen über Clintons Versuche stellen zu wollen, „seine Macht und seinen Einfluss nach der Präsidentschaft zu nutzen, um negative Nachrichten über Jeffrey Epstein zu töten“. Es wird kein höfliches Gespräch unter Staatsmännern werden, bei dem man über Politik und Wirtschaft plaudert – wie Clinton seine Gespräche mit Epstein beschrieb. Es wird ein Verhör.
Was wir in diesen Tagen erleben, ist die Demontage einer amerikanischen Dynastie in Echtzeit. Die Clintons, die einst die Schwerkraft der politischen Skandale außer Kraft zu setzen schienen, sind hart auf dem Boden der Tatsachen aufgeschlagen. Sie sind nicht mehr die unantastbaren Architekten der Macht, sondern Figuren in einem Spiel, dessen Regeln jetzt von anderen geschrieben werden – von rachsüchtigen Republikanern und einer desillusionierten Linken, die sich nicht mehr vor den Karren spannen lässt. Die E-Mail vom Montagabend war mehr als eine juristische Einigung. Sie war das Eingeständnis, dass die Vergangenheit sie endgültig eingeholt hat und dass kein Name, egal wie prominent, mehr vor den Konsequenzen schützt. Bill Clinton schrieb in seinem Buch: „Ich wünschte, ich hätte ihn nie getroffen“. Dieser Satz dürfte heute mehr Wahrheit enthalten als je zuvor.