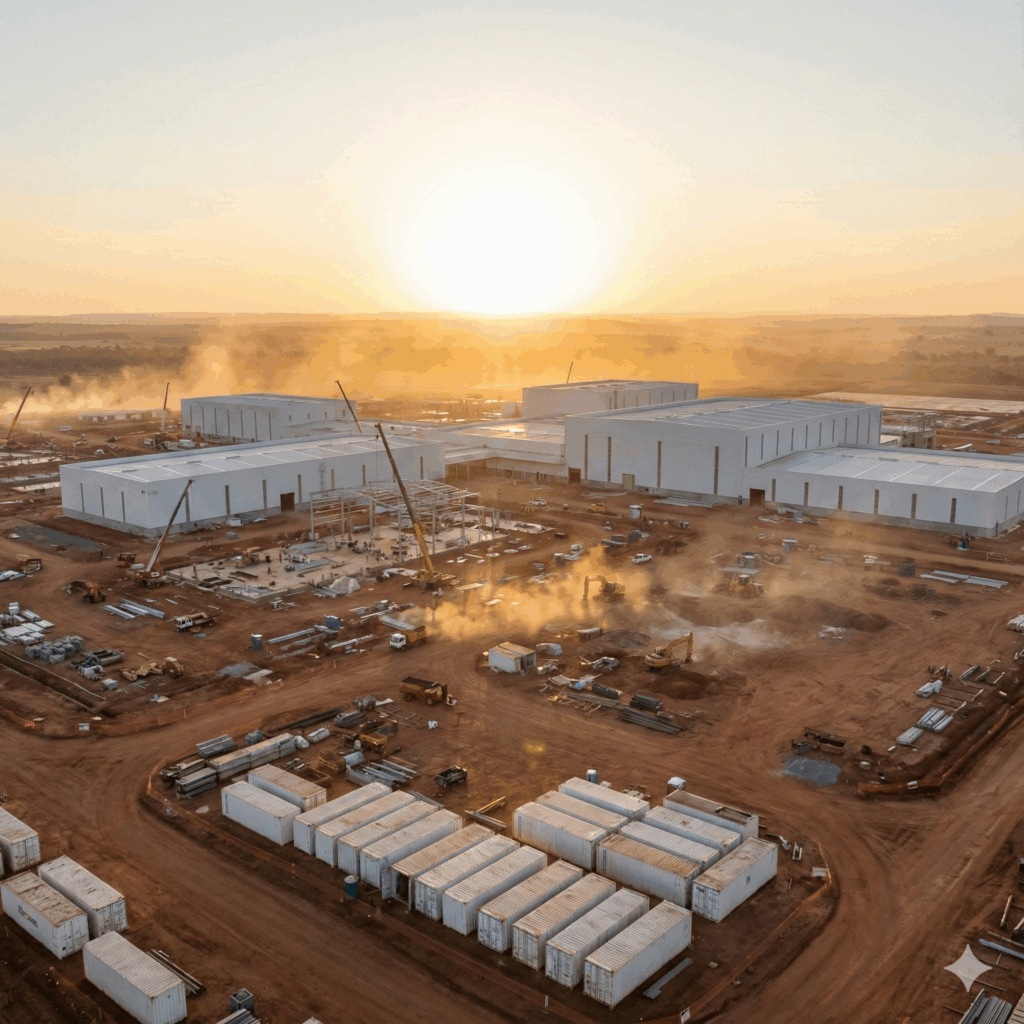Die Bilder aus Los Angeles wirken wie aus einem dystopischen Film: Bewaffnete Nationalgardisten in Kampfmontur sichern Bundesgebäude, während auf den Straßen wütende Proteste gegen Einwanderungsrazzien toben und fahrerlose Taxis in Flammen aufgehen. Doch die dramatischen Szenen der letzten 24 Stunden sind weit mehr als nur ein lokaler Flächenbrand. Sie sind die sichtbare Manifestation einer tiefgreifenden Verfassungskrise, die Präsident Donald Trump bewusst zu inszenieren scheint. In einer beispiellosen Machtdemonstration hat Trump nicht nur Tausende Soldaten der Nationalgarde gegen den erklärten Willen der kalifornischen Regierung föderalisiert und in Marsch gesetzt, sondern zusätzlich 700 kampferprobte Marines nach Los Angeles beordert. Es ist eine Eskalation, die auf eine direkte Konfrontation mit dem demokratisch regierten Bundesstaat abzielt und die Grundfesten des amerikanischen Föderalismus erschüttert. Was in der kalifornischen Metropole geschieht, ist ein politisches Ringen mit nationaler Sprengkraft – ein Kampf um Deutungshoheit, rechtliche Grenzen und die Frage, wie weit ein Präsident gehen kann, um seinen Willen durchzusetzen.
Ein Funke im Pulverfass: Die Eskalationsspirale der letzten 24 Stunden
Die Lage in Los Angeles, die bereits über das Wochenende brodelte, hat sich binnen eines Tages dramatisch zugespitzt. Auslöser waren verschärfte Razzien der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE, die in der von Migration geprägten Stadt für Angst und Wut sorgten. Die Verhaftung des prominenten Gewerkschaftsführers David Huerta am Freitag während einer dieser Aktionen wirkte als Brandbeschleuniger. Huerta, Präsident der einflussreichen Gewerkschaft SEIU California, wurde schnell zur Symbolfigur des Widerstands. Tausende Menschen gingen auf die Straße, um seine Freilassung zu fordern und gegen die Einwanderungspolitik der Regierung zu protestieren.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die Reaktion des Präsidenten ließ nicht lange auf sich warten. Anstatt auf Deeskalation zu setzen, goss Trump Öl ins Feuer. Am Samstag ordnete er die Mobilisierung von 2000 Nationalgardisten an – ein Schritt, den Gouverneur Gavin Newsom umgehend als Tabubruch und verfassungswidrig verurteilte. Doch damit nicht genug. Am Montagabend verkündete das Pentagon auf direkte Anweisung Trumps die Entsendung von weiteren 2000 Gardisten sowie zusätzlich 700 aktiven Marines aus Camp Pendleton. Die Gesamtzahl der für den Einsatz in L.A. vorgesehenen Militärangehörigen stieg damit auf fast 5000. Begründet wurde dieser drastische Schritt mit dem Schutz von Bundesbeamten und Bundeseigentum angesichts angeblicher Bedrohungen. Für die kalifornische Regierung und lokale Behörden ist dies jedoch ein durchschaubarer Vorwand für eine politisch motivierte Machtdemonstration.
Zwei Präsidenten, zwei Realitäten: Der Kampf um die Deutungshoheit
Im Zentrum des Konflikts steht ein erbitterter Kampf um die Deutungshoheit, der hauptsächlich von zwei Akteuren mit völlig gegensätzlichen Zielen geführt wird: Präsident Trump und Gouverneur Newsom. Ihre öffentliche Rhetorik zeichnet zwei fundamental verschiedene Bilder der Realität in Los Angeles.
Präsident Trump und seine Regierung malen das Bild einer Stadt am Rande des Aufruhrs. Sie bezeichnen die Demonstranten wiederholt als „gewalttätige, aufrührerische Mobs“ und „Kriminelle“, die Bundesagenten „schwärmen und angreifen“. Trump selbst behauptete, ohne sein Eingreifen wäre Los Angeles „vollständig zerstört“ worden. Diese martialische Rhetorik, die die Proteste als „Aufstand“ framt, dient einem klaren strategischen Ziel: Sie soll die Notwendigkeit und Legitimität des umstrittenen Militäreinsatzes untermauern und möglicherweise sogar den Boden für noch drastischere Maßnahmen wie die Ausrufung des „Insurrection Act“ bereiten. Politisch zielt Trump darauf ab, mit seinem harten Vorgehen gegen Migration und Proteste seine Basis zu mobilisieren und sich als Präsident von „Recht und Ordnung“ zu inszenieren.
Gouverneur Newsom und die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, vertreten eine diametral entgegengesetzte Sichtweise. Sie sprechen von einer bewusst von Washington „hergestellten“ und „choreografierten“ Krise. Newsom wirft Trump vor, „Chaos und eine Krise für seine eigenen politischen Ziele zu erzeugen“ und „Angst und Wut zu säen, um die Spaltung zu vertiefen“. Bass betont, die Proteste seien auf wenige Straßen im Zentrum beschränkt und größtenteils friedlich verlaufen. Die Gewalt sei von der Trump-Administration provoziert worden, um eine härtere Gangart zu rechtfertigen. Ihr Ziel ist es, die Situation zu deeskalieren, die Souveränität ihres Bundesstaates zu verteidigen und die Maßnahmen der Bundesregierung als unverhältnismäßige und illegale Einmischung darzustellen. Diese Haltung mündete konsequenterweise in einer Klage gegen die Trump-Administration.
„Unamerikanisch und Illegal“: Der beispiellose Griff nach der Nationalgarde
Der Kern des Konflikts ist eine juristische und verfassungsrechtliche Auseinandersetzung von historischer Tragweite. Die Anordnung des Präsidenten, die Nationalgarde eines Bundesstaates ohne die Zustimmung oder gar gegen den Willen des amtierenden Gouverneurs zu föderalisieren und einzusetzen, ist ein extrem seltener und folgenschwerer Vorgang. Historische Vergleiche, die in den Quellen gezogen werden, zeigen die Brisanz der Lage. Das letzte Mal, dass ein Präsident die Garde gegen den Willen eines Staates mobilisierte, war 1965 während der Bürgerrechtsbewegung, als Präsident Lyndon B. Johnson die Nationalgarde von Alabama unter Bundeskommando stellte, um die Marschteilnehmer von Selma zu schützen. Im Gegensatz dazu erfolgte der Einsatz der Garde während der Unruhen in Los Angeles 1992 auf ausdrücklichen Wunsch des damaligen Gouverneurs und Bürgermeisters.
Trumps Vorgehen wird von Rechtsexperten und der kalifornischen Regierung als „komplett beispiellos unter jeglicher Rechtsgrundlage“ und als „illegale“ und „verfassungswidrige“ Machtanmaßung kritisiert. Kalifornien hat deshalb Klage eingereicht. Die Klage argumentiert, dass Trumps Befehl die Souveränität des Staates und den 10. Verfassungszusatz verletzt, der die Rechte der Bundesstaaten schützt. Die Trump-Administration beruft sich auf Statuten wie „Title 10“ des US-Gesetzes, die dem Präsidenten unter bestimmten Umständen – etwa bei einer Rebellion – die Kontrolle über die Garde erlauben. Ob diese Bedingungen in Los Angeles gegeben sind, ist Kern der juristischen Auseinandersetzung. Kritiker werfen Trump vor, eine „neuartige Rechtstheorie“ zu testen, um die Beschränkungen für Militäreinsätze im Inland zu umgehen. Die Entsendung aktiver Marines verschärft diese Problematik zusätzlich, da das „Posse Comitatus“-Gesetz von 1878 den Einsatz des Militärs für polizeiliche Aufgaben im Inland grundsätzlich verbietet, es sei denn, der Präsident ruft den „Insurrection Act“ aus – ein Schritt, den Trump bisher vermieden, aber angedeutet hat.
Zwischen den Fronten: Die realen Kosten des Konflikts für Bürger und Presse
Während in Washington und Sacramento die juristischen und politischen Klingen gekreuzt werden, hat der Konflikt auf den Straßen von Los Angeles bereits sehr reale und schmerzhafte Konsequenzen. Bürgermeisterin Bass beschreibt eine Atmosphäre von „Angst und Terror“, die sich in der Stadt ausbreitet. Familien von Verhafteten berichten, dass sie ihre Angehörigen nicht lokalisieren können und ihnen der Zugang zu Rechtsbeistand verwehrt wird – ein laut Bass „beispielloser“ Vorgang. Diese Verunsicherung hat direkte Auswirkungen auf das tägliche Leben: Menschen haben Angst, ihre Kinder zur Schule zu schicken oder zur Arbeit zu gehen, was wiederum die lokale Wirtschaft schädigt.
Die Proteste und die massive Polizeipräsenz führen auch zu erheblichen Störungen. Der Robotaxi-Dienst Waymo hat seinen Service in Teilen der Innenstadt eingestellt, nachdem mehrere seiner Fahrzeuge in Brand gesteckt wurden. Überall in der Stadt sind Gebäude, Gehwege und sogar Bushaltestellen mit Anti-ICE- und Anti-Trump-Graffiti besprüht. Die physischen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften, bei denen Protestierende Feuerwerkskörper warfen und die Polizei mit Gummigeschossen und Tränengas reagierte, haben zu Verletzten auf beiden Seiten geführt.
Besonders besorgniserregend ist die Gewalt gegen Journalisten, die über die Ereignisse berichten. Mehrere Medienvertreter wurden durch „weniger tödliche“ Geschosse der Polizei verletzt, darunter ein australischer TV-Reporter, der vor laufender Kamera getroffen wurde. Journalisten beschreiben eine nie dagewesene Aggressivität der Polizei. Einige tragen klare Presseausweise und vermuten, dass sie gezielt ins Visier genommen wurden. Pressefreiheitsorganisationen warnen, dass solche Angriffe, ob beabsichtigt oder nicht, eine abschreckende Wirkung haben und die Fähigkeit der Öffentlichkeit beeinträchtigen, sich über die Handlungen der Regierung zu informieren.
Ein Riss geht durch Amerika: Von Los Angeles in die Nation
Die Ereignisse in Los Angeles sind längst kein isoliertes kalifornisches Problem mehr. Der Konflikt hat sich zu einer nationalen Angelegenheit entwickelt und eine Welle der Solidarisierung ausgelöst. In zahlreichen anderen Städten wie New York, Philadelphia, Austin, San Francisco und Washington D.C. finden ebenfalls Proteste gegen die ICE-Razzien und Trumps Vorgehen statt. Die Verhaftung von David Huerta dient auch hier als Sammelpunkt; Gewerkschaften und Bürgerrechtsgruppen organisieren landesweit Demonstrationen und fordern ein Ende der „autoritären Machtübernahme“. Die gemeinsame Forderung, die diese dezentralen Bewegungen eint, ist die Ablehnung von Trumps harter Einwanderungspolitik und dem, was sie als Missbrauch von Militär und Bundesbehörden für politische Zwecke ansehen.
Dieser Konflikt legt einen tiefen Riss im föderalen Gefüge der USA offen und könnte langfristige Konsequenzen haben. Trumps Ansatz wird als „Föderalismus als Einbahnstraße“ beschrieben: Bundesmittel und Hilfe werden als Druckmittel und politische Waffe eingesetzt, um Staaten gefügig zu machen, während gleichzeitig die Souveränität der Staaten bei der Handhabung lokaler Krisen untergraben wird. Diese Strategie stellt eine Abkehr von traditionellen konservativen Positionen dar, die typischerweise die Rechte der Bundesstaaten (States‘ Rights) hochhalten. Paradoxerweise zwingt dies progressive Kräfte wie Newsom, zu Verteidigern der bundesstaatlichen Autonomie zu werden – eine Rolle, die in der Vergangenheit oft von Republikanern im Kampf gegen als übergriffig empfundene Bundespolitik eingenommen wurde. Die Konfrontation in Los Angeles wird damit zum Testfall dafür, wie sich das Machtgleichgewicht zwischen Washington und den Bundesstaaten unter einem Präsidenten verschiebt, der bereit ist, etablierte Normen und rechtliche Grauzonen bis zum Äußersten auszureizen. Der Ausgang dieses Ringens wird nicht nur über das Schicksal von Los Angeles entscheiden, sondern könnte die Spielregeln der amerikanischen Politik für Jahre neu definieren.