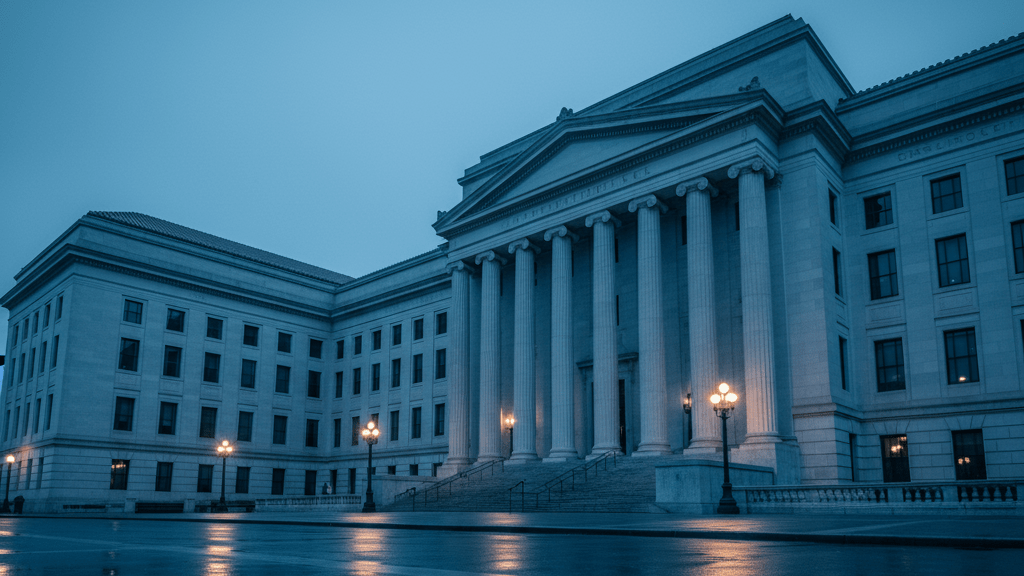
Es ist ein Sturm, der sich seit Wochen über Washington zusammenbraut. Ein politischer Rachefeldzug, der unter dem Deckmantel des Rechts geführt wird – Kritiker nennen es „Lawfare“. Die Ziele sind klar definiert: Es sind die prominentesten Gegner von Präsident Donald Trump. Der frühere FBI-Direktor James Comey und die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James sehen sich mit Anklagen konfrontiert, die selbst wohlwollende Beobachter als juristisch dünn und politisch motiviert bezeichnen. Es scheint ein offenes Schauspiel der Willkür zu sein.
Doch dann, inmitten dieses Getöses, trifft es einen Mann, der die simple Erzählung von Trumps Rachejustiz verkompliziert: John Bolton, der frühere Nationale Sicherheitsberater. Auch er ist ein erbitterter Kritiker des Präsidenten. Auch er wird nun angeklagt. Aber hier, so scheint es, ist alles anders. Der Fall gegen Bolton ist nicht schwach, er ist substanziell. Er wurde nicht von politischen Loyalisten erzwungen, sondern von Karriere-Staatsanwälten vorbereitet. Die Anklage gegen John Bolton ist der Paukenschlag, der uns zwingt, genauer hinzusehen. Sie wirft eine beunruhigende Frage auf: Was passiert, wenn ein autokratisch agierender Präsident einen echten Skandal nutzt, um seine illegitimen politischen Hexenjagden zu rechtfertigen? Boltons Fall ist mehr als nur eine weitere Anklage; er ist der vielleicht gefährlichste Test für die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Justiz.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die Anatomie einer politischen Säuberung
Um den Fall Bolton zu verstehen, muss man zunächst das Muster erkennen, in das er eingebettet ist. Die Anklagen gegen James Comey und Letitia James folgen einem Drehbuch, das mehr mit Machtpolitik als mit Strafverfolgung zu tun hat. In beiden Fällen sollen die Anklagen erzwungen worden sein, nachdem sich erfahrene Staatsanwälte geweigert hatten, sie zu unterschreiben. Der Mechanismus war brutal und effektiv: Der amtierende US-Staatsanwalt Erik S. Siebert, der die Fälle als juristisch zu schwach einstufte, wurde aus dem Amt gedrängt. An seine Stelle trat Lindsey Halligan, eine loyal zum Präsidenten stehende Juristin.
Das Ergebnis ist eine juristische Farce. Comeys Verteidiger argumentieren bereits, dass die gesamte Anklage wegen „Rachejustiz“ (vindictive prosecution) und der mutmaßlich illegalen Ernennung der Staatsanwältin nichtig sei. Diese Fälle sind die Kulisse – laut, plump und offensichtlich politisch. Sie dienen dazu, ein Klima der Einschüchterung zu schaffen und das Justizministerium als Werkzeug des Präsidenten zu etablieren.
Boltons Sündenfall: Ein Fall von Substanz
Und genau in dieses Klima platzt die 18-Punkte-Anklage gegen John Bolton. Auf den ersten Blick passt er ins Beuteschema. Seit der Veröffentlichung seines Enthüllungsbuchs „The Room Where It Happened“ gilt er als Staatsfeind im Trump-Lager. Doch die Parallelen enden hier.
Die Vorwürfe gegen Bolton sind von anderem Kaliber. Ihm wird nicht nur ein Formfehler vorgeworfen, sondern der systematische Missbrauch von Staatsgeheimnissen. Die Anklageschrift liest sich wie ein Albtraum für jeden Geheimdienstler: Bolton soll über 1.000 Seiten seiner persönlichen, tagebuchartigen Notizen, die als streng geheim eingestufte „national defense information“ enthielten, über private E-Mail-Konten (darunter AOL) an unbefugte Dritte weitergeleitet haben. Diese Dritten waren seine Frau und seine Tochter, die ihm halfen, das Material für sein Buch zu sichten. Was die Sache unermesslich verschlimmert: Eines dieser unsicheren E-Mail-Konten wurde gehackt. Die Spuren führen zum Iran. Einem der erbittertsten Gegner der USA wurden damit potenziell unredigierte Einblicke in die Denkprozesse und Interna der amerikanischen Sicherheitsarchitektur frei Haus geliefert. Als Bolton den Hack dem FBI meldete, soll er zudem den brisanten Inhalt des Kontos – seine eigenen geheimen Notizen – verschwiegen haben. Hier geht es nicht um juristische Spitzfindigkeiten. Es geht um einen massiven Verstoß gegen die Grundlagen der nationalen Sicherheit, begangen vom höchsten Sicherheitsberater des Landes.
Für die Ankläger dürfte der Nachweis des Vorsatzes indes einfach werden. Sie müssen nur Boltons eigene Worte verwenden. Als das „Signalgate“ von Minister Hegseth publik wurde, war Bolton einer der schärfsten Kritiker und betonte öffentlich, wie unverantwortlich die Nutzung kommerzieller Apps für Staatsgeheimnisse sei. Er wusste genau, was er tat.
Der fatale Widerspruch: Gleiches Recht für niemanden
Die Substanz des Falls Bolton stellt das Justizministerium jedoch vor ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Denn wenn Boltons Handeln – die Nutzung unsicherer Kanäle für Geheiminformationen – strafbar ist, warum gilt das nicht für andere? Die Öffentlichkeit erinnert sich lebhaft an den „Signalgate“-Vorfall, bei dem Verteidigungsminister Pete Hegseth militärische Operationsdetails über einen kommerziellen Messenger-Dienst teilte. Die Ermittlungen? Schnell eingestellt. Noch dröhnender ist das Schweigen im Fall von Donald Trump selbst. Der frühere Präsident wurde für die Lagerung von Geheimdokumenten in Mar-a-Lago und das aktive Zeigen von Angriffsplänen an Unbefugte (wie im Bedminster-Interview) angeklagt. Doch diese Anklagen wurden fallengelassen. Bolton wird nun wegen „unauthorized transmission“ (Weitergabe) angeklagt – ein Punkt, der bei Trump trotz klarer Beweislage ignoriert wurde.
Diese schreiende Inkonsistenz ist der Kern des Problems. Das Spionagegesetz wird zur Waffe, die je nach politischer Loyalität des Ziels entweder mit voller Wucht eingesetzt oder im Holster gelassen wird. Warum also Bolton, aber nicht Hegseth oder Trump? Die Antwort ist ebenso zynisch wie offensichtlich: Bolton ist der perfekte Angeklagte. Er ist ein Feind Trumps, was die politische Basis des Präsidenten jubeln lässt. Gleichzeitig liefert er einen Fall mit so viel Substanz, dass er den Anschein von Legitimität wahrt.
Der „gerechtfertigte“ Fall zur falschen Zeit
Die Tragik in Boltons Anklage liegt in ihrer Vorgeschichte. Die Ermittlungen gewannen bereits unter der Biden-Administration an Fahrt, lange bevor Trump seinen Rachefeldzug wieder aufnahm. Karriere-Staatsanwälte sahen hier einen „gerechtfertigten“ Fall von nationaler Tragweite. Doch die Trump-Administration hat diesen legitimen Fall nun gekapert. Berichten zufolge gab es massiven politischen Druck, die Anklage schnell fertigzustellen, um sie zeitgleich mit den schwachen Fällen gegen Comey und James zu präsentieren. Bolton wird zum nützlichen Kollateralschaden. Seine Anklage soll die politisch motivierten Säuberungen gegen andere legitimieren – seht her, wir verfolgen jeden, auch „eigene“ Leute (obwohl Bolton das längst nicht mehr ist).
Das CIPA-Gespenst: Wie man einen Prozess ausbremst
Bolton, der sich nun öffentlich mit Comey und James solidarisiert und von politischer Verfolgung spricht, wird dennoch jede juristische Möglichkeit nutzen. Seine Verteidigung wird sich zweifellos auf die politische Eile der Anklageerhebung stürzen. Vor allem aber steht ihm ein Werkzeug zur Verfügung, das sein ehemaliger Chef meisterhaft zu nutzen wusste: das Classified Information Procedures Act (CIPA). Dieses Gesetz regelt den Umgang mit geheimen Beweismitteln in Gerichtsverfahren. Es ist ein notorisch komplexes und langwieriges Verfahren, das geschaffen wurde, um die nationale Sicherheit zu schützen, aber oft als taktisches Minenfeld zur Verzögerung von Prozessen genutzt wird. Es ist die Ironie dieser Geschichte: Bolton könnte seinen Prozess durch CIPA genauso effektiv ausbremsen, wie Trump es im Mar-a-Lago-Fall tat. Der Rechtsstaat stellt ihm die Waffen zur Verfügung, die er braucht, um sich gegen einen Prozess zu wehren, der zwar in der Sache begründet, im Kontext aber zutiefst heuchlerisch ist.
Das Urteil über die Justiz
Am Ende steht nicht nur John Bolton vor Gericht. Es ist das amerikanische Justizministerium selbst. Das Dilemma ist unauflöslich: Verfolgt das Ministerium einen substanziellen Fall wie den von Bolton, spielt es Trumps politischer Agenda in die Hände und untermauert den Vorwurf der Heuchelei, solange andere ungeschoren davonkommen. Lässt es den Fall fallen, signalisiert es, dass hochrangige Beamte über dem Gesetz stehen. In diesem Chaos zerfällt das Vertrauen in die Neutralität des Rechts. Wenn Gesetze nur noch selektiv angewandt werden, verkommen sie zu bloßen Machtinstrumenten. Die Anklage gegen John Bolton mag juristisch stark sein, doch im vergifteten Klima der Rachejustiz wirkt sie wie ein weiterer Schlag gegen das Fundament, auf dem die Demokratie ruht.


