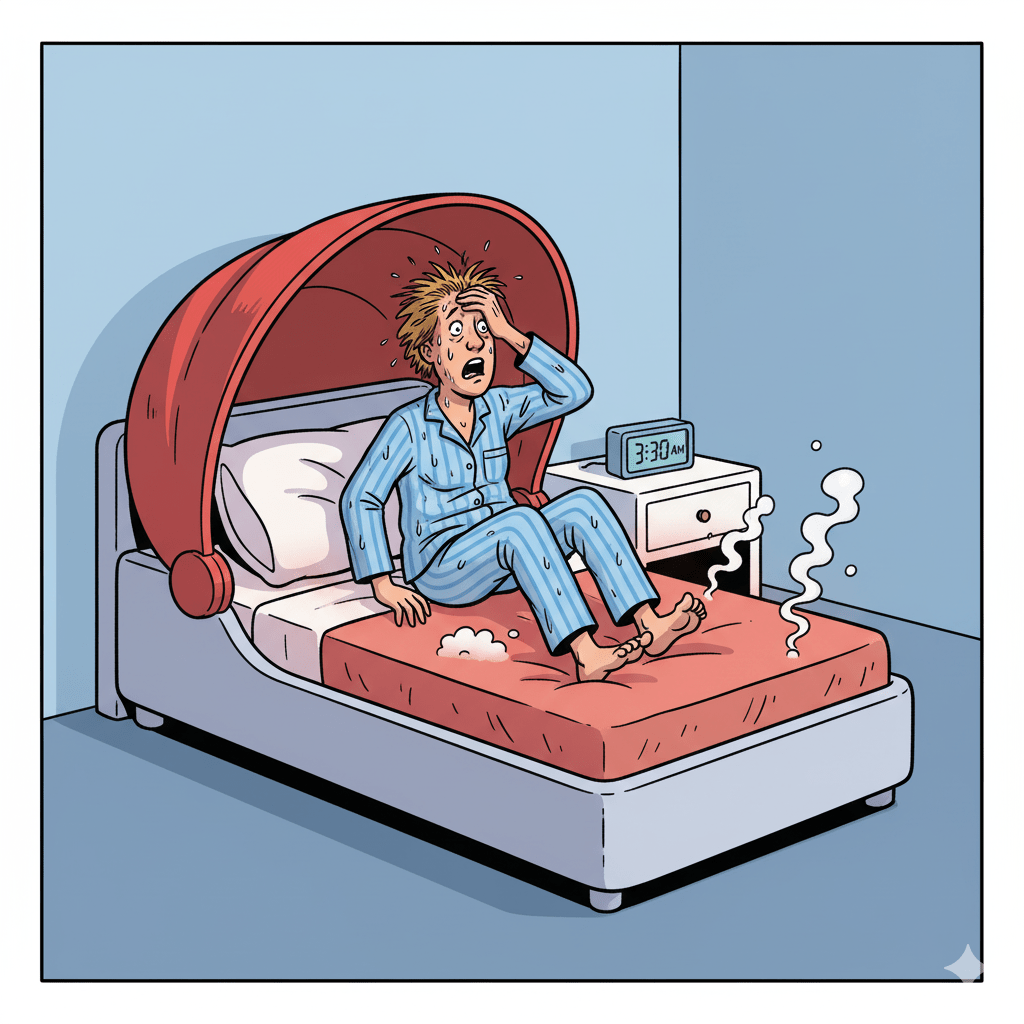Es beginnt oft im Kleinen, mit einer Unstimmigkeit, die kaum der Rede wert scheint. Eine unerwartete Gebühr bei einer alltäglichen Transaktion, ein administratives Hindernis, das plötzlich auftaucht. Für einen Einzelnen mag es nur ein Ärgernis sein, doch bei genauerem Hinsehen entpuppt es sich als rechtswidrig. Und in dieser kleinen, fast banalen Episode spiegelt sich das ganze Drama der amerikanischen Demokratie in der zweiten Amtszeit von Donald Trump. Es ist die Geschichte einer Regierung, die gezielt Grenzen überschreitet und vollendete Tatsachen schafft, deren Rückabwicklung so chaotisch und aufwendig wäre, dass der Rechtsstaat vor der schieren Masse der Rechtsbrüche zu kapitulieren droht. Was wir erleben, ist kein lauter Putsch, kein gewaltsamer Umsturz. Es ist etwas Subtileres, aber vielleicht Gefährlicheres: ein Staatsstreich in Zeitlupe, ausgeführt mit den Werkzeugen des Rechts, die zu Waffen gegen den Rechtsstaat selbst umfunktioniert werden. Die zentrale These dieses Angriffs lautet: Donald Trump demontiert die amerikanische Gewaltenteilung nicht, indem er sie offen zerschlägt, sondern indem er sie von innen aushöhlt. Sein sogenannter Cheat Code ist die Erfindung und Proklamation permanenter, fiktiver Notstände, die ihm als Generalschlüssel dienen, um die vom Kongress und der Verfassung gesetzten Schlösser zu umgehen. Gestützt auf einen willfährigen juristischen Apparat und eine gelähmte Legislative, testet er nicht nur die Grenzen seiner Macht aus – er verschiebt sie systematisch, bis die ursprünglichen Konturen der Republik kaum noch erkennbar sind.
Der Architekt und sein willfähriger Baumeister
Um die Radikalität von Trumps zweiter Amtszeit zu verstehen, muss man einen Blick in den juristischen Maschinenraum des Weißen Hauses werfen. In seiner ersten Amtszeit gab es noch Figuren wie den Rechtsberater Donald F. McGahn, der als eine Art institutionelles Gewissen fungierte. McGahn, so wird berichtet, stieß wiederholt mit dem Präsidenten zusammen und widersetzte sich dessen Versuchen, die Russland-Ermittlungen zu behindern. Er war ein Avatar jener Kräfte, die glaubten, der Präsident müsse eingehegt werden. Heute ist dieser Posten besetzt von David Warrington, einem Mann ohne Regierungserfahrung, dessen Ansatz das genaue Gegenteil von Widerstand ist: Er ist ein Ermöglicher. Warrington beschreibt seine Rolle nicht als die eines Wächters über die Verfassung, sondern als die eines Dienstleisters für den Präsidenten. Seine Aufgabe, so sagt er, sei es, dem Präsidenten die rechtliche Landschaft zu erklären, Risiken zu minimieren und Wege aufzuzeigen, wie dessen Wünsche umgesetzt werden können. Die finale Entscheidung treffe allein der Präsident. „Dave führt nicht mit der Antwort ‚Nein‘“, beschreibt ihn ein Berater. „Stattdessen heißt es: ‚Lasst uns herausfinden, was im Bereich des Möglichen liegt.‘“ Dieser Wandel ist kein Zufall, sondern Strategie. Trumps Team hat nach der ersten Amtszeit gezielt dafür gesorgt, nur noch solche Personen in Schlüsselpositionen zu berufen, die bereit sind, eine aggressive Agenda ohne Zögern zu unterstützen. Warrington ist die Personifizierung dieses Prinzips. Wo einst ein Warner stand, sitzt nun ein Wegbereiter. Das Ergebnis ist ein Weißes Haus, in dem, wie es ein Kritiker formuliert, „keine Erwachsenen mehr im Raum sind“. Die internen Kontrollmechanismen, die einst als Puffer zwischen dem impulsiven Willen eines Präsidenten und dem Gesetz standen, sind erodiert. Der Baumeister, der die Pläne des Architekten umsetzt, stellt nicht mehr die Frage nach dem „Ob“, sondern nur noch nach dem „Wie“.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Der Generalschlüssel zur Macht: Amerikas Notstands-Maschinerie
Das „Wie“ findet die Trump-Administration vor allem in einem Instrument, das ursprünglich für die seltensten und gravierendsten Krisen gedacht war: der Ausrufung des nationalen Notstands. In der amerikanischen Rechtsordnung schlummern über 130 Gesetze, die dem Präsidenten im Falle einer Krise außergewöhnliche Befugnisse verleihen. Diese Macht war historisch durch drei Leitplanken begrenzt: den verantwortungsbewussten Charakter der Präsidenten, die strenge Kontrolle durch den Kongress und die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung. Unter Trump sind alle drei Dämme gebrochen. Er hat die Notstandsgesetze zu seinem politischen Allzweckwerkzeug gemacht, um die Autorität des Kongresses in zentralen Bereichen auszuhebeln. Die Begründungen dafür sind oft so dünn, dass sie bei näherer Betrachtung kollabieren, doch das scheint keine Rolle zu spielen. Um massive Zölle auf Importe zu erheben – eine Macht, die laut Verfassung primär dem Kongress zusteht – deklarierte Trump die seit Jahrzehnten bestehenden Handelsdefizite der USA kurzerhand zu einer „außergewöhnlichen und ungewöhnlichen Bedrohung für die nationale Sicherheit und Wirtschaft“. Ein Bundesberufungsgericht hat diese Argumentation als unhaltbar zurückgewiesen. Um das Militär im Inneren gegen Migranten einsetzen zu können, stuft die Regierung die Lage an der Südgrenze als „Invasion“ ein, was den Einsatz der Nationalgarde in amerikanischen Städten rechtfertigen soll. Und um die Kontrolle über die Polizeikräfte der Hauptstadt Washington D.C. zu übernehmen, rief Trump einen Kriminalitätsnotstand aus und behauptete wahrheitswidrig, die Kriminalität sei „außer Kontrolle“, obwohl Statistiken das Gegenteil belegten. In jedem dieser Fälle wird die Realität nicht mehr als Grundlage für Politik genommen, sondern für politische Zwecke neu erfunden. Der Notstand ist keine objektive Lage mehr, sondern ein performativer Akt, ein Zauberwort, das die Fesseln der Verfassung lösen soll.
Die Strategie des vollendeten Chaos
Was passiert jedoch, wenn ein Gericht den Zauber durchschaut und eine dieser Maßnahmen für illegal erklärt? Hier greift die zweite Stufe von Trumps Strategie: das Prinzip des kalkulierten Chaos. Die Regierung schafft bewusst eine Situation, in der die Rückabwicklung ihres rechtswidrigen Handelns mit so immensen administrativen und wirtschaftlichen Verwerfungen verbunden wäre, dass selbst die Gerichte davor zurückschrecken, auf einer vollständigen Korrektur zu bestehen. Das Beispiel der illegalen Zölle illustriert dies perfekt. Allein im ersten Halbjahr 2025 hat die US-Regierung 94 Milliarden Dollar an solchen Zöllen eingenommen. Dieses Geld wurde nicht direkt von Importeuren an den Staat gezahlt, sondern über eine unüberschaubare Kette von Logistikfirmen, Händlern und letztlich Millionen von Konsumenten eingetrieben. Wie soll dieser Prozess umgekehrt werden? Die Regierung müsste gigantische Summen an die Logistikfirmen zurückzahlen, die diese wiederum an Millionen von Kunden weiterleiten müssten. Doch was, wenn eine dieser Firmen wegen ebenjener unberechenbaren Zollpolitik das US-Geschäft bereits aufgegeben hat? Soll ein Unternehmen, das vor dem staatlichen Chaos geflohen ist, gezwungen werden, sich erneut in dessen Mahlwerk zu begeben, nur um alles rückwärts abzuwickeln? Die Regierung konfrontiert die Justiz mit einer perfiden Wahl: Entweder sie lässt den Rechtsbruch bestehen und opfert damit die Verfassung. Oder sie besteht auf Recht und Gesetz und riskiert ein administratives und wirtschaftliches Desaster, das am Ende unzählige Bürger und Unternehmen treffen würde. Das Chaos ist hier kein unbeabsichtigter Nebeneffekt. Es ist das Ziel. Es ist die Versicherungspolice gegen die Herrschaft des Rechts.
Wenn die Leitplanken der Demokratie brechen
Diese Strategie kann nur funktionieren, weil die traditionellen Schutzmechanismen der amerikanischen Republik versagen. Der historische Vergleich macht die heutige Krise besonders deutlich. Als Präsident Harry Truman 1952 versuchte, die Stahlindustrie während des Koreakrieges zu verstaatlichen, tat er dies ebenfalls unter Berufung auf einen nationalen Notstand. Doch damals griffen die Leitplanken: Der Kongress hatte zuvor ein Gesetz verabschiedet, das die präsidialen Befugnisse in diesem Bereich klar einschränkte. Und der Supreme Court schritt ein und erklärte Trumans Handeln mit einer klaren 6:3-Entscheidung für verfassungswidrig. Heute ist das Bild ein anderes. Der Kongress, weit davon entfernt, Trump zu kontrollieren, agiert in weiten Teilen als sein größter Unterstützer. Statt seine verfassungsmäßigen Rechte zu verteidigen, schaut er tatenlos zu, wie die Exekutive sich die Macht über den Geldbeutel und die Handelspolitik aneignet. Die Gerichte sind zwar ein Schlachtfeld, aber sie agieren zögerlich und uneinheitlich. Während untere Instanzen Trumps Maßnahmen oft blockieren, zeigt sich der von ihm geprägte Supreme Court weitaus gewogener, die präsidiale Macht auszuweiten. Oft verweigern sie eine inhaltliche Prüfung der Notstandsbegründungen und gewähren dem Präsidenten einen fast unbegrenzten Ermessensspielraum – eine Haltung, die vor wenigen Jahrzehnten noch undenkbar gewesen wäre. Und schließlich die Person des Präsidenten selbst: Trump agiert ohne die inneren Bremsen, ohne jenes Gespür für Tradition und Zurückhaltung, das selbst seine machtbewusstesten Vorgänger noch auszeichnete. Die Kombination aus einem hemmungslosen Präsidenten, einem ergebenen Kongress und einer zögerlichen Justiz hat ein Machtvakuum geschaffen, in das Trump mit aller Kraft vorstößt.
Der Griff nach dem Herzen des Systems: Angriff auf die Unabhängigkeit
Die Ausdehnung der Macht beschränkt sich nicht auf Notstandsdekrete. Sie zielt auf die Grundpfeiler des Staates: die Unabhängigkeit seiner Institutionen. Nirgendwo wird dies deutlicher als beim beispiellosen Versuch, eine Gouverneurin der Federal Reserve, Lisa Cook, zu entlassen. Die US-Notenbank wurde bewusst als unabhängige Institution konzipiert, um die Geldpolitik vor dem kurzfristigen Druck der Tagespolitik zu schützen. Ihre Gouverneure können nur aus wichtigem Grund entlassen werden, ein Schutz, der ihre Autonomie garantieren soll. Trump versucht nun, diese rote Linie zu überschreiten. Er wirft Cook vor, Jahre vor ihrer Ernennung falsche Angaben bei Hypothekenanträgen gemacht zu haben – eine Begründung, die von Cook als vorgeschobener Vorwand bezeichnet wird, um das Gremium mit loyalen Personen zu besetzen, die seinen Wünschen nach niedrigeren Zinsen folgen würden. Sollte dieser Schritt vor den Gerichten Bestand haben, wäre dies mehr als nur eine Personalentscheidung. Es wäre ein Signal, dass keine Institution, mag sie noch so bewusst auf Unabhängigkeit ausgelegt sein, vor dem direkten Zugriff des Präsidenten sicher ist. Es wäre die Unterwerfung der ökonomischen Vernunft unter den politischen Willen. Am Ende laufen alle Fäden an einem Punkt zusammen. Die ungerechtfertigte Zollgebühr, die fadenscheinige Begründung für den Einsatz von Soldaten in amerikanischen Städten, die Entlassung einer unliebsamen Notenbankerin – all dies sind Symptome desselben tiefgreifenden Problems. Wir sind Zeugen eines methodischen Versuchs, die amerikanische Republik von einer Demokratie der Institutionen und des Rechts in eine Autokratie des Willens zu verwandeln. Die Frage, die sich am Ende stellt, geht weit über die Person Donald Trumps hinaus. Es geht um die Widerstandsfähigkeit einer Verfassung, die für eine Welt des Kompromisses und der gegenseitigen Kontrolle geschrieben wurde, nun aber mit einer Macht konfrontiert ist, die diese Regeln nicht nur bricht, sondern das Spiel selbst verändern will. Die Gerichte mögen noch einzelne Schlachten gewinnen, aber der Krieg um die Seele der amerikanischen Demokratie wird an einer anderen Front entschieden: in der Frage, ob die Präzedenzfälle, die heute geschaffen werden, morgen zur neuen Normalität werden. Die Frage ist nicht mehr nur, ob die Dämme brechen. Sondern ob überhaupt noch jemand da ist, der sie reparieren will, wenn das Wasser erst einmal über die Ufer getreten ist.