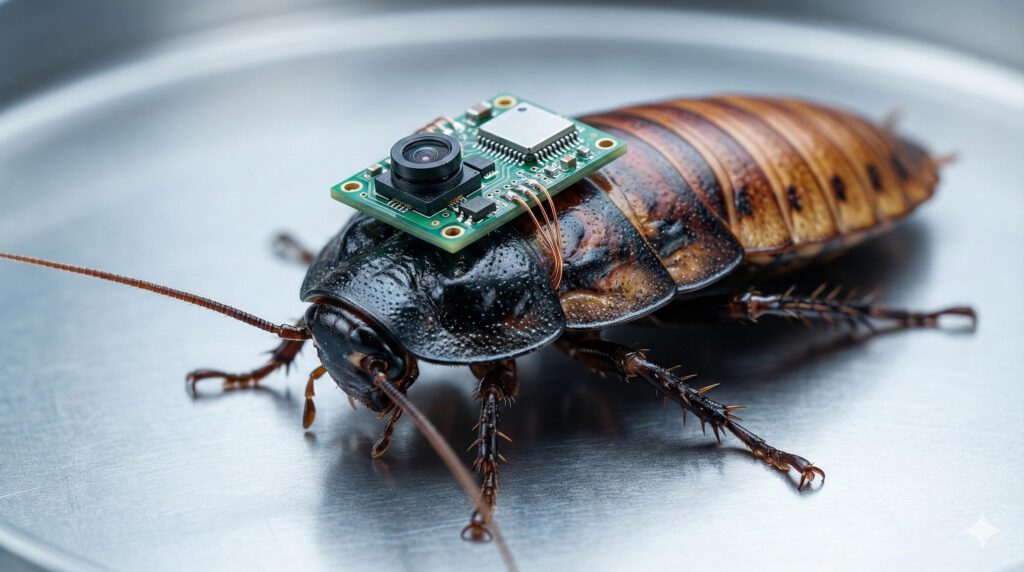Im Herbst 2025 erleben die Vereinigten Staaten ein ökonomisches Schauspiel, das an ein Vexierbild erinnert. Je nachdem, wie man es hält, zeigt es ein anderes Bild. Fragt man das Weiße Haus, ist die Inflation besiegt, ein Triumph der eigenen Politik, festgehalten bei kühlen 2,3 Prozent. Fragt man Ökonomen, die Federal Reserve oder blickt auf die offiziellen Daten des Bureau of Labor Statistics (BLS), zeigt sich ein anderes Bild: eine hartnäckige Teuerung von 2,9 bis 3,0 Prozent.
Diese Differenz ist weit mehr als eine akademische Spitzfindigkeit. Sie ist der Kern einer tiefen Spaltung, nicht nur der Wirtschaft, sondern der Realitätswahrnehmung selbst. Es ist eine Krise, die durch aggressive Handelspolitik befeuert und durch einen lähmenden „Government Shutdown“ potenziert wird.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Während die Trump-Administration eine ökonomische Erfolgsgeschichte erzählt, kämpft die Notenbank (Fed) im Nebel um Stabilität, und die Bürger bezahlen die Zeche für eine Politik, die Fakten erst manipuliert und dann ihre Erhebung blockiert. Die USA befinden sich in einem selbstgemachten Sturm – einem Blindflug, bei dem das Cockpit absichtlich demontiert wird.
Die zwei Bücher der Inflation: Ein Kampf um die Wahrheit
Der Streit um die Inflationsrate ist im Kern ein Streit um die Methodik. Die Zahl, die monatlich Schlagzeilen macht – aktuell 3,0 Prozent – ist der Consumer Price Index (CPI). Er folgt einer simplen, robusten Regel: Er vergleicht die Preise von heute mit denen von vor genau zwölf Monaten. Dieses Verfahren glättet kurzfristige Ausschläge, etwa einen plötzlichen Ölpreisschock, und zeigt den wahren, langfristigen Trend der Teuerung. Es ist das Maß, an dem die Federal Reserve ihre Politik ausrichtet.
Die 2,3-Prozent-Zahl des Weißen Hauses entsteht fundamental anders. Sie basiert auf „Annualisierung“. Dabei nehmen die Statistiker der Regierung einen sehr kurzen Zeitraum – in diesem Fall die sieben Monate von Januar bis August 2025 – und rechnen diesen Trend auf ein ganzes Jahr hoch. Das Problem: Diese Methode ist extrem anfällig für kurzfristige Verzerrungen und saisonale Schwankungen. Sie ist keine Messung, sondern eine Wette – eine Wette darauf, daß die nächsten fünf Monate exakt so verlaufen wie die letzten sieben. Wie trügerisch das ist, zeigt der Blick zurück: Wendete man dieselbe Methode auf das Jahr 2024 an, hätte die Prognose bei 4,2 Prozent gelegen; die Realität war jedoch ein deutlich niedrigerer Wert von 2,6 Prozent.
Die Nutzung dieser unüblichen Metrik verfolgt ein klares politisches Motiv: Sie soll die Botschaft untermauern, die Inflation sei „besiegt“. Doch während die Politik eine Zahl feiert, spüren die Bürger die Realität der 12-Monats-Sicht: Die Kosten für das tägliche Leben liegen kumuliert etwa 25 Prozent über dem Niveau von vor der Pandemie.
Der unsichtbare Preistreiber: Wie Tarife die Inflation anheizen
Gleichzeitig gießt die Administration Öl ins Feuer, das sie zu löschen behauptet. Die aggressive Handelspolitik mit hohen Tarifen auf Importgüter wird als wirtschaftlicher Schutzwall verkauft, der keine nennenswerten Kosten verursache. Doch die Daten erzählen eine andere Geschichte.
Unternehmen, von globalen Konzernen bis zu kleinen Importeuren, sahen sich gezwungen, die immensen Zollkosten zu bewältigen. Lange Zeit funktionierte das System wie ein gigantischer Stoßdämpfer. Bis August absorbierten die Unternehmen etwa 51 Prozent der Tariffolgen selbst, indem sie ihre eigenen Profitmargen beschnitten. Weitere 9 Prozent konnten sie an ihre (oft ausländischen) Lieferanten weiterreichen. Nur 37 Prozent landeten bis dahin direkt beim Konsumenten.
Doch dieser Dämpfer ist müde. Der Gummi ist porös. Die Signale aus den Chefetagen sind eindeutig: Der Kostendruck ist nicht mehr zu halten. Unternehmen, ob im Möbelbau, der Automobilindustrie oder der Spielzeugherstellung, kündigen an, die Preise erhöhen zu müssen. Der Kipppunkt, an dem die volle Wucht der Tarife auf die Verbraucherpreise durchschlägt, scheint erreicht.
Die Mechanismen sind dabei perfide. Große Konzerne wie General Motors (GM) nutzen ihre Marktmacht, um Lieferanten zu drücken, was deren Margen kollabieren läßt. Kleinere Betriebe, wie der Tee-Importeur „Two Leaves and a Bud“, haben diesen Puffer nicht; sie müssen die Preise drastisch erhöhen, um zu überleben.
Die Tarife wirken aber auch indirekt: Wenn Importstahl teurer wird, können heimische Stahlproduzenten wie Cleveland-Cliffs ihre eigenen Preise ebenfalls anheben und ihre Margen „polstern“. Der Verbraucher zahlt also doppelt: für teurere Importe und für teurere heimische Waren, die sich dem neuen Preisniveau anpassen.
Wenn das Monatsende zur Belastung wird
Diese 3 Prozent Inflation sind keine abstrakte Zahl in einem Statistikamt. Sie sind die Realität von Millionen Amerikanern, die versuchen, ihre Rechnungen zu bezahlen. Die größte Last bleibt das Wohnen. In Bundesstaaten wie New York und Kalifornien müssen die Menschen im Schnitt 36 Prozent ihres Einkommens allein für das Dach über dem Kopf aufwenden – weit jenseits der als tragbar erachteten 30-Prozent-Grenze. In Florida sind die Wohnkosten binnen eines Jahres um 8 Prozent explodiert.
Die Inflation spaltet die Gesellschaft. Während die Dienstleistungsinflation – etwa bei Flugreisen oder der Autoreparatur – hartnäckig hoch bleibt, trifft es die Menschen bei den Grundbedürfnissen am härtesten. Die Lebensmittelpreise, die Präsident Trump im Wahlkampf als Waffe gegen die Biden-Administration nutzte, steigen weiter. Die Kosten für Rindfleisch erreichten Rekordhöhen, auch weil Tarife auf Importe aus Ländern wie Brasilien die Preise treiben. Der ironische Vorschlag des Präsidenten, nun argentinisches Rindfleisch zu importieren, um die selbstgemachte Teuerung zu lindern, verärgert die eigenen US-Viehzüchter.
Selbst die staatlichen Hilfen werden zur Farce. Rentner und andere Sozialleistungsempfänger erhalten 2026 einen Inflationsausgleich (COLA) von 2,8 Prozent. Doch dieser Zuwachs dürfte bei vielen direkt wieder aufgefressen werden. Prognosen zufolge könnten allein die Prämien für Medicare Part B (die Arztbesuche abdeckt) um über 11 Prozent steigen – eine Erhöhung, die für den Durchschnittsrentner fast die Hälfte des COLA-Zuwachses neutralisiert.
Die Fessel der Notenbank
In diesem angespannten Umfeld blicken alle auf die Federal Reserve. Doch die Hüterin der Währung sitzt in einer geldpolitischen Zwickmühle, die perfider kaum sein könnte. Ihr offizielles Inflationsziel liegt bei 2 Prozent. Die Realität, selbst gemessen an ihrem bevorzugten Indikator (PCE), liegt bei 2,7 Prozent – und der CPI sogar bei 3,0 Prozent. Normalerweise wäre die Antwort klar: Die Zinsen müßten hoch bleiben oder steigen, um die Wirtschaft zu kühlen und die Teuerung einzufangen.
Doch die Fed blickt mit wachsender Sorge auf den Arbeitsmarkt. Die Dynamik kühlt ab, die Unternehmen zögern bei Neueinstellungen, auch bedingt durch die Unsicherheit der Tarife und restriktive Einwanderungspolitik. Aus Angst, die Konjunktur abzuwürgen, hat die Fed die Zinsen bereits gesenkt und weitere Schnitte signalisiert.
Es ist die Wahl zwischen zwei Übeln: Entweder sie bekämpft die Inflation und riskiert eine Rezession am Arbeitsmarkt, oder sie stützt den Arbeitsmarkt und akzeptiert, daß die Inflation sich bei 3 Prozent verfestigt. Es ist ein gefährlicher Spagat, den die Notenbank ohnehin schon vollführt – und nun wird ihr auch noch die Sicht genommen.
Blindflug im Shutdown: Wenn der Staat die Realität abschafft
Es ist, als würde man einem Piloten in einem schweren Sturm das Cockpit zertrümmern. Genau in dem Moment, in dem die Federal Reserve eine ruhige Hand und präzise Instrumente bräuchte, entzieht ihr der „Government Shutdown“ die Datengrundlage.
Weil die Finanzierung fehlt, sind die Mitarbeiter des Bureau of Labor Statistics (BLS) im Zwangsurlaub. Der September-Inflationsbericht konnte nur mit Not und Verspätung fertiggestellt werden, weil er gesetzlich für die Berechnung der Sozialversicherungsleistungen (COLA) notwendig war.
Doch für die Zukunft herrscht Finsternis. Das Weiße Haus hat bereits angekündigt, daß ein Inflationsbericht für Oktober „wahrscheinlich“ nicht erscheinen wird. Die Datensammler des BLS, die jeden Monat Tausende Geschäfte besuchen, um Preise zu erfassen, sitzen zu Hause.
Dieser Schaden ist nicht einfach reparabel. Man kann einen Job-Bericht vielleicht nacherheben, aber man kann nicht retroaktiv die Preise vom 10. Oktober in einem Supermarkt ermitteln. Die Fed verliert damit ihren „Gold Standard“, ihre wichtigste Referenz für geldpolitische Entscheidungen. Sie muß im Blindflug agieren, basierend auf alternativen, aber weniger robusten Daten.
Dies ist der Gipfel der wirtschaftspolitischen Absurdität im Herbst 2025. Eine Regierung treibt durch ihre Zollpolitik die reale Inflation an. Gleichzeitig versucht sie, durch statistische Manipulation eine politische Fiktion der „besiegten“ Inflation zu erzeugen. Und schließlich zerstört sie durch einen Shutdown die Fähigkeit der unabhängigen Notenbank, die wahre Inflation überhaupt noch zu messen und zu bekämpfen.
Die Frage ist nicht mehr nur, wie hoch die Inflation ist. Die Frage ist, wie eine Supermacht wirtschaften soll, wenn ihre Regierung den Unterschied zwischen Realität und Propaganda bewußt verwischt und die Instrumente zur Messung dieser Realität zerschlägt.