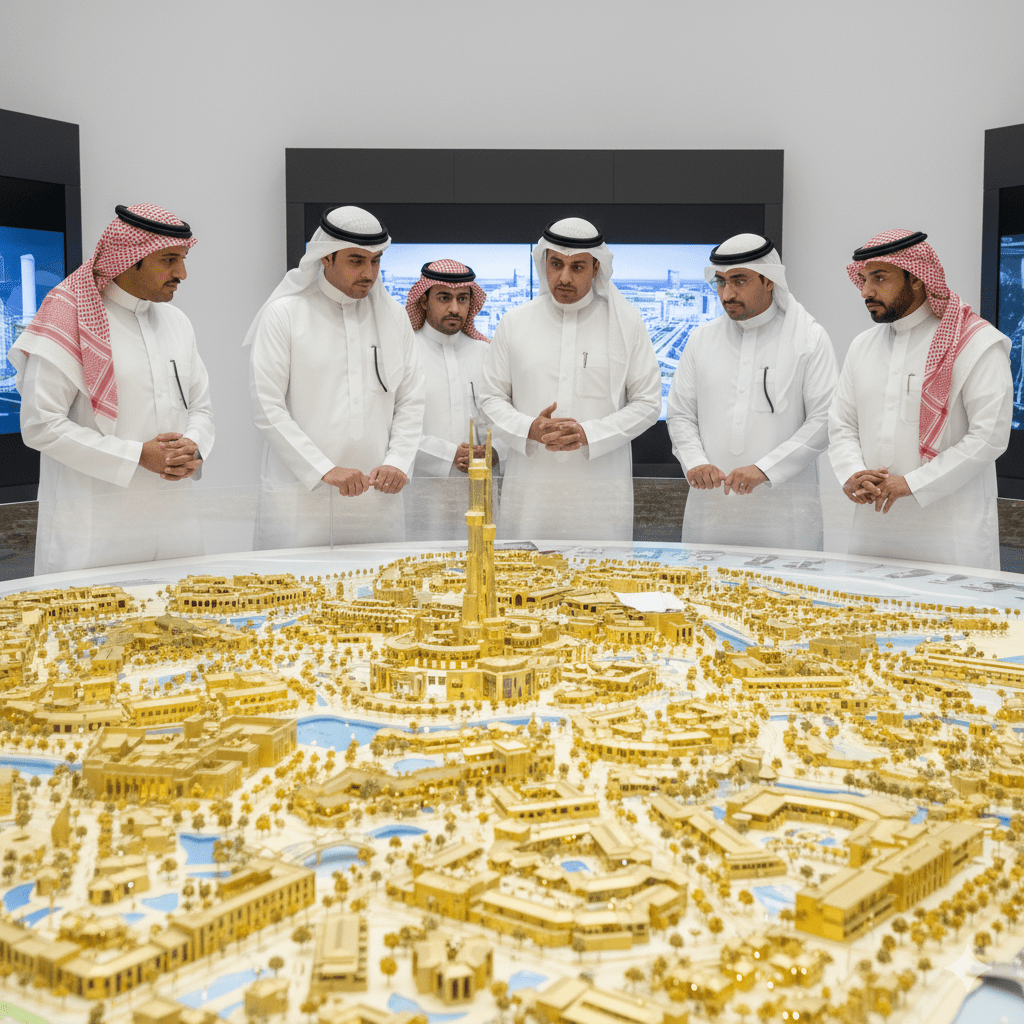Ein eisiger Wind weht über die Beringstraße, die einst das Russische Reich von seinem amerikanischen Außenposten trennte. Bald könnte dieser Wind Zeuge eines diplomatischen Manövers werden, das die geopolitische Landschaft Europas nachhaltig verändern könnte. In Alaska, jenem weiten Land, das die USA einst für einen Spottpreis von Russland erwarben, plant Präsident Donald Trump ein Treffen mit Wladimir Putin. Es ist ein Gipfel, der mit den ungeschriebenen Gesetzen der internationalen Diplomatie bricht und der von der vagen, aber folgenschweren Idee eines „Gebietstauschs“ überschattet wird. Ein Tausch, der den seit über drei Jahren wütenden Krieg in der Ukraine beenden soll – und der die Europäer in eine Mischung aus Furcht und fieberhafter Betriebsamkeit versetzt.
Denn was in Washington als pragmatischer Deal eines Immobilienmoguls im Weißen Haus verkauft wird, fühlt sich in Kyjiw, Berlin und Paris wie ein Déjà-vu an – eine dunkle Erinnerung an die Konferenz von Jalta, als die Großmächte über die Köpfe kleinerer Nationen hinweg die Welt neu ordneten. Die zentrale These, die sich aus dem Stimmengewirr der Diplomaten, Analysten und Politiker herausschält, ist beunruhigend: Donald Trumps Versuch, den Ukraine-Krieg durch einen schnellen, bilateralen Deal mit Wladimir Putin zu beenden, ist weniger ein genialer strategischer Schachzug als vielmehr ein hochriskantes Glücksspiel. Angetrieben von einem instinktiven Misstrauen gegenüber multilateralen Allianzen und dem unerschütterlichen Glauben an die eigene Verhandlungsmacht, droht er nicht nur die Souveränität der Ukraine zu opfern, sondern auch die transatlantische Sicherheitsarchitektur nachhaltig zu untergraben. Sein Vorgehen mag kurzfristig den Anschein von Entschlossenheit erwecken, doch es spielt letztlich Putins langfristigen strategischen Zielen in die Hände: der Spaltung des Westens und der schleichenden Neutralisierung der Ukraine.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Der Dealmaker im Weißen Haus: Trumps Abkehr von der alten Ordnung
Um das Beben zu verstehen, das Trumps Ankündigung in den europäischen Hauptstädten ausgelöst hat, muss man den Mann im Oval Office verstehen. Donald Trump agiert nicht wie ein traditioneller Staatsmann, der in den Bahnen etablierter diplomatischer Protokolle denkt. Sein Spielfeld ist nicht das geduldige, von unzähligen Vorgesprächen geprägte Ringen um Konsens. Er glaubt an den Durchbruch im persönlichen Gespräch, an die Kraft des Deals, den zwei starke Männer unter vier Augen aushandeln. Diese Philosophie, geschmiedet in der gnadenlosen Immobilienwelt von New York, überträgt er nun auf die Weltpolitik. Für ihn sind internationale Beziehungen ein Nullsummenspiel: Was der eine gewinnt, verliert der andere. Diese Haltung erklärt seine Ungeduld mit den Europäern und seine instinktive Hinwendung zu Putin. Während die Europäer auf Prozesse, Institutionen und gemeinsame Werte pochen, sieht Trump darin nur Ballast, der schnelle Lösungen verhindert. Seine Drohungen, wie die Androhung erdrückender Sanktionen, die er kurz vor der Gipfelankündigung kommentarlos verstreichen ließ, sind weniger Teil einer kohärenten Strategie als vielmehr taktische Manöver, um Druck aufzubauen. Sein Vorgehen folgt der sogenannten „Madman-Theorie“, die schon Richard Nixon für sich beanspruchte: die kalkulierte Unberechenbarkeit, die Drohungen glaubwürdiger machen soll, weil man dem Akteur alles zutraut. Friedrich Merz, so ein Analyst, könnte nicht glaubwürdig mit einem NATO-Austritt drohen – Trump schon. Diese Strategie mag in der Geschäftswelt kurzfristig erfolgreich sein, doch in der Geopolitik birgt sie immense Gefahren. Sie untergräbt das Vertrauen, das die Grundlage langfristiger Allianzen bildet. Trump verknüpft Handelsfragen mit Sicherheitsgarantien und spielt damit seine stärkste Karte aus: Europa ist militärisch von den USA abhängig. Ein Experte vergleicht sein Vorgehen treffend mit dem eines Schutzgelderpressers. Dieses Ungleichgewicht ist der Nährboden, auf dem der Alaska-Gipfel gedeiht – und die Quelle der europäischen Angst.
Das verwirrende Angebot aus Moskau: Ein diplomatisches Minenfeld
Im Zentrum der Verwirrung steht der Mann, der als Trumps „Supergesandter“ fungiert: Steve Witkoff. Ein Immobilienhändler aus New York, ein langjähriger Freund des Präsidenten, ohne jegliche diplomatische Erfahrung. Er ist der Architekt des Gipfels, doch seine Mission scheint von Anfang an von Missverständnissen und Inkompetenz geprägt zu sein. Nach einem Treffen mit Putin in Moskau präsentierte Witkoff den Europäern in mehreren Telefonkonferenzen offenbar drei unterschiedliche Versionen eines russischen Angebots. Zuerst war von einem umfassenden Gebietstausch die Rede: Russland ziehe sich aus den südlichen Regionen Cherson und Saporischschja zurück, dafür erhalte es den Rest des von der Ukraine kontrollierten Donbass. Dann wurde die Version korrigiert: Russland würde die Front im Süden nur „einfrieren“. Schließlich, nach insistierendem Nachfragen der konsternierten Europäer, blieb nur noch ein dürres Angebot übrig: ein Waffenstillstand als Gegenleistung für einen einseitigen Rückzug der Ukraine aus dem Donezker Gebiet. Nichts für die Ukraine, außer einer brüchigen Feuerpause, die Putin jederzeit brechen könnte. Diese chaotische Kommunikation hat das Vertrauen zwischen Washington und seinen Verbündeten schwer beschädigt. Sie zeigt nicht nur die Unerfahrenheit von Trumps Team, sondern auch, wie leicht sich dieses von Putin vorführen lässt. Kritiker sprechen von „schädlicher Inkompetenz“ und legen Witkoff nahe, künftig einen professionellen Protokollführer mitzunehmen. Doch das Problem liegt tiefer. Es offenbart eine amerikanische Administration, die bereit ist, über die fundamentalen Interessen ihrer Partner hinwegzugehen, verführt von der vagen Aussicht auf einen schnellen „Sieg“.
Ein Albtraum namens Jalta: Europas Kampf gegen die Bedeutungslosigkeit
Für die Ukraine und die europäischen Staaten ist das geplante Treffen ein Albtraum, der historische Wunden aufreißt. Die Formel „nichts über die Ukraine ohne die Ukraine“ war seit Beginn des Krieges das Mantra des Westens. Nun droht es, in der arktischen Kälte Alaskas zu erfrieren. Präsident Selenskyj, der in einem erbitterten Streit mit Trump im Oval Office bereits dessen Unzuverlässigkeit erfahren musste, reagierte scharf und unmissverständlich: Die ukrainische Verfassung verbiete die Abtretung von Territorium. Jede Lösung ohne die Ukraine sei eine „tote Lösung“. Die Europäer reagierten mit einer diplomatischen Offensive. In einem spontan anberaumten Krisentreffen im britischen Kent machten sie gegenüber US-Vizepräsident JD Vance ihre Bedingungen klar: Ein Waffenstillstand müsse vor jeglichen Verhandlungen stehen. Die Ukraine brauche robuste Sicherheitsgarantien, um als souveräner Staat zu überleben. Und wenn es zu einem Tauschhandel komme, müsse auch Russland besetztes Land aufgeben. Es ist der Versuch, einen ungeduldigen US-Präsidenten einzufangen, der sich als Friedensfürst inszenieren will und dabei die Interessen seiner Verbündeten zu vernachlässigen droht. Doch die Machtlosigkeit Europas ist greifbar. Man kann einen schlechten Deal zwar ablehnen und mit europäischer Hilfe weiterkämpfen, doch die Angst vor Trumps Reaktion ist groß. Er könnte erneut Waffenlieferungen stoppen und den Druck auf seine Partner erhöhen. Die Europäer befinden sich in einem Dilemma: Sie müssen Stärke zeigen, ohne die militärische Macht zu besitzen, diese glaubwürdig zu untermauern. Ihre Hoffnung ruht nun darauf, in den wenigen Tagen bis zum Gipfel noch auf Trump einwirken zu können – in der leisen Hoffnung, dass er am Ende nicht auf den Mann hört, mit dem er zuletzt gesprochen hat: Wladimir Putin.
Putins strategischer Sieg: Mehr als nur ein Stück Land
Während in Washington und Europa über die Details eines möglichen Gebietstauschs gerätselt wird, hat Putin bereits einen entscheidenden Sieg errungen. Allein die Tatsache, dass der Gipfel stattfindet, ist ein Triumph für den Kreml. Nach Monaten der Isolation kehrt Putin auf die Weltbühne zurück – und das zu seinen Bedingungen. Er hat es geschafft, Trump in ein bilaterales Format zu zwingen, in dem die Ukraine und Europa nur Nebenrollen spielen. Die Wahl Alaskas als Verhandlungsort, eines ehemaligen russischen Territoriums, ist dabei von beißender Ironie und symbolischer Sprengkraft. Putins Ziele gehen weit über die Annexion von ein paar weiteren Quadratkilometern hinaus. Analysten sind sich einig, dass es ihm um die „Ursachen der Krise“ geht, wie er es selbst verklausuliert ausdrückt. Das bedeutet: die vollständige Demilitarisierung der Ukraine, ihre Neutralität, das Ende jeglicher Westbindung und die Installation eines russlandfreundlichen Regimes. Der Donbass ist dabei nur ein Pfand. Ein Rückzug aus dem Süden scheint unwahrscheinlich, da dieser die strategisch wichtige Landbrücke zur Krim sichert. Sein Kalkül ist ebenso einfach wie brillant: Entweder er einigt sich mit Trump auf einen Deal, den dieser der Ukraine aufzwingt. Oder die Ukraine lehnt ab, woraufhin Trump Kiew die Schuld gibt und seine Unterstützung einstellt. In jedem Fall gewinnt Putin: Zeit, um seine militärische Position zu festigen, und einen tiefen Keil, den er zwischen die USA und Europa treibt. Das Treffen ist für ihn ein Instrument, um die westliche Allianz zu zersetzen – ein Ziel, das er seit Jahren mit strategischer Geduld verfolgt.
Das Schicksal des Donbass: Ein Bollwerk fällt
Die strategischen Implikationen eines ukrainischen Rückzugs aus dem Donbass wären verheerend. Es geht hier nicht nur um den Verlust von Territorium, in dem noch immer Hunderttausende Menschen leben. Es geht um den sogenannten „Festungsgürtel“ der Ukraine. Seit 2014 hat die ukrainische Armee hier massive Verteidigungsanlagen errichtet, die den russischen Vormarsch entscheidend verlangsamt haben. Ein freiwilliger Abzug aus diesem Gebiet würde Russland einen jahrelangen, blutigen Kampf ersparen. Mehr noch: Die Gebiete westlich des Donbass sind flach und offen, ohne nennenswerte natürliche Hindernisse wie Flüsse oder Hügel. Von dort aus wäre der Weg für russische Panzer in Richtung der strategischen Großstädte Dnipro und Charkiw frei. Ein solcher Deal würde die russische Armee nicht abschrecken, sondern ermutigen. Er würde sie in eine militärisch überlegene Position für zukünftige Angriffe versetzen. Die Ukraine würde ihr strategisches Rückgrat aufgeben und sich auf Gnade und Ungnade einem Nachbarn ausliefern, der wiederholt bewiesen hat, dass er keine Gnade kennt.
Die Last der Entscheidung: Zwischen Verfassung und Kriegsmüdigkeit
Präsident Selenskyj steht vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Einerseits ist er an die Verfassung gebunden, die territoriale Zugeständnisse verbietet. Jeder Versuch, dies zu ändern, würde eine landesweite Volksabstimmung erfordern – ein in Kriegszeiten kaum durchführbares Unterfangen. Andererseits wächst in der Bevölkerung die Kriegsmüdigkeit. Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass eine wachsende Zahl von Ukrainern, laut einer Erhebung sogar 69 Prozent, einen Verhandlungsfrieden befürwortet, selbst wenn dies territoriale Kompromisse bedeutet. Diese Diskrepanz zwischen verfassungsrechtlicher Pflicht, öffentlicher Stimmung und militärischer Realität engt Selenskyjs Handlungsspielraum dramatisch ein. Er muss den Widerstandswillen seines Volkes aufrechterhalten und gleichzeitig diplomatische Optionen offenhalten, ohne als Friedensverweigerer dazustehen. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Millionen Menschen leben unter russischer Besatzung, Hunderttausende Kinder werden einer systematischen Umerziehung unterzogen, und das volle Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen ist kaum absehbar. Gebiete abzutreten bedeutet, diese Menschen ihrem Schicksal zu überlassen – eine moralisch und politisch untragbare Vorstellung für jede ukrainische Regierung.
Ein unsicherer Frieden: Europas neue Realität
Selbst wenn in Alaska ein Wunder geschieht und ein Abkommen zustande kommt, wird es kein dauerhafter Frieden sein. Die europäischen Militärs gehen davon aus, dass Russland schon in wenigen Jahren wieder in der Lage sein wird, eine militärische Bedrohung für den Westen darzustellen. Die einzige realistische Sicherheitsgarantie für die Ukraine, abseits einer in der Ära Trump undenkbaren NATO-Mitgliedschaft, wäre, das Land in einen permanenten „Garrison State“ zu verwandeln – einen metaphorischen Stachelschwein, bis an die Zähne mit westlichen Waffen bewaffnet, um jeden zukünftigen Angriff abwehren zu können. Dies führt zu einer paradoxen Konsequenz: Während die USA ihre direkte finanzielle und militärische Präsenz in Europa zurückfahren wollen, werden amerikanische Rüstungskonzerne mehr denn je gefragt sein. Europa wird gezwungen sein, massiv in seine eigene Verteidigung zu investieren – ein Prozess, der durch Trumps Politik beschleunigt wird. Am Ende könnte Trumps erratisches Vorgehen genau das bewirken, was er eigentlich vermeiden will: eine stärkere, geeintere und militärisch potentere Europäische Union. Doch der Weg dorthin ist steinig und voller Gefahren. Die größte Gefahr bleibt, dass Trump in Alaska nicht nur ein Stück ukrainisches Land, sondern die Grundfesten der transatlantischen Partnerschaft aufs Spiel setzt. Wenn er Putins Beteuerungen, Frieden zu wollen, Glauben schenkt, könnte er denselben historischen Fehler begehen wie Neville Chamberlain 1938 in München. Ein Frieden, der auf der Appeasement-Politik gegenüber einem rücksichtslosen Aggressor basiert, ist selten mehr als eine kurze Atempause vor dem nächsten Sturm. Das diplomatische Spiel in Alaska hat gerade erst begonnen – doch für die Ukraine und Europa steht bereits alles auf dem Spiel.