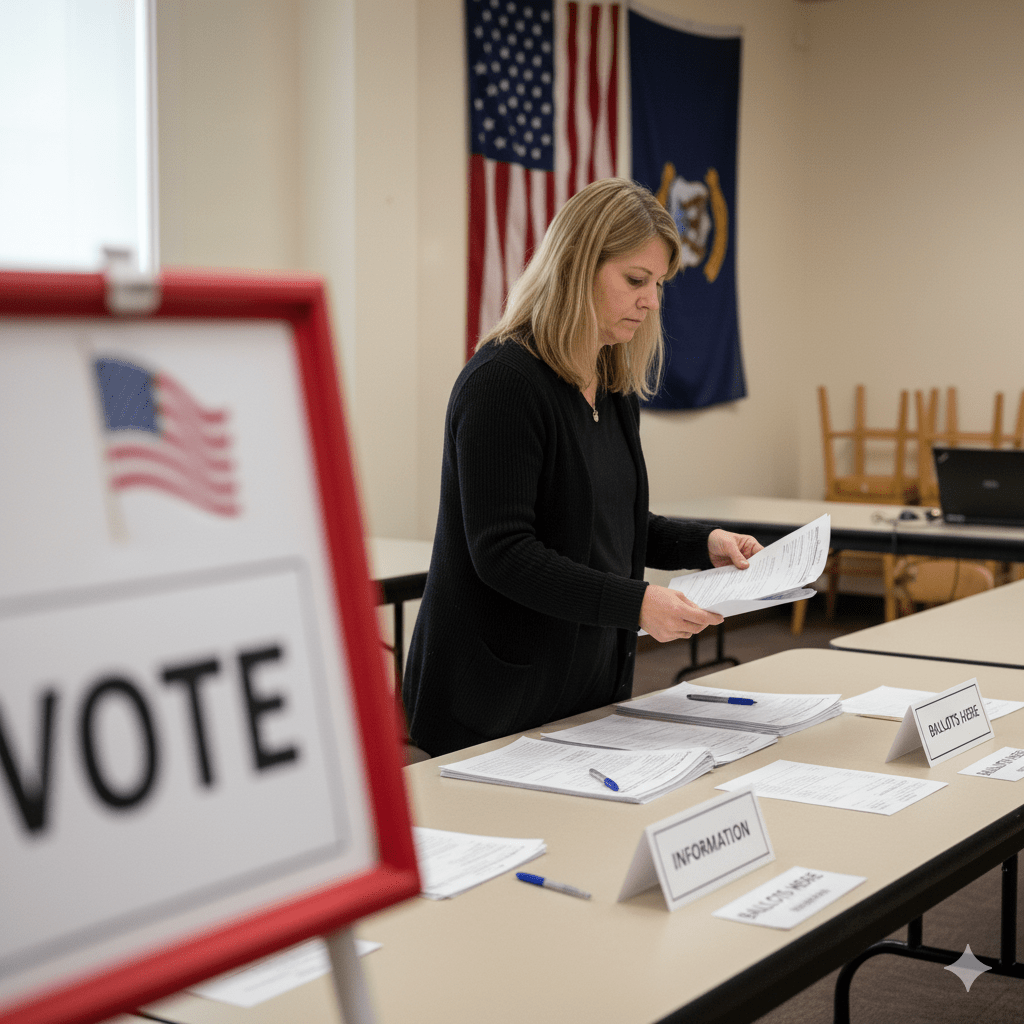Eine Staubwolke aus der Vergangenheit legt sich über die Gegenwart. Mit der Veröffentlichung von Tausenden von Dokumenten zum Attentat auf Dr. Martin Luther King Jr. inszeniert die Trump-Administration einen Akt scheinbarer Transparenz. Doch wer in diesen vergilbten, teils kaum leserlichen Seiten die endgültige Wahrheit über die Schüsse von Memphis zu finden hofft, wird enttäuscht. Dieser politisch aufgeladene Vorgang ist weniger eine historische Enthüllung als vielmehr ein Spiegel, der Amerikas aktuelle Zerrissenheit und seine unbewältigten Traumata scharf und unbarmherzig zurückwirft. Die Aktenfreigabe entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein zynisches Manöver, das mehr über die Mechanismen der Macht im 21. Jahrhundert aussagt als über die Verschwörungen des 20. Jahrhunderts. Sie zwingt uns, uns nicht nur mit dem Tod eines Mannes auseinanderzusetzen, sondern mit dem fortwährenden Kampf um sein Erbe – und mit dem Geist staatlicher Desinformation, der bis heute sein Unwesen treibt.
Die Bühne der Ablenkung: Ein Nebel aus alten Akten
Man muss kein Zyniker sein, um im Timing der Veröffentlichung eine wohlkalkulierte Strategie zu erkennen. In einem politischen Klima, in dem die Forderungen nach der Freigabe der brisanten Akten im Fall des Financiers Jeffrey Epstein immer lauter werden, wirkt die plötzliche Offenlegung der King-Dokumente wie ein geschickt platziertes Ablenkungsmanöver. Kommentatoren und selbst Kings Tochter Bernice sehen hier einen Versuch, die öffentliche Aufmerksamkeit umzulenken – von den potenziell kompromittierenden Geheimnissen der jüngeren Vergangenheit hin zu den längst erkalteten Spuren eines historischen Verbrechens. Die Regierung preist den Schritt als einen „Triumph der Transparenz“ und einen historischen Beitrag zur Wahrheit. Doch diese hochtrabende Rhetorik zerfällt bei der ersten Berührung mit der Realität zu Staub.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Denn was die National Archives da digitalisiert ins Netz gestellt haben, ist eine Sammlung, deren Inhalt von Ernüchterung geprägt ist. Historiker und Biografen wie David Garrow, die ihr Leben dem Studium von Kings Leben gewidmet haben, fanden nach einer ersten Durchsicht kaum etwas von öffentlichem Interesse, das nicht in irgendeiner Form bereits bekannt war. Die Dokumente – ein Sammelsurium aus Ermittlungsnotizen, alten Zeitungsausschnitten und Vernehmungsprotokollen – gleichen eher dem Kehricht eines riesigen, jahrzehntelang durchwühlten Archivs. Viele Seiten sind durch die Zeit und den Digitalisierungsprozess so verblasst, dass sie kaum noch zu entziffern sind. Das Bild, das sich hier bietet, ist nicht das einer glasklaren Enthüllung, sondern das eines trüben, aufgewirbelten Sediments. Es ist, als öffne man eine vermeintliche Schatztruhe, nur um darin verstaubte Belege für eine Suche zu finden, die längst woanders stattfindet.
Leere im Archiv: Was die Akten verschweigen
Die wahre Brisanz liegt nicht in dem, was die Dokumente enthalten, sondern in dem, was sie bewusst aussparen. Der Elefant im Raum, der unsichtbare Kern des Geheimnisses, sind die Tonbänder und Protokolle der unerbittlichen FBI-Überwachung von Martin Luther King Jr. Diese Aufnahmen, die intime Einblicke in Kings Privatleben, seine außerehelichen Beziehungen und seine strategischen Überlegungen geben könnten, bleiben auf richterliche Anordnung aus dem Jahr 1977 bis 2027 unter Verschluss. Ein Antrag des Justizministeriums, diese brisanten Materialien vorzeitig freizugeben, wurde erst kürzlich von einem Bundesrichter abgewiesen.
Diese entscheidende Leerstelle entlarvt den angeblichen Transparenz-Vorstoß als hohle Geste. Während die Regierung hunderttausende Seiten von geringem Nachrichtenwert freigibt, bleibt der eigentliche Sprengstoff sicher im Giftschrank der Geschichte verwahrt. Die Debatte wird somit an der Peripherie geführt, während das Zentrum im Dunkeln bleibt. Es ist eine staatlich sanktionierte Aufführung, die den Anschein von Offenheit erweckt, während die entscheidenden Beweismittel, die entweder die offizielle Version zementieren oder die Verschwörungstheorien belegen könnten, dem öffentlichen Diskurs entzogen werden. Die freigegebenen Akten sind somit nicht die Antwort, sondern nur ein weiteres, kompliziertes Kapitel in der langen Geschichte des Schweigens und der gezielten Informationssteuerung.
Hoovers langer Schatten: Die Waffe der Desinformation
Um die jetzige Veröffentlichung und die Reaktion der Familie King zu verstehen, muss man tief in die finsteren Ecken der amerikanischen Geschichte eintauchen, in eine Zeit, in der das FBI unter seinem Direktor J. Edgar Hoover einen regelrechten Krieg gegen die Bürgerrechtsbewegung führte. Hoover hegte, wie Kings Sohn es formulierte, einen „vehementen Hass“ auf den Bürgerrechtler und betrachtete ihn als Gefahr für die nationale Sicherheit. Die systematische Überwachung war kein neutraler Akt der Informationssammlung, sondern eine gezielte Kampagne, um kompromittierendes Material zu finden und King als moralische Instanz zu demontieren.
Aus diesem Grund warnen Experten und Kings Kinder eindringlich davor, die Inhalte der FBI-Akten für bare Münze zu nehmen. Sie sind nicht das Produkt objektiver Ermittlungsarbeit, sondern die „Früchte einer invasiven, räuberischen und zutiefst beunruhigenden Desinformations- und Überwachungskampagne“. Es besteht der begründete Verdacht, dass Agenten Material aufbauschten oder gar erfanden, um ihren Direktor zufriedenzustellen, der nach „Schmutz“ über King verlangte. Die berüchtigte anonyme Zusendung von Tonbändern an Kings Ehefrau Coretta Scott King im Jahr 1964, die seine Untreue belegen und ihn mutmaßlich in den Selbstmord treiben sollten, war der abscheuliche Höhepunkt dieser Kampagne. Diese Akten sind daher vergiftete Quellen. Ihre unkritische Verbreitung, so die Befürchtung der Familie, könnte unbeabsichtigt die Ziele von J. Edgar Hoover posthum vollenden: das Erbe Kings zu beschmutzen und die Legitimität der gesamten Bürgerrechtsbewegung zu untergraben.
Zwei Amerikas, zwei Wahrheiten: Der ungelöste Fall King
Der Mord an Martin Luther King Jr. hat die amerikanische Seele tief gespalten, und diese Kluft zieht sich bis heute durch die Gesellschaft. Auf der einen Seite steht die offizielle Version: Der Kleinkriminelle James Earl Ray war der alleinige Todesschütze. Die Beweise scheinen erdrückend: Er hatte King über Wochen verfolgt, eine Karte mit markierten Orten bei sich getragen, die Tatwaffe mit seinen Fingerabdrücken am Tatort zurückgelassen und war nach der Tat ins Ausland geflohen. Als mögliches Motiv wird ein von Rassisten aus St. Louis ausgesetztes Kopfgeld in Höhe von 50.000 Dollar gehandelt, auf das Ray es abgesehen haben könnte.
Doch auf der anderen Seite steht ein tiefes, unerschütterliches Misstrauen, das von Kings eigener Familie und Ikonen der Bürgerrechtsbewegung wie dem verstorbenen John Lewis geteilt wird. Sie sind überzeugt, dass Ray nur ein Sündenbock war, eine Figur in einer weitreichenden Verschwörung, an der Regierungskreise beteiligt waren. Diese Überzeugung ist so stark, dass die Familie King 1999 einen Zivilprozess anstrengte. Das Geschworenengericht in Memphis kam damals zu einem Urteil, das in direktem Widerspruch zu allen offiziellen Ermittlungen steht: Es befand, dass Loyd Jowers, ein Barbesitzer, zusammen mit Mafia- und Regierungsstellen in ein Komplott zur Ermordung Kings verwickelt war.
Diese unvereinbaren Narrative spiegeln sich selbst innerhalb der King-Familie wider. Während die Kinder Martin III und Bernice mit Schmerz und Misstrauen auf die Veröffentlichung reagieren und vor der Fortsetzung der Diffamierungskampagne ihres Vaters warnen, begrüßt ihre Cousine Alveda King, eine prominente Trump-Unterstützerin, die Freigabe als „historischen Schritt zur Wahrheit“. In diesem familiären Dissens zeigt sich im Kleinen das große Drama einer Nation, die sich nicht auf eine gemeinsame Wahrheit über einen der traumatischsten Momente ihrer Geschichte einigen kann.
Die jüngste Aktenfreigabe löst diesen Widerspruch nicht auf. Sie befeuert ihn. Sie liefert den Anhängern der offiziellen Version keine neuen, zwingenden Beweise und den Zweiflern keine endgültige Enthüllung. Stattdessen lässt sie beide Seiten in ihren Schützengräben zurück, bewaffnet mit alten Argumenten und einem tiefen Gefühl des Misstrauens gegenüber der Gegenseite. So bleibt der Fall King ein offenes Wundmal, ein Symbol für eine Nation im fortwährenden Streit mit sich selbst. Und vielleicht, so muss man am Ende fragen, ist gerade diese ungelöste Spannung, diese Unfähigkeit zur Versöhnung, das eigentlich bleibende Vermächtnis dieses tragischen Tages im April 1968.