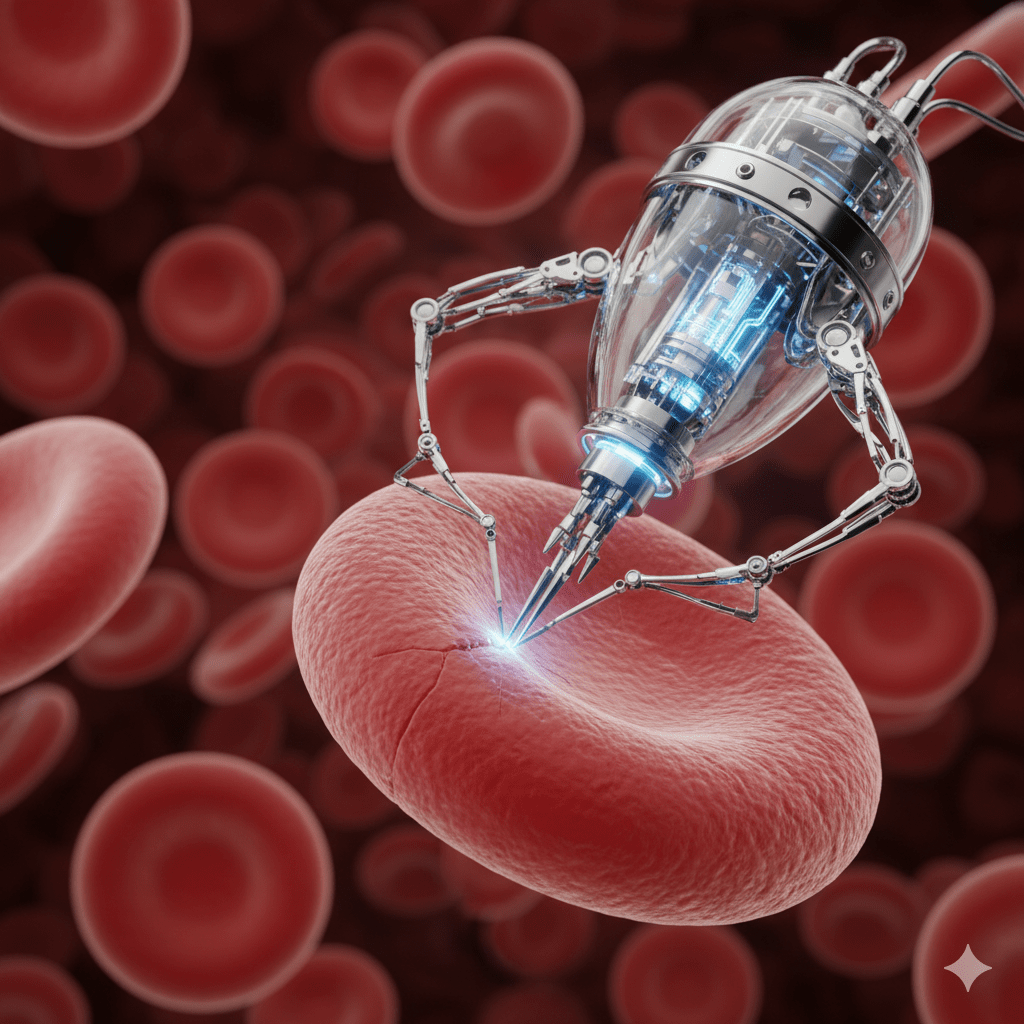Seit seinem Wiedereinzug ins Weiße Haus hat Präsident Donald Trump die Diskussion um eine mögliche dritte Amtszeit wiederholt befeuert und dabei die Grenzen der US-Verfassung offen in Frage gestellt. Gleichzeitig intensivieren sich seine Bemühungen, die exekutive Macht in einem Ausmaß auszuweiten, das Beobachter an die Fundamente der amerikanischen Demokratie rühren lässt. Diese Entwicklungen, gestützt auf eine scheinbar unerschütterliche Loyalität innerhalb der Republikanischen Partei, werfen ernste Fragen nach der Zukunft der Gewaltenteilung und der Einhaltung der Gesetze in den Vereinigten Staaten auf.
Wiederholte Andeutungen einer dritten Amtszeit nähren Verfassungssorgen
Was anfänglich als scherzhafte Bemerkung abgetan wurde, hat sich in den Äußerungen Donald Trumps zu einer wiederkehrenden Thematik entwickelt. Er selbst deutete in einem Interview an, dass seine Überlegungen zu einer dritten Amtszeit keineswegs als Witz zu verstehen seien und es „Methoden“ gäbe, die verfassungsmäßige Begrenzung auf zwei Amtszeiten zu umgehen. Spekulationen über solche Umgehungsstrategien reichen von einer Kandidatur seines Vizepräsidenten mit anschließender Amtsübergabe bis hin zu vagen Andeutungen über unkonventionelle Wege.
Diese Aussagen haben bei Demokraten Besorgnis ausgelöst und zu ersten Gegenmaßnahmen geführt. Der New Yorker Kongressabgeordnete Daniel Goldman plant eine Resolution, die klarstellt, dass die im 22. Verfassungszusatz festgelegte Begrenzung auf zwei Amtszeiten auch dann gilt, wenn diese nicht aufeinander folgen. Ziel ist es, jegliche verfassungsmäßige Schlupflöcher zu schließen und die Gültigkeit des Amendments auch für Donald Trump zu bekräftigen. Die Chancen für eine Verabschiedung dieser Resolution im von Republikanern kontrollierten Kongress gelten jedoch als gering.
Ungeachtet dessen zeigen sich in den Reihen der Republikaner auch unterstützende Stimmen für eine mögliche dritte Amtszeit Trumps. Einzelne Abgeordnete haben bereits Initiativen gestartet, die darauf abzielen, die Verfassung entsprechend zu ändern oder zumindest die Möglichkeit einer dritten Amtszeit öffentlich zu diskutieren. Diese Bemühungen, oft als Ausdruck einer ausgeprägten Pro-Trump-Haltung innerhalb der Partei interpretiert, spiegeln die tiefe Verankerung des ehemaligen Präsidenten in der republikanischen Basis wider.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Exekutive Machtdemonstration versus Rechtsstaat
Parallel zu den Diskussionen über eine dritte Amtszeit vollzieht sich unter Präsident Trump eine signifikante Ausweitung der exekutiven Macht. Beobachter sehen darin eine bewusste Missachtung rechtlicher Grenzen und eine Abkehr von etablierten Normen. So ordnete die Trump-Administration an, ein Gesetz zum Verbot der Social-Media-App TikTok nicht durchzusetzen und blockierte Migranten bei der Berufung auf ein Gesetz zur Beantragung von Asyl. Weiterhin wurden Schritte zur faktischen Schließung einer vom Kongress geschaffenen Bundesbehörde unternommen und vom Kongress genehmigte Ausgaben, einschließlich eines Großteils der Auslandshilfe, eingefroren.
Diese Maßnahmen, die zum Teil bereits Gegenstand zahlreicher Klagen sind, werden von Kritikern als „programmatische Sabotage und grassierende Gesetzlosigkeit“ bezeichnet. Die Weigerung, die Notwendigkeit eines Kongressbeschlusses zur Auflösung der Entwicklungshilfeorganisation USAID anzuerkennen, unterstreicht das Selbstverständnis einer Exekutive, die sich wenig durch die legislative Gewalt eingeschränkt sieht. Auch die Entlassung von Staatsanwälten, Generalinspekteuren und Aufsichtsratsmitgliedern unabhängiger Behörden, die gegen Regeln zum Schutz vor willkürlicher Entfernung verstoßen, wird als weiterer Beleg für diese Tendenz gewertet.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der verstärkten Berufung auf die sogenannte „Unitary Executive Theory“, eine Doktrin, die eine umfassende Kontrolle des Präsidenten über die gesamte Exekutive postuliert und Gesetze des Kongresses, die diese Kontrolle einschränken, als verfassungswidrig betrachtet. Die Einbindung von externen Beratern wie Elon Musk in Regierungsangelegenheiten, die mit der Ausübung exekutiver Macht einhergeht, wirft zusätzliche Fragen nach der Rechtmäßigkeit und Transparenz dieser Prozesse auf.
Ein weiteres Beispiel für die kontroverse Nutzung exekutiver Macht ist das von Präsident Trump erlassene Dekret zur „Wahlrechtsreform“. Dieses zielt darauf ab, die Anforderungen für die Wählerregistrierung zu verschärfen und die Gültigkeit von Briefwahlstimmen einzuschränken, was von Kritikern als Versuch gewertet wird, Millionen Amerikaner an der Stimmabgabe zu hindern und Erinnerungen an die diskriminierenden Jim-Crow-Gesetze weckt. Rechtsexperten bezweifeln die Verfassungsmäßigkeit solcher Eingriffe in die Organisation der Wahlen, die primär den Bundesstaaten und dem Kongress obliegt.
Reaktionen und Ausblick
Die aggressive Ausweitung der exekutiven Macht unter Präsident Trump stößt auf unterschiedliche Reaktionen. Während Demokraten in Kongress und Öffentlichkeit vehement die Einhaltung der Gesetze und die Verteidigung demokratischer Institutionen fordern, zeigen sich viele Republikaner weitgehend unterstützend oder schweigen zu den kontroversen Maßnahmen. Die Einreichung von Gesetzesinitiativen, die Präsident Trump ehren oder seine Macht weiter stärken sollen, demonstriert die starke Loyalität innerhalb der Partei.
Die rechtlichen Auseinandersetzungen um die exekutiven Maßnahmen der Trump-Administration werden voraussichtlich zunehmen und könnten letztendlich den Supreme Court beschäftigen. Die Haltung des von republikanischen Richtern dominierten Gerichtshofs könnte dabei entscheidend sein für die zukünftigeBalance zwischen präsidialer Macht und den Grenzen des Rechts.
Die wiederholten Andeutungen Donald Trumps bezüglich einer dritten Amtszeit in Verbindung mit seiner demonstrativen Ausweitung der exekutiven Macht stellen eine Herausforderung für die fundamentalen Prinzipien der US-amerikanischen Verfassung und Rechtsstaatlichkeit dar. Ob die demokratischen Institutionen und die verfassungsmäßigen Kontrollmechanismen diesen Tendenzen auf Dauer standhalten können, wird maßgeblich die Zukunft der amerikanischen Demokratie prägen. Die gegenwärtige politische Landschaft ist geprägt von einem tiefen Graben zwischen den politischen Lagern und einer zunehmenden Polarisierung, die eine konstruktive Auseinandersetzung mit diesen grundlegenden Fragen erschwert.