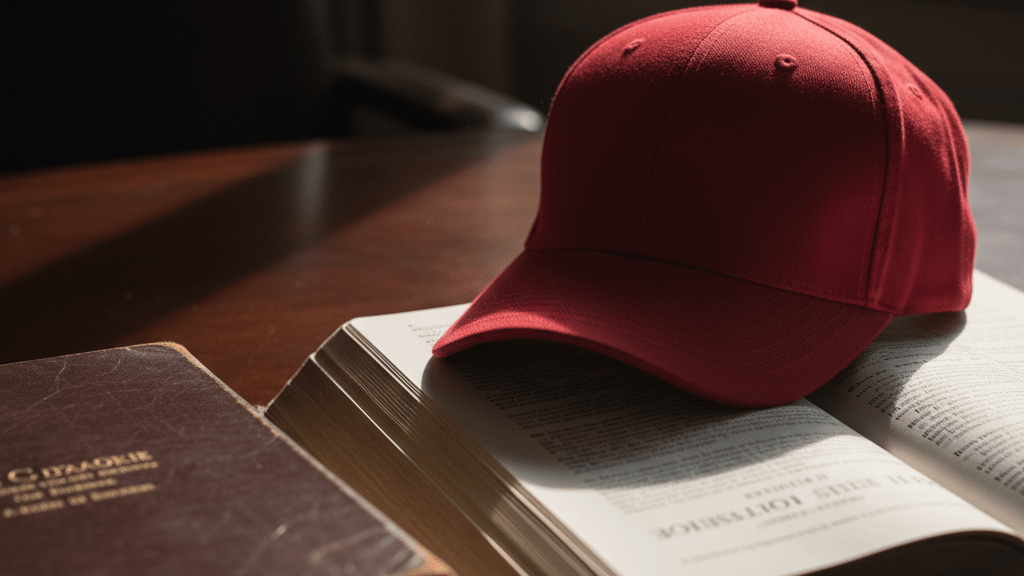
Es war ein Satz, der wie ein Schlußstrich klingen sollte, ein seltener Moment der Kapitulation vor der Realität. „Wenn man es liest, ist es ziemlich klar, ich darf nicht kandidieren.“ So sprach Präsident Donald Trump Ende Oktober 2025 an Bord der Air Force One. Es sei „schade“. Doch in der politischen Welt Trumps sind Schlußstriche selten endgültig; sie sind oft nur Pausen in einem längeren Monolog. Während der Präsident mit der einen Hand die Verfassung zu akzeptieren schien, warb die andere längst für „Trump 2028“-Kappen. Diese Kappen sind mehr als ein bizarrer Fan-Artikel. Sie sind das Symbol einer eskalierenden Debatte, einer kalkulierten Unschärfe, die den Kern der amerikanischen Demokratie berührt. Monatelang hat Trump, 79, die Idee einer dritten Amtszeit befeuert – mal als Witz, mal todernst. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, das weit über die bloße Provokation hinausgeht. Es ist ein systematischer Streßtest für die Verfassung, der eine beunruhigende Frage aufwirft: Ist die Rhetorik nur ein Mittel, um den Status einer „lahmen Ente“ (lame duck) zu vermeiden, oder erleben wir die Vorbereitung eines echten Verfassungsbruchs? Die Antwort liegt in der gefährlichen Grauzone zwischen dem, was gesagt, und dem, was nur gedacht wird; eine Debatte, die von zwei Polen gehalten wird: dem lauten „Trolling“ an der Oberfläche und den leisen, juristischen Planspielen in der Tiefe.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Der Lärm und der Plan: Trolling als politische Strategie
An der Oberfläche ist das Phänomen Trump ein Meisterwerk der Ablenkung. Für viele, einschließlich des Sprechers des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, ist die Sache klar: Trump „trollt“ die Demokraten. Die Kappen seien „eine der populärsten, die je produziert wurden“, und der Präsident habe „eine gute Zeit damit“, seine Gegner zur Weißglut zu treiben. Auch Late-Night-Moderatoren wie Seth Meyers sehen darin primär eine Provokation, die man nicht ernster nehmen dürfe als die Idee, die New York Jets würden den Super Bowl gewinnen. Diese Interpretation ist verlockend, denn sie ist beruhigend. Sie reduziert eine existenzielle Bedrohung auf eine politische Posse. Doch sie übersieht die strategische Brillanz dieser Taktik. Trump vermeidet es, als Präsident auf dem Abstellgleis wahrgenommen zu werden. Indem er die Möglichkeit einer Fortsetzung seiner Amtszeit in der Schwebe hält, bindet er die Aufmerksamkeit, hält seine Basis mobilisiert und zwingt die Medien, nach seinen Regeln zu spielen.
Doch unter dieser lärmenden Oberfläche gärt etwas anderes. Wenn Trump der Dirigent des Chaos ist, sind andere die Architekten. Allen voran Stephen K. Bannon, Trumps ehemaliger Chefstratege. Bannon, ein Mann, der für seine provokanten Äußerungen bekannt ist, verkündete unlängst, es gäbe einen „Plan“ für eine dritte Amtszeit. „Trump wird ’28 Präsident sein, und die Leute sollten sich einfach daran gewöhnen“, sagte Bannon dem Economist. Er sprach vage von „göttlichem Willen“ und versprach, der Plan werde „zur geeigneten Zeit“ enthüllt. Was wie der Größenwahn eines politischen Brandstifters klingt, zielt direkt auf Trumps loyalste Anhänger. Bannon liefert die ideologische Munition für das, was Trump durch Ambivalenz nährt. Er signalisiert der Basis: Gebt die Hoffnung nicht auf; die Eliten und ihre Regeln sind uns egal. Er ist derjenige, der die unausgesprochene Prämisse Trumps – daß Regeln für andere gelten – in eine konkrete Verheißung ummünzt. Welcher Plan das sein soll, bleibt im Dunkeln. Aber die bloße Behauptung seiner Existenz reicht aus, um die Verfassungsgrenzen als bloße Formalität erscheinen zu lassen.
Das juristische Nadelöhr: Warum „Wahl“ nicht „Amt“ bedeuten muß
Der wahre Kern der Debatte ist kein „Plan“ im Verborgenen, sondern ein offen sichtbares juristisches Nadelöhr. Es ist die „Nachfolge-Schlupfloch“-Theorie (succession loophole) – eine spitzfindige, aber nicht unmögliche Interpretation des 22. Zusatzartikels der US-Verfassung. Dieser Zusatzartikel, ratifiziert 1951, ist die direkte Reaktion auf Franklin D. Roosevelts vier Amtszeiten. Der Text ist scheinbar eindeutig: „Niemand darf mehr als zweimal in das Amt des Präsidenten gewählt werden“. Das Wort, auf das es ankommt, ist „gewählt“. Hier setzen die Umgehungsstrategen an: Der Verfassungszusatz, so ihre Lesart, verbietet nur die Wahl, nicht aber das Amtieren. Ein Präsident, der zweimal gewählt wurde, könnte demnach nicht mehr auf einem Wahlzettel stehen, aber er könnte sehr wohl durch Nachfolge ins Amt zurückkehren.
Das populärste Szenario, das auch Trump selbst durchspielte, ist die Vizepräsidentschaft. Trump könnte 2028 als Vizepräsidentschaftskandidat antreten, und der gewählte Präsident (etwa J.D. Vance oder Marco Rubio ) würde unmittelbar nach der Vereidigung zurücktreten, wodurch Trump zum Präsidenten aufrückte. Als Trump auf diese Theorie angesprochen wurde, lieferte er eine Antwort von bezeichnender Zweideutigkeit. Zuerst behauptete er: „Das wäre mir erlaubt“ („I’d be allowed to do that“). Fast im selben Atemzug wischte er die Idee aber beiseite: Er würde es nicht tun, es sei „zu raffiniert“ („too cute“) und „wäre nicht richtig“. Dies ist der Kern der Trump-Strategie: Er reklamiert die Legalität der Tat für sich, während er die Absicht bestreitet. Er testet das Wasser, normalisiert das Undenkbare und behält sich die Option vor, es als bloßen Scherz abzutun.
Juristisch ist die Lage heikler, als viele wahrhaben wollen. Zwar gibt es den 12. Zusatzartikel, der festlegt, daß niemand für das Amt des Vizepräsidenten wählbar ist, der nicht auch „verfassungsmäßig für das Amt des Präsidenten wählbar (eligible)“ ist. Doch die Verfechter des Schlupflochs argumentieren, daß Trump ja „wählbar“ (eligible) für das Amt sei – eben durch Nachfolge, nur nicht durch Wahl (election). Analysten warnen vor einem „textualistischen“ Richter. Ein solcher Richter könnte argumentieren, daß er an den reinen Wortlaut (plain text) der Verfassung gebunden ist, die Absicht der Verfasser sei irrelevant. Pikant ist: Ein früherer Entwurf des 22. Zusatzartikels war wasserdicht. Er besagte, daß ein Zwei-Amtszeit-Präsident „nicht berechtigt sein soll, das Amt des Präsidenten innezuhaben oder als Präsident zu handeln“. Dieser Text wurde jedoch im Senat durch die schwächere „gewählt“-Version ersetzt. Ein Richter könnte dies als bewußte Entscheidung des Kongresses interpretieren, das Schlupfloch offenzulassen.
Die leisen Pfade zur Macht: Mehr als nur ein Schlupfloch
Das Szenario der Vizepräsidentschaft ist nur die offensichtlichste Variante. Die Verfassung und die nachfolgenden Gesetze bieten ein Labyrinth weiterer, düsterer Möglichkeiten, die alle auf der Trennung von „Wahl“ und „Amt“ beruhen. Sollte der 12. Zusatzartikel die Kandidatur als Vizepräsident doch verhindern, bliebe der 25. Zusatzartikel. Der gewählte Präsident und Vizepräsident könnten ins Amt starten, der Vizepräsident könnte zurücktreten, und der Präsident würde Trump (mit Zustimmung des Kongresses) zum neuen Vizepräsidenten ernennen. Träte der Präsident dann zurück, wäre Trump wieder an der Macht, ohne je auf einem Wahlzettel gestanden zu haben. Eine weitere Route führt über das Amt des Sprechers des Repräsentantenhauses. Nach der aktuellen Nachfolgeregelung ist der Sprecher die Nummer drei. Sollten Präsident und Vizepräsident gleichzeitig zurücktreten, würde der Sprecher das Oval Office übernehmen.
Das vielleicht finsterste Szenario schlummert im 20. Zusatzartikel. Dieser regelt den Fall, daß am Tag der Amtseinführung (Inauguration Day) kein qualifizierter Präsident oder Vizepräsident zur Verfügung steht – etwa, weil beide Kandidaten der Gewinnerseite gestorben, disqualifiziert oder die Wahlergebnisse ungelöst sind. In diesem Fall, so der Zusatzartikel, darf der Kongreß per Gesetz bestimmen, wer als „amtierender Präsident“ (Acting President) fungiert. Derzeit sieht das Gesetz vor, daß dies der Sprecher des Repräsentantenhauses wäre. Aber ein Gesetz kann geändert werden. Ein Kongreß, der von der Partei des scheidenden Präsidenten kontrolliert wird, könnte das Nachfolgegesetz in letzter Minute ändern und festlegen, daß in einem solchen Fall der scheidende Präsident im Amt bleibt. Welche perversen Anreize würde dies schaffen? Ein Präsident, der an der Macht bleiben will, müßte lediglich sicherstellen, daß die Wahl ungelöst bleibt, daß die Ergebnisse angefochten, verzögert oder durch Chaos delegitimiert werden – ein Szenario, das nach den Erfahrungen vom 6. Januar 2021 nicht mehr der Fantasie entsprungen scheint.
Das Schweigen der Parteifreunde: Johnsons halbherzige Verteidigung
Angesichts dieser Abgründe blickt die Nation auf die „Erwachsenen im Raum“ – auf die Führer der Republikanischen Partei, die geschworen haben, die Verfassung zu verteidigen. Doch die Reaktion von Sprecher Mike Johnson ist ein Lehrstück in politischer Loyalität und juristischer Unschärfe. Johnsons öffentliche Erklärung, er sehe „keinen Weg“ für eine dritte Amtszeit, kam spät, aber sie kam. Er betonte, daß eine Verfassungsänderung „etwa 10 Jahre“ dauern würde , und er habe dies Trump auch so mitgeteilt. Auf den ersten Blick war dies der Moment, in dem die Parteiführung die rote Linie zog. Doch warum gerade jetzt? Johnson, der seine Karriere auf die Nähe zu Trump gebaut hat, steht unter enormem Druck. Einerseits muß er die Verfassungstreue seiner Partei demonstrieren, andererseits darf er Trump nicht verprellen. Sein Eingreifen war notwendig, um die Debatte aus dem Bereich des Akzeptablen zu rücken.
Das Problem ist die Glaubwürdigkeit des Boten. Wenn Johnson nun den Hüter der Verfassung gibt, hallt das Echo seiner eigenen Vergangenheit durch die Hallen des Kapitols. Dies ist der Mann, der als Kongreßabgeordneter „im Stillen“ die Bemühungen anführte, die Wahlergebnisse von 2020 zu kippen. Er sammelte 125 Unterschriften für einen Schriftsatz an den Obersten Gerichtshof, der die Ergebnisse in vier Staaten als betrügerisch darstellte. Er stimmte selbst nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 gegen die Zertifizierung der Wahlergebnisse. Noch Jahre später weigerte er sich anzuerkennen, daß Joe Biden die Wahl 2020 gewonnen hat. Ein Mann, der die Grundpfeiler der Wahl 2020 derart in Frage stellte, soll nun die ultimative Grenze derselben Verfassung verteidigen? Kritiker bemängeln daher, daß Johnsons Dementi – ebenso wie eine ähnliche Äußerung von Mehrheitsführer John Thune – gefährlich unvollständig ist. Johnson und Thune haben klargestellt, daß Trump nicht kandidieren kann. Sie haben mit keinem Wort das „Nachfolge-Schlupfloch“ adressiert oder verurteilt. Indem sie nur die Vordertür verschließen, über die Trump ohnehin nicht (mehr) kommen will, lassen sie die juristischen Hintertüren weit offen stehen.
Wie man eine Verfassung repariert: Der Ruf nach Klarheit
Das Problem an der Wurzel, so argumentieren Rechtswissenschaftler wie Brian C. Kalt, ist, daß eine rechtliche Zweideutigkeit am besten durch eine politische Lösung behoben wird, bevor sie zu einem unlösbaren Rechtsfall wird. Die Öffentlichkeit selbst ist überwältigend auf der Seite der Amtszeitbeschränkung. Eine Umfrage vom April ergab, daß 82 Prozent der Amerikaner – darunter 62 Prozent der Republikaner – eine dritte Amtszeit Trumps ablehnen. Diese Mehrheit muß politisch kanalisiert werden. Die Lösungsansätze sind klar, aber politisch mühsam. Eine neue Verfassungsänderung, die die Formulierung des 22. Zusatzartikels klarstellt, wäre die sauberste Lösung , gilt aber als unrealistisch. Ein pragmatischerer Weg wäre eine einfache Gesetzesänderung. Der Kongreß könnte das „Presidential Succession Act“ (Nachfolgegesetz) ändern. Dieses Gesetz verlangt bereits, daß Personen in der Nachfolgelinie „berechtigt (eligible) für das Amt des Präsidenten“ sein müssen. Der Kongreß könnte dieses Gesetz nun präzisieren und explizit festlegen, daß diese „Berechtigung“ auch die Einhaltung des 22. Zusatzartikels umfaßt. Ein solches Gesetz würde zwar einen künftigen Gerichtsprozeß nicht endgültig entscheiden, aber es würde ein „kraftvolles Signal“ über die Interpretation des Kongresses senden.
Doch in der aktuellen politischen Landschaft scheint selbst dieser Schritt blockiert. Die Republikaner müßten sich aktiv gegen die Optionen ihres eigenen De-facto-Anführers stellen. Am Ende bleibt eine beunruhigende Erkenntnis: Das Gerede über die dritte Amtszeit hat die Stabilität der US-Verfassung bereits beschädigt, unabhängig davon, ob es jemals umgesetzt wird. Es verschiebt die Grenzen des Denkbaren und untergräbt das Vertrauen in Institutionen. Wenn die klare Absicht eines Verfassungszusatzes durch eine spitzfindige, textualistische Auslegung zunichtegemacht werden kann, was ist die Verfassung dann noch wert?
Donald Trump hat das System verstanden. Er weiß, daß die „Leitplanken“ der Demokratie oft nur aus ungeschriebenen Konventionen und vagen Formulierungen bestehen. Als er das Gerede über eine mögliche Kandidatur von JD Vance und Marco Rubio für 2028 ins Spiel brachte, war dies vielleicht mehr als nur eine Ablenkung. Es war die Geste eines Königs, der seinen Nachfolgern gnädig das Feld überläßt – wohl wissend, daß er es jederzeit selbst wieder betreten könnte. Die „Trump 2028“-Kappen sind kein Scherz. Sie sind eine offene Bewerbung für eine Position, die nicht existieren darf, gestützt auf eine Zweideutigkeit, die niemals hätte existieren dürfen. Trumps jüngstes „Dementi“ ist nicht das Ende dieser Debatte, sondern nur ihre geschickteste Fortführung.


