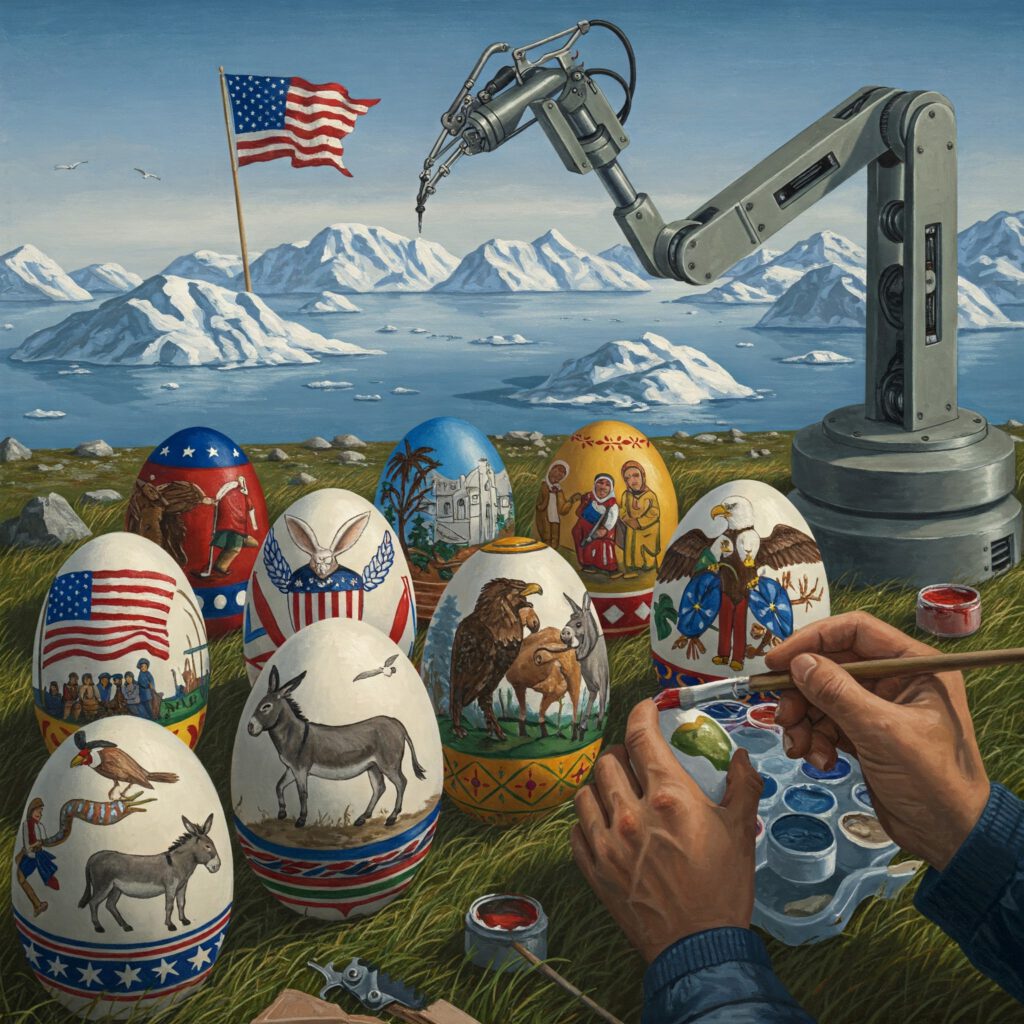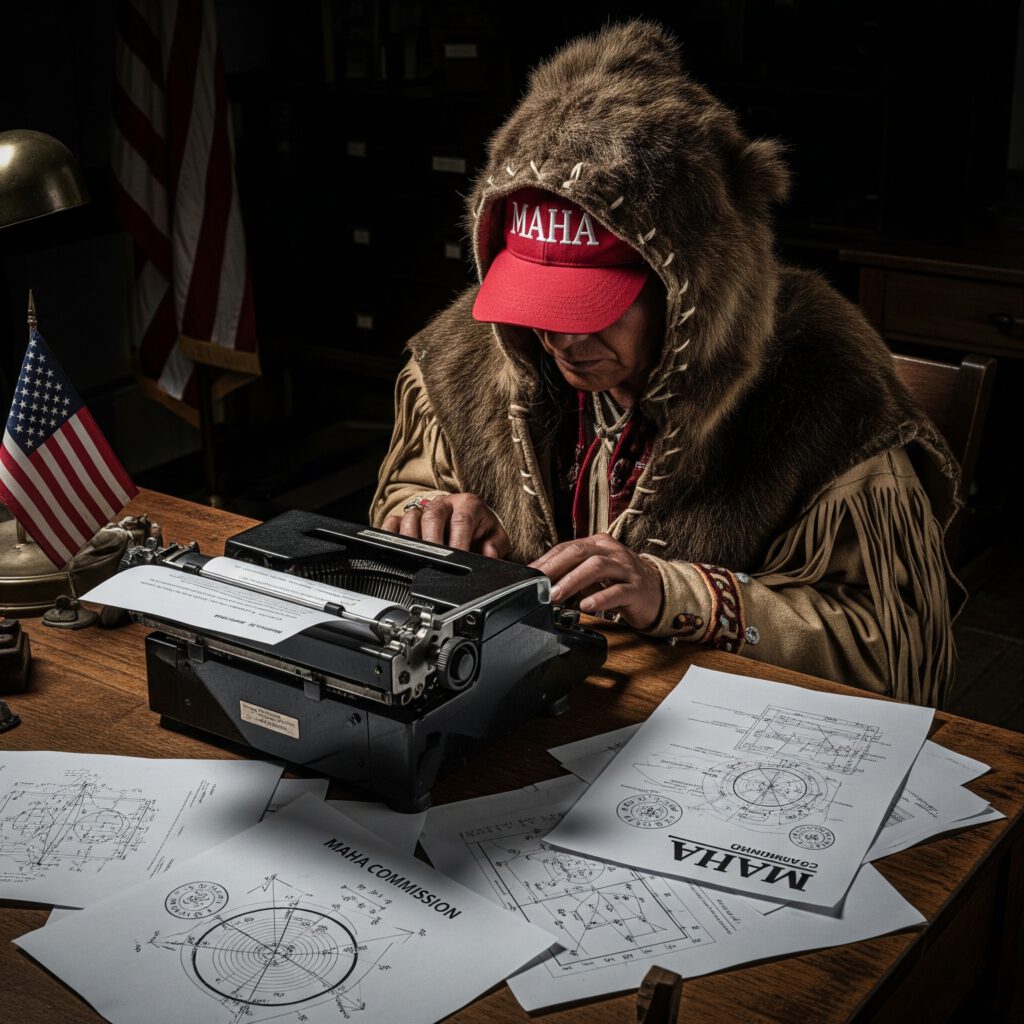Es ist ein Markt, der jedem ökonomischen Grundgesetz zu spotten scheint. Ein Markt, auf dem die Verkäufe einbrechen, die Nachfrage am Boden liegt und dennoch die Preise auf historischen Rekordniveaus verharren oder gar weiterklettern. Willkommen auf dem amerikanischen Immobilienmarkt des Jahres 2025. Wir erleben nicht nur eine Krise der Bezahlbarkeit, wir sind Zeugen einer tiefgreifenden, strukturellen Lähmung. Das System ist in einem „Doom Loop“ gefangen, einem Teufelskreis aus mangelndem Angebot und künstlich erstickter Nachfrage, der die Gesellschaft in Besitzer und Ausgeschlossene spaltet.
Die aktuelle Situation ist kein vorübergehender Schluckauf. Sie ist das logische, fast unvermeidliche Ergebnis von jahrzehntelangen politischen Fehlsteuerungen, ökonomischen Verwerfungen und einer fundamentalen Verschiebung dessen, was ein „Zuhause“ in der amerikanischen Psyche bedeutet. Um die große Paralyse zu verstehen, müssen wir die Mechanismen des Stillstands, ihre historischen Wurzeln und die sozialen Verwerfungen betrachten, die sie in Echtzeit anrichtet.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die goldenen Fesseln: Wie der „Lock-in-Effekt“ das Angebot erdrosselt
Das Herzstück der Lähmung ist ein Paradoxon: Obwohl Millionen Menschen ein Haus kaufen wollen, gibt es kaum Häuser zu kaufen. Und obwohl Millionen Verkäufer theoretisch von den hohen Preisen profitieren könnten, verkaufen sie nicht. Der erste Mechanismus dieses Stillstands ist der sogenannte „Lock-in-Effekt“. Während der Pandemie-Jahre sicherten sich Millionen bestehende Hausbesitzer historisch niedrige Hypothekenzinsen – oft unter drei Prozent. Angesichts der heutigen Zinsen, die mehr als doppelt so hoch liegen, käme ein Umzug einem finanziellen Selbstmord gleich. Wer sein Haus mit drei Prozent Zinslast verkauft, müßte sein neues Haus – selbst wenn es billiger wäre – mit fast sieben Prozent finanzieren. Die monatliche Belastung würde explodieren. Diese Millionen von Amerikanern sitzen also in „goldenen Fesseln“. Sie sind an ihre Häuser gebunden, nicht aus Liebe, sondern aus ökonomischer Notwendigkeit. Dies entzieht dem Markt auf einen Schlag den gesamten natürlichen Bestand an „normalen“ Verkäufen – die Familie, die sich vergrößert; das Paar, das sich verkleinert.
Gleichzeitig erleben wir ein zweites Phänomen, das dieses künstlich verknappte Angebot weiter reduziert: das „Delisting“. Die wenigen Eigentümer, die dennoch versuchen, ihre Häuser zu den irrsinnigen Preisen der Pandemie-Hochphase zu verkaufen, treffen auf eine Realität, in der die Käufer schlichtweg nicht mehr existieren. Die Zinsen haben sie eliminiert. Doch anstatt die Preise signifikant zu senken – was ihrem psychologischen Ankerpunkt widerspräche – tun die Verkäufer etwas anderes: Sie nehmen ihre Häuser einfach wieder vom Markt. Sie ziehen das Angebot zurück und entscheiden sich, auf „bessere Zeiten“ zu warten. Dieses Zusammenspiel aus „Lock-in“ (unfreiwilliges Nicht-Anbieten) und „Delisting“ (freiwilliges Zurückziehen) schafft eine Angebotswüste. Es ist ein Markt, der von zwei Seiten erdrosselt wird, während die Preise in der dünnen Höhenluft verharren.
Es gibt zwar Lichtblicke, etwa bei den Verkäufen von Neubauten, doch diese sind ein Zerrbild. Große Bauträger operieren in einer anderen Realität. Sie verfügen über Puffer, stabile Lieferketten und die Fähigkeit, Zinskosten für Käufer künstlich zu subventionieren („Rate Buydowns“), um den Verkauf am Laufen zu halten. Diese Nischenverkäufe, oft in den Vorstädten, können jedoch den massiven Einbruch bei den Bestandsverkäufen – dem eigentlichen Rückgrat des Marktes – nicht im Geringsten kompensieren.
Vom Dach über dem Kopf zum Spekulationsobjekt: Die Erfindung der Unerschwinglichkeit
Wie konnte es so weit kommen? Um das zu verstehen, müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, der aktuelle Markt sei eine Anomalie. Er ist die Konsequenz einer langen Entwicklung. Lange Zeit, fast bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, war ein Haus in Amerika vor allem eines: ein Dach über dem Kopf und ein solider Schutz gegen Inflation. Man kaufte es, man lebte darin, und im Alter war es abbezahlt. Der Wertzuwachs hielt meist nur mit der allgemeinen Teuerung Schritt.
Der Wendepunkt war die massive Verbreitung der 30-jährigen Festhypothek (30-year fixed-rate mortgage). Was als politisches Instrument zur Förderung von Wohneigentum gedacht war, verwandelte sich über die Jahrzehnte in einen gigantischen Spekulationshebel. Diese Hypothek ermöglichte es, mit kleinem Einsatz auf steigende Preise zu wetten, und trennte die Investition vom unmittelbaren Konsum. Das Eigenheim wandelte sich vom physischen Schutzschild gegen Inflation zum digitalen Spekulationsobjekt auf einem Bildschirm; sein Wert wurde wichtiger als sein Nutzen. Dieser Wandel ist der Nährboden für die heutigen Exzesse. Ein Markt, der primär als Investitionsvehikel dient, reagiert nicht mehr auf die Grundbedürfnisse der Bevölkerung (bezahlbarer Wohnraum), sondern nur noch auf die Verfügbarkeit von billigem Geld. Als die Zinsen während der Pandemie auf null fielen, explodierte die Spekulation. Jetzt, da die Zinsen hoch sind, kollabiert nicht der Preis, sondern nur die Transaktion – das Gut selbst wird einfach gehalten, „locked-in“, bis die nächste Welle billigen Geldes kommt.
Die unsichtbaren Mauern: Warum Detroit nicht Los Angeles ist
Diese „Financialisierung“ des Wohnens traf jedoch auf eine zweite, ebenso potente Kraft: eine jahrzehntelange, hausgemachte Verknappung des Angebots durch politische Entscheidungen. Ein Blick auf die historische Preisentwicklung in den USA offenbart Erstaunliches. Während der US-Markt als Ganzes boomte, gibt es Städte wie Detroit oder St. Louis, in denen die Immobilienpreise inflationsbereinigt über ein Jahrhundert kaum gestiegen sind. Im selben Zeitraum explodierten die Preise in Küstenmetropolen wie Los Angeles, San Francisco oder Seattle um das Sechs- bis Zehnfache.
Die Ursache für diese dramatische Entkopplung, obwohl alle dem gleichen nationalen Hypothekensystem und den gleichen Zinszyklen unterliegen, ist so banal wie politisch explosiv: restriktive Bebauungsvorschriften (Zoning). In den boomenden Küstenstädten und „Superstar Cities“ wurde es durch lokale Politik systematisch verhindert, daß das Angebot mit der Nachfrage Schritt hält. Durch „Zoning“-Gesetze, die fast ausschließlich Einfamilienhäuser erlauben, Höhenbeschränkungen und endlose Genehmigungsverfahren, wurde der Neubau abgewürgt. Dichte wurde zum Feindbild. Metropolen wie Atlanta oder Houston, die eine liberalere Baupolitik verfolgten, konnten ihre Bevölkerungsexplosionen mit massivem Neubau abfedern und die Preise relativ stabil halten. In Seattle, Boston oder weiten Teilen Kaliforniens hingegen traf die hohe Nachfrage auf ein künstlich eingefrorenes Angebot.
Es ist ein Trugschluß zu glauben, eine bloße Lockerung der Zonierungsgesetze könnte den Teufelskreis heute noch durchbrechen. Selbst wenn die politischen Hürden fielen, verhindern die aktuellen hohen Zinsen, die explodierten Baukosten, der Mangel an Handwerkern und die immer noch spürbaren Handelszölle auf Baumaterialien den dringend benötigten Massen-Neubau. Die Absurdität dieser Situation zeigt ein regionaler Bezahlbarkeits-Index: In Pittsburgh wäre ein Haus für eine Durchschnittsfamilie selbst bei einem Hypothekenzins von fast neun Prozent noch tragbar. In Los Angeles, San Diego oder Miami müßte der Zinssatz auf null Prozent fallen, um dasselbe zu erreichen – und selbst dann wäre es für den Medianverdiener in diesen Städten unmöglich, eine Immobilie zu erwerben.
Der Graben: Wer besitzt und wer draußen bleibt
Dieser dysfunktionale Markt ist mehr als ein ökonomisches Ärgernis; er ist eine soziale Katastrophe. Er zementiert eine tiefe gesellschaftliche Spaltung. Auf der einen Seite stehen die „Haves“: meist ältere Generationen, die ihre Immobilien vor Jahrzehnten oder während der Niedrigzinsphase erworben haben. Sie sitzen auf einem Berg von „Papier-Vermögen“, das sie aber dank des „Lock-in-Effekts“ nicht realisieren können. Sie sind reiche Gefangene ihrer eigenen Immobilien. Auf der anderen Seite stehen die „Have-Nots“: eine ganze Generation von jungen Menschen, Mietern und Erstkäufern. Für sie ist der amerikanische Traum vom Eigenheim nicht nur aufgeschoben, sondern schlichtweg ausgelöscht. Sie werden vom Markt ausgeschlossen, gezwungen, steigende Mieten zu zahlen, während ihnen der Aufbau von Vermögen – der klassische Weg über die eigene Immobilie – versperrt bleibt.
Diese Dynamik wird durch neue Phänomene wie die „Klimagentrifizierung“ weiter verschärft. Wie in New York City zu beobachten ist, führen kostspielige Investitionen in den Klimaschutz in ehemals günstigen, aber gefährdeten Küstengebieten zu einer neuen Welle der Aufwertung. Die Resilienz-Maßnahmen ziehen wohlhabende Käufer und Entwickler an, während steigende Versicherungprämien und Steuern die ursprünglichen Bewohner verdrängen. Manchmal führt die Marktparalyse zu bizarren, unbeabsichtigten Konsequenzen. In Nashville etwa, so wird berichtet, nehmen viele Eigentümer ihre Häuser vom Verkaufsmarkt, um sie stattdessen zu vermieten. Dies hat dort paradoxerweise zu einem Überangebot an Mietwohnungen geführt und die Mieten gesenkt – ein schwacher Trost für jene, die eigentlich kaufen wollten. Zu all dem gesellt sich der unaufhaltsame Anstieg der Nebenkosten. Die monatliche Hypothekenrate ist nur die halbe Miete. Explodierende Versicherungsprämien (getrieben durch Klimarisiken), steigende Grundsteuern und hohe Gebühren für Eigentümergemeinschaften (HOAs) fressen jeden finanziellen Spielraum auf und definieren die „Bezahlbarkeit“ neu – nach unten.
Gefangen im „Doom Loop“: Warum es keinen einfachen Ausweg gibt
Wir befinden uns in einem perfekten Sturm, einem „Doom Loop“ aus Mangel an Angebot und Mangel an Nachfrage, bei dem sich alle Akteure rational verhalten und dennoch ein kollektiv irrationales, katastrophales Ergebnis produzieren. Wie könnte dieser Kreislauf durchbrochen werden? Die Hoffnungen auf die US-Notenbank (Fed) sind trügerisch. Die Fed steckt in einem unlösbaren Dilemma. Senkt sie die Zinsen, um die Wirtschaft anzukurbeln, treibt sie die Immobilienpreise sofort weiter in die Höhe und verschärft die Unbezahlbarkeit. Hält sie die Zinsen hoch, um die Inflation zu bekämpfen, würgt sie den dringend benötigten Neubau ab, da Entwickler ihre Projekte nicht mehr finanzieren können. Ökonomen sind sich einig: Selbst moderate Zinssenkungen werden das grundlegende Problem der Unerschwinglichkeit nicht lösen. Sie sind ein Tropfen auf den heißen Stein.
Die einzige langfristige Lösung – Bauen, Bauen, Bauen – bleibt blockiert. Selbst wenn die Zinsen fielen und das „Zoning“ gelockert würde, verhindern Handwerkermangel und hohe Materialkosten eine schnelle Ausweitung des Angebots. Über allem schwebt die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit. Die Rezessionsangst und die Inflation haben eine „Wait-and-see“-Mentalität geschaffen, die Käufer und Verkäufer gleichermaßen lähmt und Investitionen in den Neubau bremst.
Was also könnte die Lähmung aufbrechen? Es gibt eine zynische Antwort: ein echter Absturz. Ein signifikanter Anstieg der Arbeitslosigkeit, eine tiefe Rezession, die „locked-in“ Eigentümer dazu zwingt, ihre Häuser zu verkaufen, egal zu welchem Preis. Nur eine solche Welle von Notverkäufen könnte das Angebot drastisch erhöhen und die Preise real senken. Es wäre die Heilung der Krankheit durch den Tod des Patienten. Bis dahin bleibt der amerikanische Immobilienmarkt das, was er 2025 ist: ein gelähmter Riese. Ein System, das nicht mehr der Befriedigung eines Grundbedürfnisses dient, sondern nur noch seiner eigenen, dysfunktionalen Logik folgt. Der Stillstand ist der neue Normalzustand.