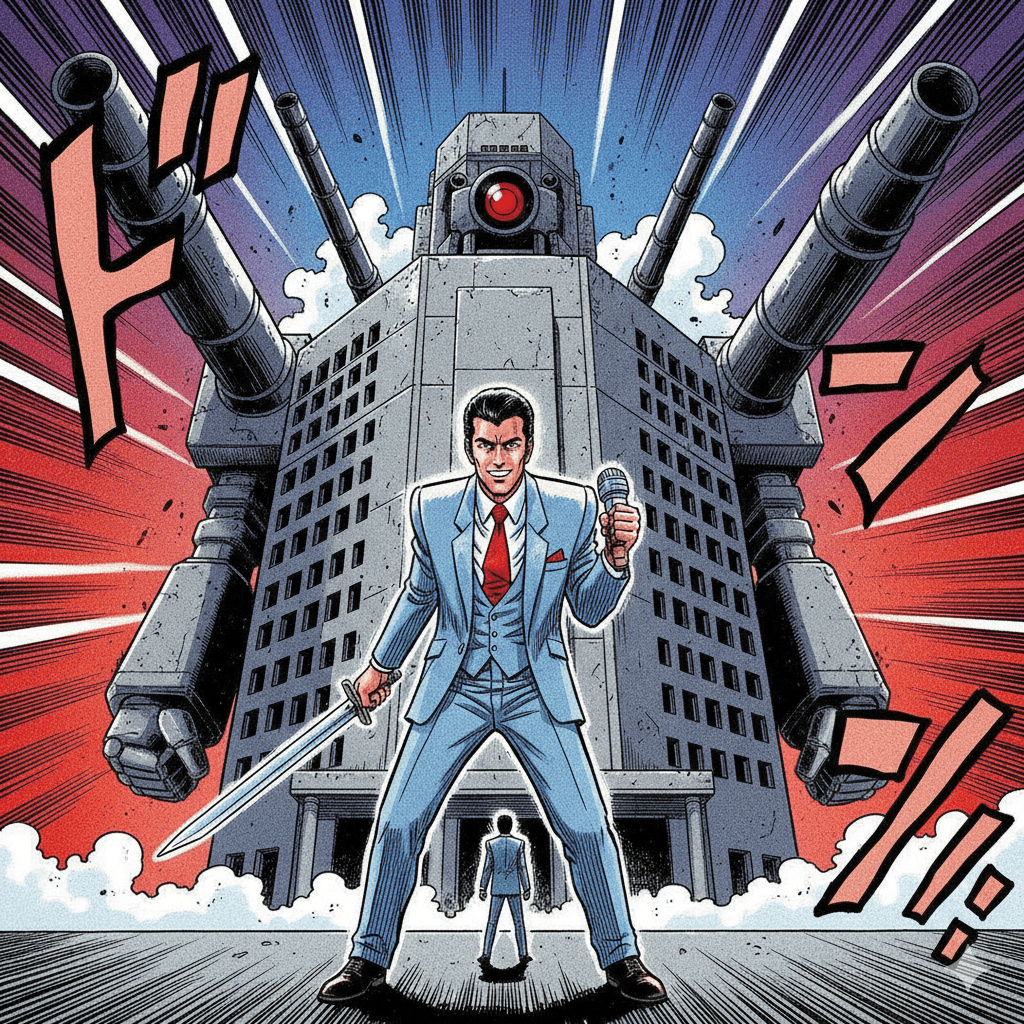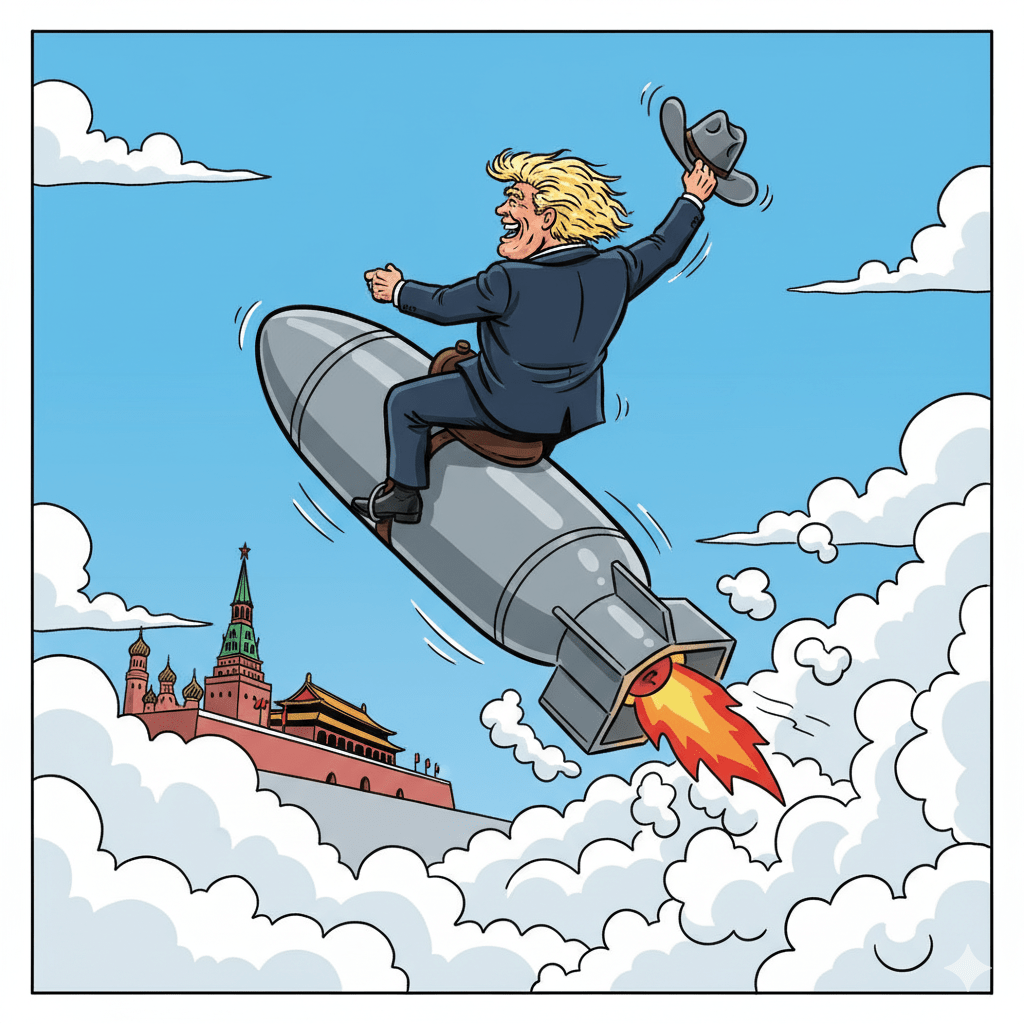
Es sind Bilder, die für eine Welt im Übergang stehen: US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping reichen sich in Südkorea die Hände. Die Stimmung ist, zumindest an der Oberfläche, gelöst. Ein monatelanger, eskalierender Handelskrieg, der die Weltwirtschaft an den Rand einer Rezession brachte, scheint beigelegt. Präsident Trump wird die Ergebnisse später als einen triumphalen Sieg seiner „unorthodoxen“ Verhandlungstaktik feiern, ein „12 von 10“-Erfolg. Doch blickt man hinter die Kulissen dieses Gipfels im Oktober 2025, hinter die erzwungene Bonhomie und die schnell verkündeten Deals, offenbart sich ein anderes Bild. Es ist ein Bild, das von Analysten und Strategen als tiefgreifende strategische Niederlage für die Vereinigten Staaten gedeutet wird. Der beim Gipfel besiegelte Kompromiß ist nur auf den ersten Blick ein Erfolg. Tatsächlich entlarvt er Amerikas Verwundbarkeit, zementiert Chinas neue Macht und wird von einer disruptiven Drohgebärde überschattet, die das nukleare Gleichgewicht der Welt zu erschüttern droht. Was in Südkorea verhandelt wurde, war nicht weniger als die Anatomie einer neuen globalen Unordnung – und Amerika hat die schlechteren Karten gezogen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Der Pakt von Busan: Eine teuer erkaufte Rückkehr zur Normalität
Was genau wurde vereinbart? Präsident Trump kündigte an, die drückenden Zölle auf chinesische Waren von 57 Prozent auf 47 Prozent zu senken. Im Gegenzug, so der Präsident, habe Xi Jinping zugestimmt, die drakonischen Exportkontrollen für Seltenerdmetalle – das technologische Lebensblut der US-Industrie – um ein Jahr auszusetzen. Außerdem sollen amerikanische Farmer wieder Sojabohnen nach China verkaufen dürfen, nachdem ein Boykott ihre Existenz bedrohte. Das Weiße Haus verkauft dies als Durchbruch. Kritiker hingegen sehen darin nichts weiter als eine mühsame, schmerzhafte und vor allem kostspielige Rückkehr zum Status quo von vor der Eskalation. China, so die Analyse, hat die USA in einen Handelskrieg gezwungen, den Washington nicht gewinnen konnte, nur um dann großzügig einen „Waffenstillstand“ zu denselben Bedingungen anzubieten, die vorher schon galten. Der entscheidende Unterschied: Der Preis für diese Rückkehr zur Normalität war die offizielle Demonstration der amerikanischen Abhängigkeit. Trumps Zölle, gedacht als ultimative Waffe, erwiesen sich als stumpfes Instrument. Chinas Antwort hingegen war ein chirurgischer Präzisionsschlag.
Das Skalpell der Seltenen Erden: Chinas wahre Waffe
Der Rauch dieses Handelskrieges hat sich kaum verzogen, und schon enthüllt er eine unbequeme Wahrheit: die erschütternde Verwundbarkeit der amerikanischen Lieferketten. Die USA mögen die stärkste Militärmacht der Welt sein, aber ihre Fähigkeit, moderne Technologie – von Smartphones über Kampfjets bis hin zu Windturbinen – zu produzieren, hängt fast vollständig von Chinas Gnaden ab.
China kontrolliert nicht nur den Abbau, sondern vor allem die Verarbeitung von etwa 90 Prozent der Seltenen Erden. Als Trump im April mit „Liberation Day“-Zöllen drohte, reagierte Peking mit der Ankündigung, diesen Hahn zuzudrehen. Es war ein Moment der schockierenden Erkenntnis in Washington: China ist das „OPEC der Seltenen Erden“. Während China amerikanisches Soja auch anderswo kaufen kann, haben die USA keine unmittelbare Alternative zu chinesischen Mineralien.
Analysten sind sich einig: Chinas Hebelwirkung ist strukturell, langfristig und systemisch. Amerikas Hebel (Zölle) ist kurzfristig, schmerzhaft für die eigenen Verbraucher und politisch instabil. Peking hat, wie es ein Experte ausdrückte, die „Waffengleichmachung“ vollzogen. Es hat bewiesen, daß es bereit ist, seine wirtschaftliche Vormachtstellung als Waffe einzusetzen – und daß die USA blinzeln mußten. China hat den Konflikt eskaliert, nur um zu deeskalieren, und hat damit genau das bekommen, was es wollte: globale Anerkennung seiner Macht und eine Demütigung Washingtons.
Das Spiel mit dem Spieler: Wie Peking Trump entschlüsselt hat
Dieser Erfolg war kein Zufall. Er war das Ergebnis einer präzisen strategischen Analyse – nicht nur der wirtschaftlichen, sondern auch der psychologischen Lage. Peking, so scheint es, hat nicht nur seine Karten ausgespielt, sondern vor allem seinen Gegenspieler. Monatelang vor dem Treffen orchestrierte China eine meisterhafte Kampagne aus Zuckerbrot und Peitsche, perfekt zugeschnitten auf die Persönlichkeit von Donald Trump. Einerseits zeigten sie unnachgiebige Härte: die Seltenerd-Blockade, der Soja-Boykott, die rhetorische Bereitschaft zu einem „jeden Krieg“.
Andererseits aktivierten sie eine Charmeoffensive, die direkt auf das Ego des Präsidenten abzielte. Chinesische Offizielle und Staatsmedien priesen Trump und Xi als „irreplaceable“ (unersetzlich) und „Weltklasse-Führer“. Man schmeichelte Trump als starken „Dirigenten“, der sich nicht von „falkenhaften Beratern“ ablenken lassen dürfe. Diese Strategie – Härte in der Sache, Schmeichelei für die Person – ging auf. Rush Doshi, ein ehemaliger Biden-Beamter, formulierte es treffend: „Er [Xi] denkt, daß Präsident Trump einknicken wird, und seine Wette könnte sich als richtig erwiesen haben.“
Die Sorge unter amerikanischen China-Beobachtern ist nun, daß dieser „Erfolg“ Trump zu weiteren Zugeständnissen verleiten könnte. Matt Pottinger, ein einflußreicher „Falke“ aus Trumps erster Amtszeit, warnte bereits vor einer „unklareren“ Asienpolitik. Es gibt Befürchtungen, die USA könnten im Tausch gegen Handelsvorteile ihre Haltung zu KI-Chip-Exporten aufweichen oder – noch gravierender – ihre Sicherheitszusagen für Taiwan reduzieren.
Chinas globaler Siegeszug im Schatten des „Trump-Chaos“
Der vielleicht größte, wenn auch subtilste, Sieg Chinas liegt jedoch jenseits des Verhandlungstisches. Trumps „America First“-Politik, sein permanentes Stören von Allianzen und sein Rückzug von globalen Normen haben ein Vakuum geschaffen, das Peking mit beeindruckender Geschwindigkeit füllt.
Während Trump traditionelle Verbündete in Europa und Kanada mit „Trump’scher Willkür“ und Strafzöllen vor den Kopf stößt, inszeniert sich China als der neue, verlässliche globale Akteur. Peking wirbt für Freihandel, Multilateralismus und Stabilität. Diese Rhetorik, auch wenn sie zynisch sein mag, fällt bei verunsicherten Nationen von Asien bis Afrika auf fruchtbaren Boden.
Diese Neuausrichtung ist nirgends so deutlich wie in der Klimapolitik. Während Trump grüne Politik als „Scam“ (Betrug) abtut, hat sich China an die Weltspitze der grünen Technologie katapultiert. Chinesische Elektroautos, Solarpaneele und Batterien dominieren die Weltmärkte von São Paulo bis Kathmandu. Ironischerweise könnte Trumps Politik diesen Trend noch beschleunigen: Berichten zufolge erwägt Kanada, als Reaktion auf US-Strafzölle, seine eigenen 100-Prozent-Zölle auf chinesische E-Autos zu senken.
Trump, fixiert auf bilaterale Deals, bei denen er als Sieger dastehen kann, übersieht, daß der systemische Wettbewerb mit China nur durch „kollektive Aktion“ gleichgesinnter Verbündeter zu gewinnen wäre. Doch genau diese Koalition hat er selbst demontiert. Singapurs Premierminister brachte die neue Realität auf den Punkt: Amerika sei als „globaler Versicherer“ zurückgetreten, aber kein anderer sei bereit, die Lücke zu füllen. Es ist eine „unvorhersehbare, chaotische Übergangszeit“ – und in diesem Chaos gewinnt China das Spiel.
Der nukleare Paukenschlag: Wenn Chaos zur globalen Gefahr wird
Als wäre dieser wirtschaftliche Epochenwechsel nicht schon genug, zündete Trump, Minuten bevor er Xi Jinping traf, eine verbale Bombe, die das Fundament der globalen Sicherheitsarchitektur erschüttert. Auf seinem sozialen Netzwerk „Truth Social“ kündigte er an, er habe das „Department of War“ (ein Lapsus – zuständig wäre das Energieministerium) angewiesen, die Wiederaufnahme von US-Atomwaffentests vorzubereiten – „auf gleicher Basis“. Dies wäre ein radikaler Bruch mit einer 30-jährigen US-Politik. Seit 1992 haben die USA keine Atomwaffe mehr gezündet.
Was löste diese abrupte, folgenschwere Ankündigung aus? Mutmaßlich waren es die jüngsten russischen Tests neuer Waffensysteme, wie der atomgetriebenen Unterwasserdrohne „Poseidon“. Doch hier offenbart sich eine gefährliche Verwechslung: Experten gehen davon aus, daß Trump die Tests von Trägersystemen (wie Raketen, die auch die USA routinemäßig testen) mit der tatsächlichen Detonation von nuklearen Sprengköpfen gleichsetzt.
Rüstungsexperten reagierten entsetzt. Sie betonten, daß es für physische Tests keinerlei technische Notwendigkeit gebe; die Sicherheit des Arsenals werde längst durch hochentwickelte Computermodellierungen gewährleistet. Darüber hinaus wäre eine schnelle Wiederaufnahme logistisch unmöglich: Das Testgelände in Nevada bräuchte mindestens 36 Monate Vorlaufzeit.
Die diplomatischen Folgen wären jedoch unmittelbar und verheerend. Eine Wiederaufnahme der US-Tests würde mit ziemlicher Sicherheit eine globale Kettenreaktion auslösen. Rußland und China, die ihre letzten Tests 1990 bzw. 1996 durchführten, sähen sich gezwungen nachzuziehen. Das globale Moratorium gegen Atomtests würde kollabieren.
Diese Ankündigung steht in fundamentalem Widerspruch zu Trumps früheren Bemühungen, sich als „Friedenspräsident“ zu inszenieren. Sie zeigt eine impulsive, destabilisierende Politik, die nicht auf Strategie, sondern auf medialen Effekt zielt – und die Amerikas Verbündete noch tiefer in die Arme anderer Partner treiben könnte.
Der Preis des „Sieges“
Am Ende des Gipfels von Südkorea steht ein Präsident Trump, der einen Sieg verkündet, und ein Präsident Xi, der still das Feld räumt. Die Diskrepanz zwischen der triumphierenden Rhetorik des Weißen Hauses und der zurückhaltenden, aber selbstbewußten Stille Pekings könnte nicht größer sein.
Der „Deal“ ist eine strategische Kapitulation, getarnt als Verhandlungserfolg. Die USA haben nicht nur den Handelskrieg verloren; sie haben China aktiv dabei geholfen, seine gefährlichste Waffe zu schärfen. Peking hält nun einen permanenten „Prügel“ (cudgel) in der Hand: die Seltenerd-Abhängigkeit. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieser Hebel erneut angesetzt wird – vielleicht, um Zugeständnisse bei Taiwan zu erpressen oder die US-Präsenz im Südchinesischen Meer zurückzudrängen.
Der Handelskrieg, den Trump vom Zaun brach, hat Amerikas globalen Einfluß verringert und seine Glaubwürdigkeit untergraben. Die gleichzeitige nukleare Eskalation ist das Symptom einer Supermacht im „strategischen freien Fall“, die ihre Rolle als Anker der Weltordnung gegen die eines unberechenbaren Störfaktors getauscht hat. Xis Lächeln in Südkorea war das Lächeln eines Mannes, der weiß, daß er nicht nur das Spiel, sondern auch den Spieler gewonnen hat.