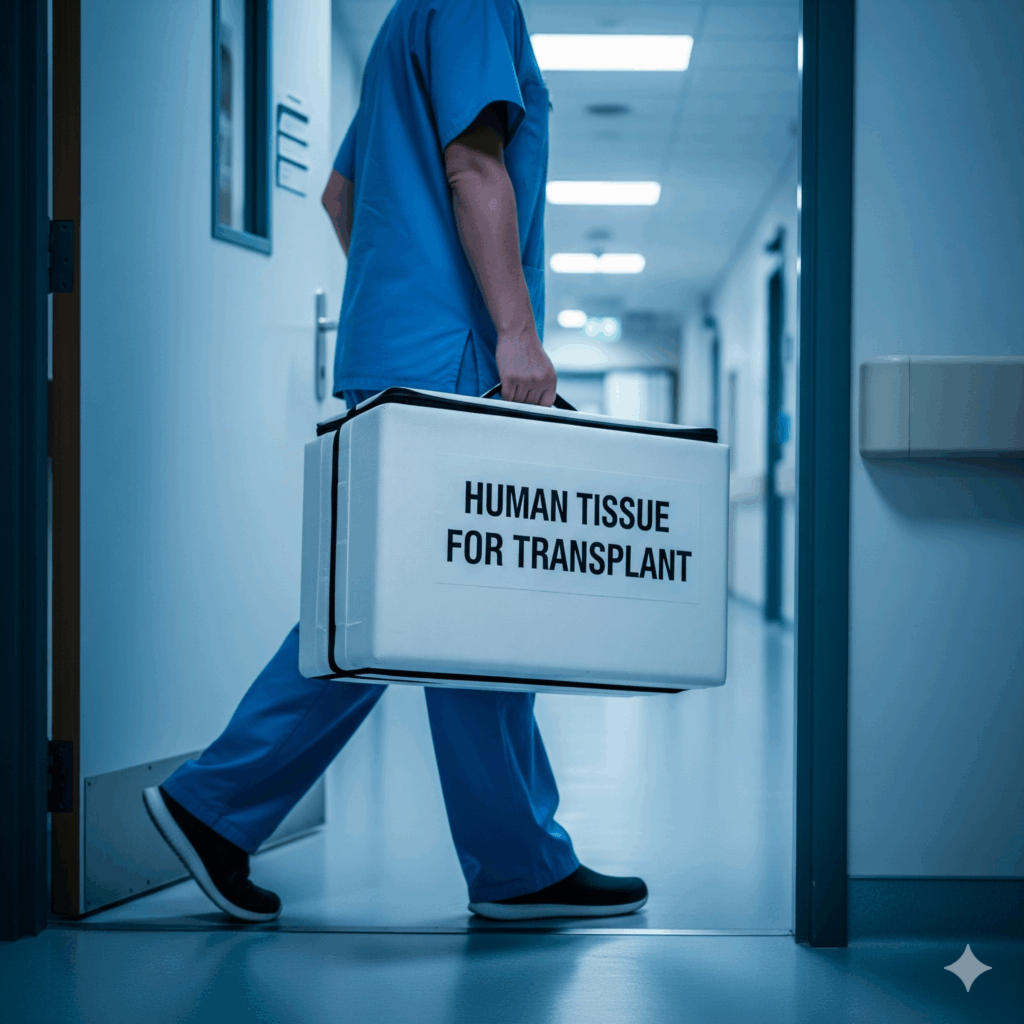Es ist Erntezeit in Iowa, ein Ritual aus Staub und Diesel. Auf dem Fahrersitz eines Mähdreschers, zehneinhalb Meter breit, thront Robb Ewoldt und blickt über sein Land. Die Maschine frisst sich durch das trockene Braun und spuckt einen Strom goldener Sojabohnen aus. Es ist ein Bild uramerikanischer Produktivität. Doch dieses Jahr ist es ein Bild des Überflusses, den niemand will. Die Bohnen, normalerweise das wichtigste Exportgut der USA nach China, haben keinen Käufer mehr. „Wir haben diese Erntesaison keine einzige Bestellung aus China“, klagt Ewoldt. „Die Frage ist nicht mehr, ob wir Geld verlieren, sondern wie viel.“
Das Paradoxe an Ewoldts Misere: Er hat sie mit herbeigewählt. Wie die meisten Farmer hier gab er Donald Trump 2024 zum dritten Mal seine Stimme. Jetzt ruiniert Trumps Zollkrieg sein Geschäft. Doch Ewoldt kritisiert nicht den Mann im Weißen Haus, der Zölle für „das schönste Wort im Wörterbuch“ hält. Nein, er macht Trumps Vorgänger verantwortlich, Joe Biden, der angeblich nicht genug Druck auf Peking ausgeübt habe. In den Feldern von Iowa, zwischen Mais, Schotterstraßen und bissigen Hunden, offenbart sich eine tiefe, fast tragische Spaltung der amerikanischen Seele: eine ideologische Stammesloyalität, die stärker ist als das eigene wirtschaftliche Überleben. Es ist eine Loyalität, die Donald Trump eiskalt einkalkuliert – und die Xi Jinping meisterhaft ausnutzt.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Das Bauernopfer: Trumps politisches Kalkül
Der aktuelle Konflikt ist ein Déjà-vu mit erhöhten Einsätzen. Schon in Trumps erster Amtszeit brachte ein Zollkonflikt die Farmer in Bedrängnis. Doch damals folgte der sogenannte „Phase One Trade Deal“. 2020 gab Xi sein Wort, China würde für 200 Milliarden Dollar zusätzlich US-Waren kaufen – ein Versprechen, das er prompt brach. Das Vertrauen war dahin, noch bevor Trump im April 2025 unter dem Schlachtruf „Liberation Day“ einen neuen, globalen Zollkrieg ausrief, der vor allem China treffen sollte. Pekings Reaktion kam postwendend und war chirurgisch präzise: ein Boykott von US-Sojabohnen. China wusste genau, wen es traf. Es traf nicht die urbanen Eliten, sondern das ländliche Herzland, Trumps Kernwählerschaft.
Man könnte dies für einen politischen Rechenfehler Trumps halten. Doch das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein einkalkuliertes „Bauernopfer“. Trump scheint darauf zu wetten, dass die Farmer zwar wegen des Handelskriegs ächzen, ihm aber als traditionell Konservative treu bleiben werden. Ihre Loyalität, so das Kalkül, ist eher kulturell als ökonomisch motiviert. Ewoldt selbst ist der beste Beweis: Er schüttelte Trump die Hand, eine „tolle Erfahrung“, und verteidigt dessen harte Politik, während seine eigene Farm vor dem Aus steht. Um den Schmerz zu lindern, hat Trump bereits Milliarden an Staatshilfen angekündigt – ein Pflaster für eine Wunde, die er selbst geschlagen hat.
Die Ironie der Geschichte: Als Xi Jinping in Iowas Gästezimmern schlief
Die heutige Konfrontation ist umso bitterer, wenn man ihre Wurzeln betrachtet. Kein Ort in den USA ist enger mit Chinas Aufstieg verwoben als dieser dünn besiedelte Bauernstaat. Hier, in der Kleinstadt Muscatine am Mississippi, unweit von Ewoldts Farm, begann 1985 eine Beziehung, die die Welt verändern sollte. Damals tauchte eine chinesische Agrardelegation auf, deren Leiter ein 31-jähriger Lokalfunktionär aus der Provinz Hebei war, Direktor des Futtermittelverbands. Sein Name: Xi Jinping.
Sarah Lande, heute eine elegante 87-Jährige, war damals im Empfangskomitee. Sie erinnert sich an einen „etwas albernen Kerl mit einem breiten Lächeln“, der „unbekümmert“ wirkte und fragte, ob er mal ihr rotes Cabrio fahren dürfe. Da das Budget knapp war, brachte Lande den jungen Xi bei einer befreundeten Familie unter. Dort schlief der zukünftige Herrscher Chinas in einem Jugendzimmer, unter einer „Star Wars“-Decke und Football-Postern. Fast zwei Wochen lang tourte Xi durch Iowa, lernte von den Farmern, besuchte Saatkonzerne und ließ sich erklären, wie Amerikas Agrarindustrie ihre Effizienz maximierte. „Die USA machen einen sehr guten Eindruck, finde ich“, sagte er damals dem Lokalblatt.
Diese Verbindung hielt. Als Xi 2012, kurz vor seiner Machtübernahme, in die USA zurückkehrte, bestand er darauf, nach Muscatine zu kommen, in Sarah Landes Wohnzimmer. „Für mich seid ihr Amerika“, sagte er seinen alten Gastgebern. Lande und Xi wurden Brieffreunde; noch 2024 schickte er ihr handunterzeichnete Briefe, schwärmte von den „Früchten der Kooperation“ und wünschte „Gesundheit und Wohlstand“.
Doch selbst bei Lande, der treuen Freundin Amerikas in China, bröckelt die Fassade. Sie sorgt sich über Chinas Aufrüstung, die Drohungen gegen Taiwan und Xis enge Umarmung des Kriegstreibers Putin. Die alte Freundschaft, einst ein Symbol der Hoffnung, wird nun von „zwei Egozentrikern“, Trump und Xi, zerrissen. Die Keimzelle der globalen Beziehungen ist zum Epizentrum ihres Zerfalls geworden.
Pekings strategische Wende: Warum China nicht mehr muss
Was als freundschaftliche Neugier begann, war in Wahrheit strategische Forschung. Xi Jinping hat in Iowa nicht nur gelernt, wie man Soja anbaut; er hat gelernt, wie verletzlich Amerikas Herzland ist. Heute braucht China die Farmer aus Iowa längst nicht mehr so dringend wie sie ihn. Das ist die brutale, neue Realität. Peking verfolgt eine glasklare Strategie: Es diversifiziert seine Lieferketten. China hat nicht nur große Bohnenvorräte angelegt, es kauft jetzt massiv beim politischen Partner Brasilien ein – und in Argentinien.
Hier gelang Washington ein diplomatisches und wirtschaftliches Kunststück, das man nur als „bizarres Eigentor“ bezeichnen kann. Im September kündigte die Trump-Regierung einen 20-Milliarden-Dollar-Währungsswap an, um Argentiniens rechter Regierung aus der Peso-Krise zu helfen. Argentinien, verzweifelt auf der Suche nach Devisen, setzte daraufhin seine Ausfuhrzölle für Soja aus, um Exporte anzukurbeln. China griff dankend zu und kaufte das nun spottbillige Soja aus Südamerika. Die US-Regierung hatte mit eigenen Steuergeldern die Konkurrenz für ihre eigenen Farmer subventioniert. In einer verärgerten SMS, die später öffentlich wurde, schrieb wohl Trumps Agrarministerin an den Finanzminister: „Das gibt China mehr Druckmittel gegen uns“. Selbst Trumps Finanzminister Scott Bessent, der Tausende Hektar Sojafelder im Mittleren Westen besitzt, konnte die Katastrophe nicht verhindern.
Die USA sind erpressbar geworden. Während Trump mit neuen Zöllen droht, kontert Peking mit der Verschärfung von Exportkontrollen für Seltene Erden – Rohstoffe, die für US-Militärtechnologie unerlässlich sind und bei denen China fast ein Monopol besitzt. Es ist ein eskalierender Konflikt, in dem die USA ihre stärkste Waffe – die Landwirtschaft – bereits verspielt haben.
Die doppelte Quittung für Amerikas Herzland
Für Farmer wie Dave Walton, einen Bekannten von Ewoldt, ist die Lage eine „Vollkatastrophe in Zeitlupe“. Er hat die Ernte komplett eingelagert. „Dieses Jahr verkaufe ich gar keine Bohnen“, sagt er. Die kurzfristige Senkung einiger Zölle ändert daran nichts. Es ist eine doppelte Bestrafung, denn die Farmer schneiden sich „doppelt ins eigene Fleisch“. Während ihre Einnahmen durch den Boykott wegbrechen, explodieren ihre Ausgaben. Denn viele Betriebsmittel, auf die sie zwingend angewiesen sind, etwa Dünger oder Pestizide, importieren sie ironischerweise aus China. Trumps Zölle verteuern also auch ihre Produktion.
Die Botschaften, die Farmer Walton an die Mächtigen sendet, klingen verzweifelt. An Trump: „Ich möchte, dass unser Präsident weiß, dass uns das schadet. Wir wollen Freihandel“. Und an Xi: „Wir stehen bereit, wieder zu liefern“. Walton will Xi an seine Zeit in Iowa erinnern, „an all die Dinge, die er von uns gelernt hat, um Chinas Landwirtschaft zu verbessern“. Es ist eine fast rührende Hoffnung, doch sie verkennt die Realität. Die langfristige Gefahr ist nicht nur ein verlorenes Erntejahr; es ist ein dauerhaft verlorener Kunde. Vierzig Jahre, nachdem der junge Xi Jinping mit einem breiten Lächeln in Muscatine auftauchte, um zu lernen, müssen sich Iowas Farmer fragen, ob sie ihm damals nicht noch etwas anderes beigebracht haben: wie man ihnen am effektivsten wehtut. Die Lektionen von 1985 waren erfolgreich. Heute nutzt der Schüler sein Wissen, um den alten Lehrer in die Knie zu zwingen. Und Amerikas Präsident schaut zu – gestützt von den Stimmen derer, die er opfert.