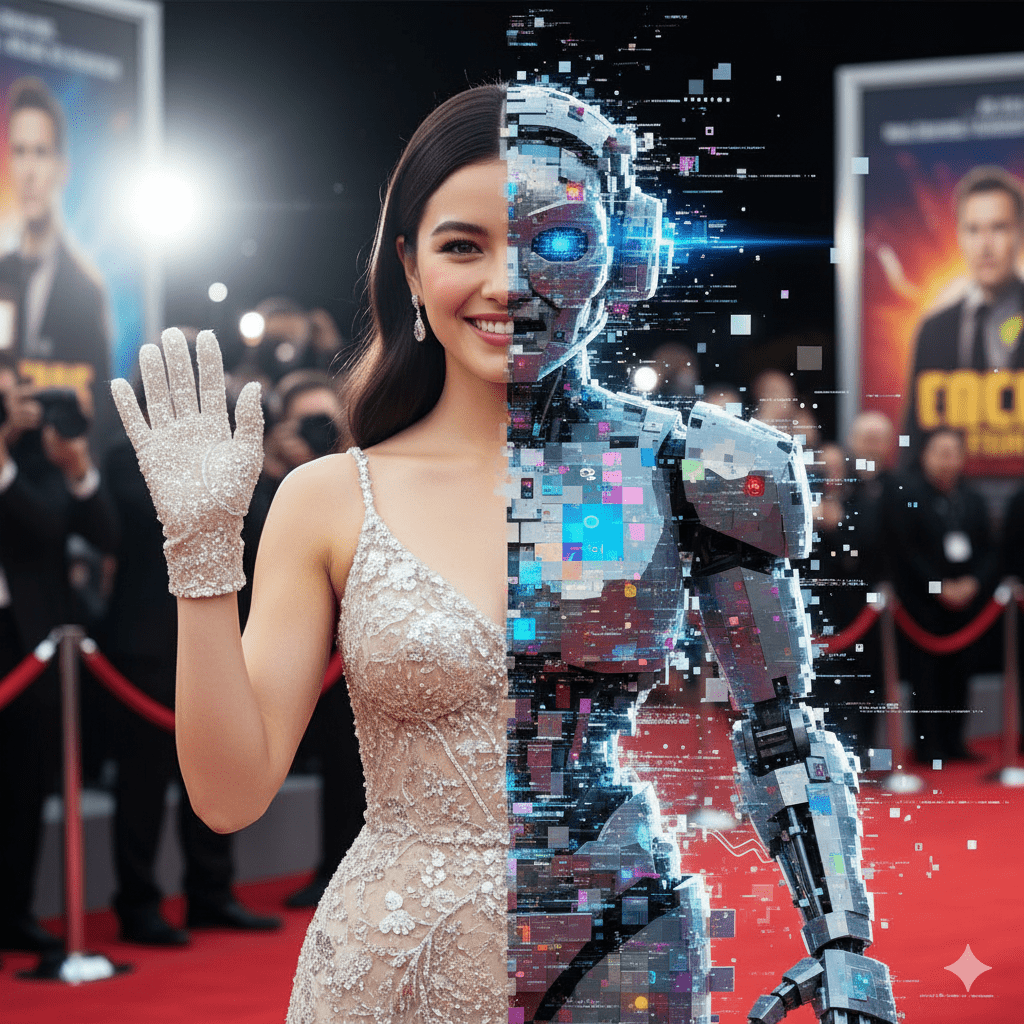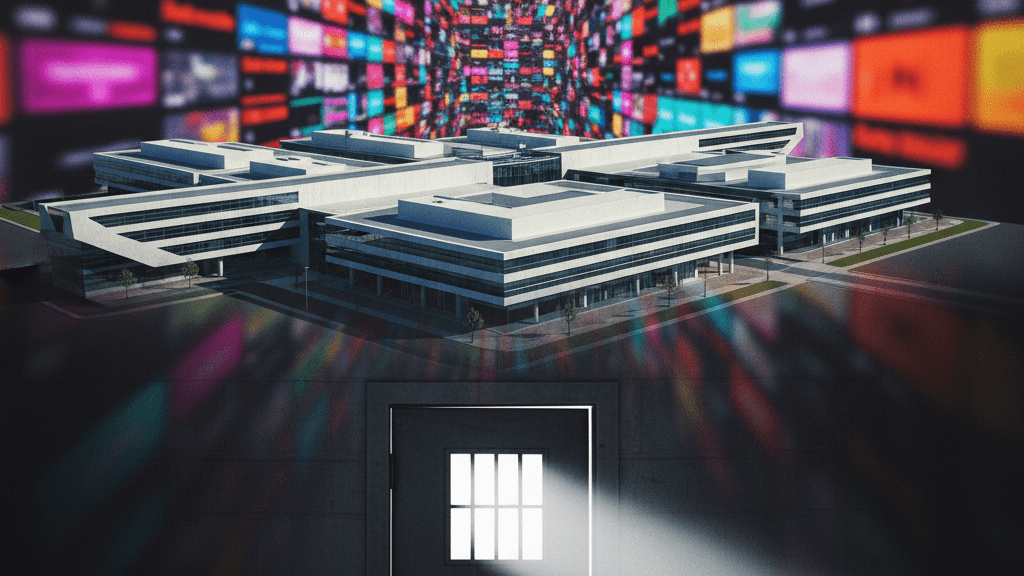
Neun Monate nach Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump verfestigt sich das Bild einer Nation, die an mehreren Fronten gleichzeitig einen Kampf um ihre Identität und ihre Institutionen führt. Die vergangene Woche offenbarte mit einer seltenen Dichte die Konturen dieses Konflikts: Eine Regierung, die Loyalität über das Gesetz stellt, die Presse als Gegner behandelt und ihre Macht zur Durchsetzung einer ideologischen Agenda nutzt, trifft auf einen wachsenden, organisierten Widerstand auf den Straßen. Gleichzeitig eskaliert eine unberechenbare, transaktionale Außenpolitik von der Ukraine bis Venezuela, während im Inneren die Weichen für eine neue, von politischen Interessen gesteuerte Medien- und Technologielandschaft gestellt werden.
Diese politische Zerreißprobe findet vor dem Hintergrund eines wirtschaftlichen Doppelspiels zwischen KI-Boom und industriellem Niedergang sowie dem stillen Versagen im Angesicht existenzieller Umweltkrisen statt. Es ist das Panorama eines „spirituellen Krieges“, der nicht mehr nur zwischen Parteien, sondern zwischen fundamental unterschiedlichen Visionen von Amerika ausgefochten wird.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die Festung des Schweigens: Das Pentagon im Krieg mit der Presse
Der vielleicht offenste Angriff auf eine demokratische Institution dieser Woche kam aus dem Verteidigungsministerium. Unter dem neuen Verteidigungsminister Pete Hegseth, einem ehemaligen Fox-News-Moderator, eskaliert der Konflikt zwischen dem Pentagon und der Presse zu einer fundamentalen Konfrontation. Hegseth legte neue Vorschriften vor, die von der Pentagon Press Association als „schwarzer Tag für die Pressefreiheit“ bezeichnet wurden.
Kern des Anstoßes ist ein 21-seitiges Dokument, das ein bisher einseitiges Formular ersetzt. Es etabliert ein drakonisches Kontrollregime, das unabhängige Berichterstattung verunmöglicht. Journalisten dürfen sich nur noch in eng definierten Zonen ohne Eskorte bewegen; informelle Gespräche auf den Gängen, oft die Lebensader investigativer Arbeit, werden damit unterbunden.
Die perfideste Klausel ist jedoch das Verbot, nicht-autorisierte Informationen „anzufordern“ (soliciting). Dies kriminalisiert den Kern des journalistischen Handwerks: das Nachfragen. Kritiker und Rechtsbeistände der Medien sehen darin eine Form der „Vorzensur“ (prior restraint), die als schwerwiegendste Verletzung des Ersten Verfassungszusatzes gilt. Wer sich nicht an die offiziellen Informationen hält oder dagegen verstößt, kann als „Sicherheitsrisiko“ eingestuft und seine Akkreditierung verlieren. Bis Mittwoch musste die Verpflichtung unterzeichnet sein.
Hegseths persönlicher Feldzug gegen die Medien zeigte sich bereits, als er Redaktionen wie die New York Times, Washington Post und NPR aus ihren Büros entfernen ließ, um Platz für regierungsfreundlichere Sender wie Newsmax und One America News Network (OAN) zu schaffen.
Die Reaktion der sonst so zerstrittenen US-Medienlandschaft ist beispiellos. In einer seltenen Demonstration der Einigkeit weigert sich fast das gesamte Pressekorps, die Knebelverträge zu unterzeichnen. Die Front reicht von liberalen Aushängeschildern wie der New York Times, der Washington Post und NPR bis hin zu konservativen Adressen wie Newsmax, dem Washington Examiner und dem Daily Caller. Selbst die traditionellen Rivalen CNN und Fox News veröffentlichten gemeinsam mit ABC, CBS und NBC eine Protestnote, in der sie die Politik als „beispiellos“ und als Bedrohung „grundlegender journalistischer Schutzmaßnahmen“ verurteilten. Bislang hat offenbar nur ein einziges Medium seine Bereitschaft zur Unterzeichnung signalisiert: der ultra-rechte Sender OAN.
Das Santos-Signal: Wenn Loyalität über dem Gesetz steht
Parallel zur Aushebelung der Kontrollinstanzen zementiert die Trump-Administration ein System, in dem performative Loyalität zur einzigen relevanten Währung wird – und Verbrechen gegen die Gesellschaft zur Nebensache. Das definierende Ereignis dieser Woche war die Umwandlung der Haftstrafe des ehemaligen Kongressabgeordneten George Santos durch Präsident Trump.
Santos, dessen Name zum Synonym für dreiste Hochstapelei wurde, war im April zu einer mehr als siebenjährigen Bundesgefängnisstrafe verurteilt worden. Er hatte sich des schweren Identitätsdiebstahls und Drahtbetrugs schuldig bekannt. Es ging nicht nur um Lügen über Volleyball-Karrieren oder Holocaust-Vorfahren; Santos stahl Kreditkarteninformationen seiner eigenen Spender, um sich persönlich zu bereichern, fälschte Wahlkampffinanzunterlagen und bezog unrechtmäßig Arbeitslosenunterstützung.
Nach nur 84 Tagen im Gefängnis ist er nun ein freier Mann. Seiner Freilassung ging eine methodische Kampagne aus dem Gefängnis voraus: Santos stilisierte sich in regelmäßigen Kolumnen für eine Lokalzeitung auf Long Island als Opfer unhaltbarer Haftbedingungen („Schimmel an der Decke“, „langsame Form der Folter“) und appellierte schließlich in einem offenen Brief direkt an Trumps „Sinn für Gerechtigkeit“ und seine eigene „unerschütterliche Loyalität“.
Die Begründung des Präsidenten für die Milde ist eine Offenbarung der Logik seiner Amtszeit. Trump wog Santos‘ Verbrechen gegen die Lügen von Senator Richard Blumenthal über dessen Militärdienst ab und kam zu dem Schluss: Blumenthals Lügen seien „viel schlimmer“ gewesen, denn „wenigstens hatte Santos den Mut, die Überzeugung und die Intelligenz, IMMER REPUBLIKANISCH ZU STIMMEN!“.
Absolute Loyalität schlägt jedes Verbrechen. Diese Botschaft wird durch die vielleicht brutalste Facette der Entscheidung untermauert: Trumps Anordnung entbindet Santos nicht nur von der Haft, sondern auch von allen „weiteren Geldstrafen, Restitutionen, Bewährungsauflagen oder anderen Bedingungen“. Die mehr als 370.000 Dollar, die er seinen Opfern gerichtlich angeordnet zurückzahlen sollte, muss er nicht entrichten. Für die Opfer ist dies eine Verhöhnung. Der Navy-Veteran Richard Osthoff, dessen Diensthund starb, nachdem Santos die 3.000 Dollar aus einer GoFundMe-Kampagne für die lebensrettende Operation des Tieres gestohlen hatte, beschrieb die Nachricht als „widerlich und krankmachend“. Er fühle sich, als hätte ihm „der Präsident der Vereinigten Staaten persönlich ein Messer in den Bauch gerammt“.
Justiz im Visier: Von Anklagen gegen Kritiker und der Jagd auf „Hate Speech“
Während Loyalisten wie Santos belohnt werden, geraten Kritiker der Administration und unliebsame Meinungen ins Visier der Justiz. In Maryland plädierte in dieser Woche John Bolton, Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater und späterer Kritiker, auf nicht schuldig. Eine Geschworenenjury hatte den 76-Jährigen am Donnerstag wegen 18 Anklagepunkten angeklagt. Die Vorwürfe: Weitergabe vertraulicher Informationen und unrechtmäßige Aufbewahrung streng geheimer Dokumente in seinem Haus. Bolton selbst bezeichnete die Anklage als jüngstes Ziel „in dem Versuch, das Justizministerium als Waffe einzusetzen – gegen Menschen, die er als Feinde sieht“. Die Parallele zur Santos-Begnadigung ist offensichtlich: Das Kriterium für Strafverfolgung oder Milde scheint nicht die Tat, sondern die Haltung zum Präsidenten zu sein.
Gleichzeitig verschärft die Regierung ihren Kurs gegen als „Hate Speech“ definierte Äußerungen, ein Konzept, das in den USA verfassungsrechtlich eigentlich nicht existiert. Anlass ist die Ermordung des rechten Aktivisten Charlie Kirk am 10. September, den Trump diese Woche posthum mit der Freiheitsmedaille ehrte. Das US-Außenministerium gab bekannt, sechs ausländischen Staatsbürgern das Visum entzogen zu haben, weil sie sich online abfällig über Kirks Tod geäußert hatten. Die USA seien nicht verpflichtet, „Ausländern Gastrecht zu gewähren, die Amerikanern den Tod wünschen“. Betroffen ist unter anderem der deutsche Publizist Mario Sixtus, der auf Bluesky schrieb: „Wenn Faschisten sterben, jammern Demokraten nicht“. Ebenso der südafrikanische Musikmanager Nhlamulo Baloyi, dem sein bis 2032 gültiges Visum entzogen wurde, weil er Kirks Anhänger als „weißen nationalistischen Müll“ (trash) bezeichnet hatte. Diese Schritte fügen sich in eine breitere Strategie: Justizministerin Pam Bondi kündigte bereits an, „Hate Speech“ verfolgen zu wollen, und Vizepräsident J. D. Vance drohte sogar jenen mit Konsequenzen, die lediglich auf Kirks „kontroverse Aussagen hinweisen“. Die Regierung dehnt den Begriff der strafbaren Äußerung massiv aus und setzt ihn als Waffe gegen Kritiker ein.
„No Kings“: Der patriotische Aufstand gegen die Exekutive
Die Antwort der Zivilgesellschaft auf die als monarchisch empfundenen Machtübernahmen der Trump-Regierung manifestierte sich am Samstag, dem 18. Oktober: Unter dem Slogan „No Kings“ – Keine Könige – gingen fast sieben Millionen Menschen in über 2.700 Orten auf die Straße, die größte koordinierte Demonstration der jüngeren US-Geschichte. Der Protest, der bereits im Sommer Millionen mobilisiert hatte, richtet sich gegen die Kumulation exekutiver Übergriffe: den seit Wochen andauernden Government Shutdown, die aggressiven Taktiken der Einwanderungsbehörde ICE und den Versuch Trumps, die Nationalgarde gegen den Willen lokaler Regierungen in demokratisch geführten Städten einzusetzen.
Die Bewegung begegnet der Dämonisierung durch die Republikanische Partei – die von „Hass auf Amerika“-Kundgebungen, unterwandert von Marxisten und Hamas-Sympathisanten, spricht – mit einer brillanten Doppelstrategie. Erstens mit einer „patriotischen Rückaneignung“: Demonstranten, darunter viele Veteranen, schwenken demonstrativ US-Flaggen und zitieren die Verfassung, um zu signalisieren, dass sie Amerika nicht hassen, sondern es im Geiste von 1776 gegen Tyrannei verteidigen. Zweitens nutzen sie „strategische Frivolität“: Tausende Teilnehmer in bunten Kostümen – Frösche, Hasen, Bananen – entlarven das Narrativ des „gewalttätigen Mobs“ durch pure Absurdität. Es ist die als „peinlich“ (cringe) verspottete Aufrichtigkeit, die sich als radikalste Waffe gegen den allgegenwärtigen Zynismus erweist.
Eskalation in den Städten: Portland und Chicago im Fadenkreuz
Wie real die Bedrohungen sind, gegen die sich die „No Kings“-Bewegung formiert, zeigt die Lage in Städten wie Portland und Chicago. US-Präsident Trump hat das liberale Portland zur „Kriegszone“ erklärt und erwägt die Entsendung der Nationalgarde. Bürgermeister Keith Wilson (Demokrat) nannte die Situation gegenüber der Presse „surreal“. Der Streitpunkt sind Proteste vor der örtlichen ICE-Zentrale. Laut Wilson bedient die Regierung ein „falsches Narrativ“ einer brennenden Stadt, um härtere Einwanderungspolitik durchzusetzen. Tatsächlich gehen ICE-Beamte laut dem Bürgermeister brutal vor: „Die Leute werden von ICE aus ihren Autos gezerrt. Väter, die ihre Kinder zur Schule bringen, werden… eingesackt. Und verschwinden“. Oregons „Sanctuary“-Gesetze verbieten den städtischen Behörden die Kooperation mit ICE, ein Gerichtsurteil blockiert derzeit noch den Einsatz der Nationalgarde.
Dieselbe Auseinandersetzung findet in Chicago statt. Auch hier will Trump die Nationalgarde einsetzen, um angeblich ICE-Beamte zu schützen. Bundesrichterin April Perry hatte den Einsatz blockiert, da sie „keine stichhaltigen Beweise“ für die von Trump behauptete „Gefahr einer Rebellion“ fand. Diese Entscheidung wurde von einem Berufungsgericht bestätigt. Nun hat die Trump-Regierung den Fall vor den konservativ dominierten Supreme Court gebracht – ein Testfall für die Grenzen der exekutiven Macht und des Föderalismus.
Shutdown und ideologische Gräben
Als politischer Brandbeschleuniger für die Proteste dient der seit dem 1. Oktober andauernde „Government Shutdown“. Hunderttausende Bundesangestellte sind im Zwangsurlaub oder arbeiten ohne Bezahlung. In dieser Woche scheiterte im US-Senat bereits der zehnte von den Republikanern vorgeschlagene Übergangshaushalt. Die Republikaner verfügen über 51 Stimmen, benötigen aber 60, um die Blockade der Demokraten zu überwinden. Die Demokraten werfen den Republikanern vor, eine Einigung wegen Forderungen bei der Krankenversicherung zu blockieren.
Dieser Stillstand ist jedoch mehr als nur politisches Gezänkel. Er ist Ausdruck jenes „spirituellen Krieges“, den Trumps Minister wie Pete Hegseth proklamiert haben. Die zweite Trump-Administration wird getragen von einer Symbiose aus der MAGA-Bewegung und einem aggressiven christlichen Nationalismus. Schlüsselfiguren wie Stephen Miller, Pete Hegseth, Vizepräsident J. D. Vance und Sprecher Mike Johnson teilen die Vision eines Amerikas, das von Christen für Christen gegründet wurde und auf einer „natürlichen Ordnung“ (basierend auf Religion, Rasse, Geschlecht) beruht. Ein Manifest dieser Ideologie ist Trumps eigene Bibel-Edition, in der die Verfassung ohne die Zusätze 11 bis 27 abgedruckt ist – es fehlen also unter anderem die Abschaffung der Sklaverei und das Wahlrecht für Frauen. Dieser ideologische Rigorismus führt zu einem moralischen Kollaps, der sich in den Chatprotokollen Junger Republikaner zeigt. Wenn dort mit „I love Hitler“ oder Gaskammer-Witzen hantiert wird, ist das kein Ausrutscher. Es ist der Beleg, dass ethisches Urteilsvermögen dem Partisanenkalkül untergeordnet wird. Vizepräsident J. D. Vance weigerte sich, die Chats zu verurteilen, und tat sie als „dumme Witze“ von „Kids“ ab – eine kalte Kalkulation, um die radikale Basis nicht zu verstoßen.
Das Tomahawk-Gambit: Trumps riskantes Spiel mit der Ukraine
Diese innenpolitische Kompromisslosigkeit spiegelt sich in einer unberechenbaren und hochriskanten Außenpolitik. Die wichtigste Entwicklung der Woche war Trumps diplomatischer Schwenk im Ukraine-Krieg.
Die Woche begann mit dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus, der als Hauptanliegen die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern im Gepäck hatte. Selenskyj bot Trump sogar einen Tausch an: Tomahawks gegen Tausende ukrainische Drohnen, an denen die USA Interesse hätten. Trump gab sich jedoch reserviert: „Ich will, dass der Krieg endet“, sagte er und betonte, die USA würden keine Waffen abgeben, „die wir selbst benötigen, um unser Land zu schützen“.
Der wahre Grund für Trumps Zurückhaltung offenbarte sich kurz darauf: Der US-Präsident führte ein mehr als zweistündiges Telefonat mit Wladimir Putin. Das direkte Resultat: Trump kündigte einen neuen Gipfel mit dem russischen Präsidenten an, der bereits in den nächsten beiden Wochen in Budapest stattfinden soll. (Ungarn wurde gewählt, da Ministerpräsident Orbán klargemacht hat, dass der mit internationalem Haftbefehl gesuchte Putin dort einreisen kann).
Dieses Telefonat, das auf Putins Initiative zurückging, sabotierte Selenskyjs Besuch und ließ die Ukrainer „kalt erwischt“ zurück. Putin-Berater Uschakow bestätigte, der russische Präsident habe Trump informiert, dass die Lieferung von Tomahawks die Beziehungen „schwer beschädigen“ würde.
Analysen deuten dieses Manöver als „Tomahawk-Gambit“. Trump agiere nicht als Falke, sondern nutze die Androhung der Eskalation (Tomahawks mit potenzieller Reichweite bis Moskau) als ultimativen Hebel, um Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen, den dieser bislang verweigert. Es ist die Überzeugung, dass der Kreml, wie auch Polens Außenminister Sikorski argumentiert, nur die Sprache der Stärke versteht.
Dieses riskante Spiel findet statt, während Russland seinen Krieg eskaliert. Mit dem nahenden Winter hat Moskau eine neue Taktik begonnen: Statt nur Stromanlagen zielt es nun präzise auf die Gasversorgung in ländlichen Regionen, um Chaos zu säen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu brechen. Die Ukraine schlägt ihrerseits mit Drohnenangriffen auf Ölraffinerien tief in Russland zurück – mutmaßlich unterstützt durch US-Geheimdienstinformationen.
„MAGA all the way“: Wie Trump Argentinien rettet und China bekämpft
Wie Trumps transaktionale „America First“-Politik funktioniert, zeigte der Besuch des argentinischen Präsidenten Javier Milei. Milei, der mit Kettensägen-Auftritten und Attacken auf die „woke Linke“ als „MAGA all the way“ gilt, kam als Bittsteller. Seine radikale Sparpolitik hat das Land in eine schwere Währungskrise gestürzt.
Trump belohnte die ideologische Treue: Die USA kündigten ein Rahmenabkommen über einen Währungstausch von 20 Milliarden Dollar an, um Argentinien und Milei vor dem Scheitern zu bewahren. Diese „Nachbarschaftshilfe“ ist jedoch an eine klare Bedingung geknüpft. Trump drohte Milei bei der gemeinsamen Pressekonferenz offen, die USA würden ihre Zeit nicht „verschwenden“ und nicht „großzügig“ sein, sollte Milei bei den bevorstehenden Zwischenwahlen Ende Oktober verlieren und seine „extrem linksgerichteten“ Gegner siegen.
Das eigentliche Ziel der Rettungsaktion ist geopolitisch: Die US-Regierung will verhindern, dass ein wirtschaftlich kollabiertes Argentinien näher an China heranrückt. Washington sorgt sich um den Zugriff Chinas auf die bedeutenden Uran- und Lithiumvorräte des Landes.
Washingtons venezolanische Schizophrenie: Schattenkrieg und Öl-Deals
Während Verbündete mit Milliarden gerettet werden, fährt die Administration einen aggressiven Kurs gegen Gegner wie Venezuela. US-Medien berichteten diese Woche über massive Militäroperationen vor der Küste des Landes, darunter der Einsatz von B-52-Langstreckenbombern. Seit Anfang September haben die USA bereits fünfmal mutmaßliche Drogenschmuggelboote angegriffen, wobei mindestens 27 Menschen getötet wurden. Trump selbst hat zudem verdeckte CIA-Aktionen in Venezuela autorisiert.
Analysten bezeichnen die US-Strategie als „strategische Inkohärenz“ und „Schizophrenie“. Der „Krieg gegen Drogen“ diene lediglich als „fadenscheiniger Vorwand“ für das eigentliche Ziel: einen Regimewechsel in Caracas. Die Hauptschmuggelrouten lägen laut DEA ohnehin im Pazifik, nicht in der Karibik. Die USA agieren in einem juristischen Niemandsland und deklarieren die Besatzungen der Boote zu „widerrechtlichen Kämpfern“ (unlawful combatants), um sie außerhalb rechtsstaatlicher Verfahren töten zu können. Inmitten dieser Eskalation wurde bekannt, dass Verteidigungsminister Hegseth den Befehlshaber der US-Streitkräfte in Lateinamerika, Admiral Alvin Holsey, nach nur einem Jahr im Amt und Berichten über Spannungen überraschend entlässt.
Das größte Paradoxon dieser Politik: Während der militärische Arm einen „Schattenkrieg“ führt, erlaubt die Administration dem US-Ölmulti Chevron, mit expliziter Genehmigung Washingtons weiter im Land zu operieren. Chevron ist damit die „wichtigste legale Einnahmequelle“ für das Maduro-Regime, das Washington gleichzeitig zu stürzen versucht.
TrumpTok: Die feindliche Übernahme des Algorithmus
Die Konsolidierung der Macht im Inneren beschränkt sich nicht auf Regierungsinstitutionen. In dieser Woche wurden die Details des bevorstehenden Verkaufs der US-Sparte von TikTok bekannt. Der Vorgang entpuppt sich als ein „sorgfältig orchestrierter Coup“ und ein „Akt des reinsten Klientelismus“.
Trump, der in seiner ersten Amtszeit noch als erbitterter Gegner der App auftrat (wohl auch aus Kränkung über einen von TikTok-Nutzern sabotierten Wahlkampfauftritt), hat sich zum Paten des Deals gewandelt. Statt einer transparenten Auktion wird die hochprofitable Plattform an ein handverlesenes Konsortium von Trump-Loyalisten verkauft: den Oracle-Gründer Larry Ellison und die Murdoch-Familie. Der Preis ist ein „Milliardengeschenk“: Statt des geschätzten Marktwerts von mindestens 40 Milliarden Dollar soll der Deal für lediglich 14 Milliarden Dollar abgeschlossen werden.
Das Ziel ist die Schaffung eines „MAGA-Tok“. Die neuen Eigentümer erhalten die Kontrolle über den psychologisch hochwirksamen Algorithmus, der Nutzer binnen Monaten auf über 70 Minuten Verweildauer täglich treibt und nachweislich die Selbstkontrolle senkt. Mit dieser Kontrolle können Narrative gesetzt, regierungskritische Inhalte unterdrückt und Propaganda normalisiert werden.
Das Absurdeste daran: Die ursprünglich vorgeschobenen nationalen Sicherheitsbedenken werden komplett ignoriert. Der chinesische Mutterkonzern ByteDance soll auch nach dem Verkauf mit rund 20 Prozent beteiligt bleiben und – entscheidend – den Kern des Algorithmus weiterhin lizenzieren. Der „Schutz amerikanischer Nutzerdaten“ war offensichtlich nur ein Feigenblatt für einen Akt der politischen Patronage.
Amerikas gefährliches Doppelspiel: Zwischen KI-Boom und Rost-Gürtel
Dieses Vorgehen spiegelt sich in der Wirtschaftspolitik, die eine gefährliche „Zweiteilung der Wirtschaft“ forciert. Auf der einen Seite steht ein spekulativer KI-Boom: Im ersten Halbjahr 2025 stiegen die Investitionen in Datenzentren um 37 Prozent, KI-Start-ups sammeln Milliarden ein. Auf der anderen Seite erodiert das produzierende Gewerbe, Trumps einstige Kernwählerschaft. Seit Jahresbeginn gingen 38.000 Arbeitsplätze in der Industrie verloren, die Investitionen sanken um sechs Prozent.
Trumps protektionistische Zollpolitik ist weitgehend gescheitert; statt die Industrie zu schützen, hat sie Vorprodukte verteuert. Dieser Wandel schafft eine soziale Spaltung: eine kleine, hochbezahlte KI-Elite hier, eine schrumpfende, abgehängte Industriemittelschicht dort.
Gleichzeitig verliert Amerika auf diesem neuen Feld geopolitisch. Während US-Firmen wie OpenAI auf geschlossene, proprietäre KI-Modelle setzen, hat China die Führung im strategisch entscheidenden Bereich der Open-Source-KI übernommen. Chinesische Firmen wie Alibaba und DeepSeek dominieren die globalen Ranglisten. Indem sie ihre Modelle frei teilen, bauen sie globale Ökosysteme auf und die Standards von morgen setzen – eine stille Revolution, die Amerikas „Festungsmentalität“ im KI-Sektor ins Leere laufen lässt.
Die unsichtbaren Krisen: Was unter der Oberfläche lauert
Während Washington mit seinen politischen Grabenkämpfen und Technologiesprüngen beschäftigt ist, eskalieren zwei tiefgreifende, aber weitgehend ignorierte Umweltkrisen.
Die erste ist die Krise der „Ewigkeitschemikalien“ (PFAS). Diese praktisch unzerstörbaren Kohlenstoff-Fluor-Verbindungen, die in Antihaft-Pfannen, Pizzakartons und Regenjacken verwendet werden, reichern sich im Blut von nahezu jedem Menschen an. Die Industrie wusste, ähnlich wie bei Asbest oder Blei, seit Jahrzehnten von der Toxizität, verschwieg diese aber. Die Krise ist auch eine der sozialen Gerechtigkeit, da sich die Kontamination an „Hotspots“ wie Industrieparks, Militärbasen und in ärmeren Gemeinden konzentriert. Während die EU ein Verbot vorantreibt, schwächen die USA teils Schutzstandards, und die Industrie nutzt eine „Rhetorik der Verzögerung“, um Regulierung zu verhindern.
Die zweite Krise ist die der Mikro- und Nanoplastikpartikel. Diese sind nicht nur in den Ozeanen, sondern haben längst die Blut-Hirn-Schranke überwunden und wurden in Herzen und Gehirnen nachgewiesen. Wärme, etwa in Mikrowellen oder bei Kaffee-To-Go-Bechern, beschleunigt die Freisetzung von Milliarden Partikeln dramatisch.
Die verheerendste Erkenntnis der Woche ist das „Recycling-Paradoxon“: Recycling ist nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. Eine Studie einer modernen Recyclinganlage in Großbritannien ergab, dass die Anlage selbst eine massive Quelle von Mikroplastik ist und potenziell bis zu 13 Prozent des verarbeiteten Materials als winzige, bioverfügbare Partikel wieder in die Umwelt entlässt. Wir wandeln sichtbaren „Makro-Müll“ in unsichtbaren „Mikro-Müll“ um.
Selbst individuelle Vermeidungsstrategien greifen zu kurz. Studien zeigten, dass Getränke in Glasflaschen mit Metallverschlüssen teils höhere Konzentrationen aufwiesen als PET-Flaschen – die Partikel stammten von der Polyesterfarbe der Deckel. Die Kontamination ist systemisch und betrifft auch die Landwirtschaft, wo sie die Photosyntheseleistung global um bis zu 12 Prozent reduziert und das Gedächtnis von Bienen schädigt.
Diese Woche schließt mit dem Bild einer Supermacht, die ihre enormen Energien auf interne Machtkämpfe, die Belohnung von Loyalisten und die Bestrafung von Kritikern konzentriert. Während die Regierung die Kontrolle über Gerichte, Medien und Algorithmen anstrebt, bleiben die fundamentalen Krisen – von der sozialen Spaltung bis zur toxischen Durchdringung unseres Planeten – ungelöst.