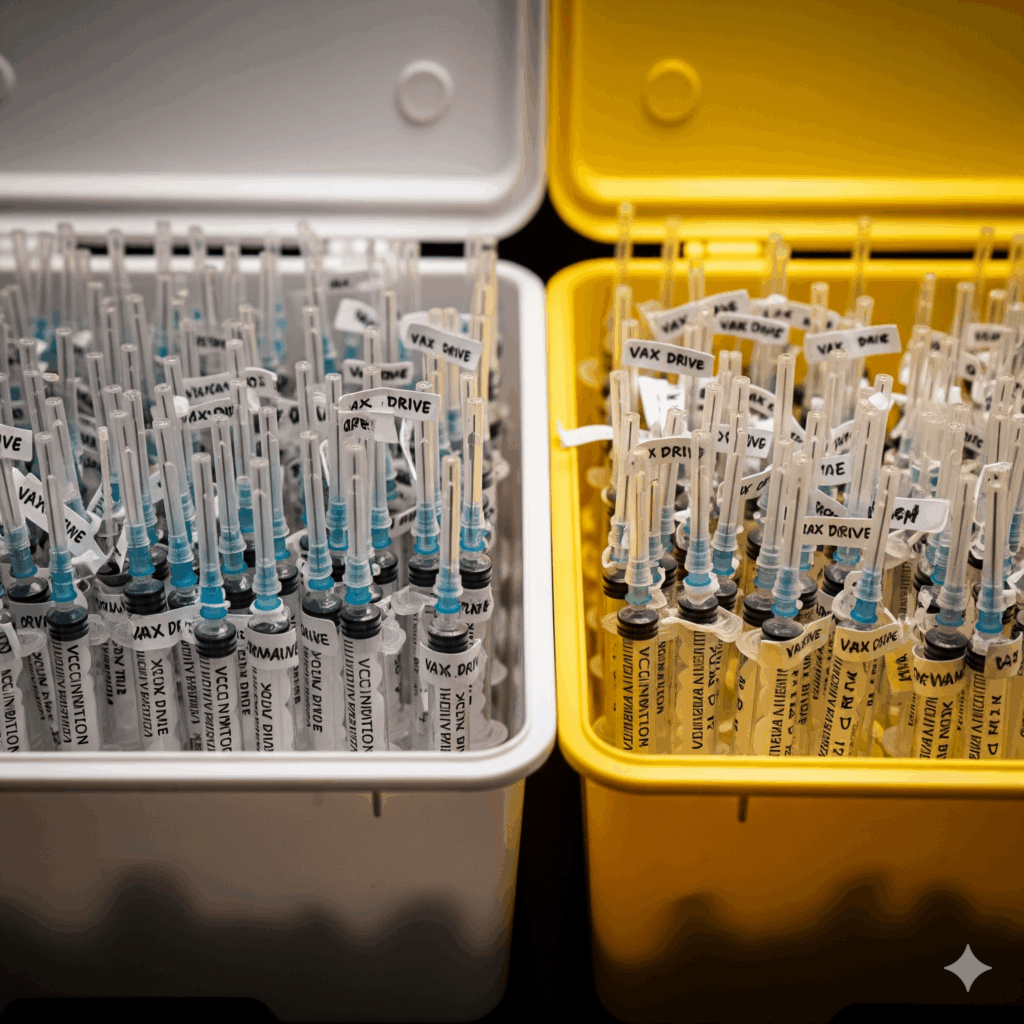In den warmen Gewässern der Karibik, weit entfernt von den Schlagzeilen eines innenpolitisch zerrissenen Amerikas, entfaltet sich eine militärische Operation von weitreichender, beunruhigender Bedeutung. Unter dem Banner eines neu ausgerufenen „Kriegs gegen den Narko-Terrorismus“ hat die Regierung von Präsident Donald Trump eine Armada von Kriegsschiffen mobilisiert und führt tödliche Schläge gegen kleine, zivile Boote. Die offizielle Lesart aus Washington ist die eines entschlossenen Aktes der Selbstverteidigung, eines notwendigen militärischen Eingriffs, um die Flut todbringender Drogen an den Küsten der Vereinigten Staaten zu stoppen. Doch bei genauerer Betrachtung der Fakten, der internen Machtkämpfe in Washington und der historischen Kontexte entpuppt sich diese Erzählung als ein gefährliches Konstrukt. Vieles deutet darauf hin, dass dieser sogenannte Krieg weniger dem Schutz amerikanischer Bürger dient als vielmehr der Vollendung einer persönlichen, fast schon obsessiven Mission: dem Sturz des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Es ist die Fortsetzung einer gescheiterten Politik aus Trumps erster Amtszeit, nun jedoch eskaliert mit militärischer Gewalt, die das Völkerrecht bis zur Unkenntlichkeit dehnt und droht, eine ganze Region in einen unkontrollierbaren Konflikt zu stürzen.
Die juristische Neudefinition des Konflikts
Um die außergerichtlichen Tötungen auf offener See zu ermöglichen, hat die Trump-Administration einen bemerkenswerten juristischen Schachzug vollzogen: Sie hat ein Problem der Strafverfolgung in einen „bewaffneten Konflikt“ umdeklariert. Dieser fundamentale Wandel wurde durch mehrere administrative Schritte zementiert. Zunächst wurden bestimmte lateinamerikanische kriminelle Gruppen, darunter die venezolanische Bande Tren de Aragua, willkürlich zu ausländischen Terrororganisationen erklärt. Dieser Akt allein schuf die begriffliche Grundlage, um von „Narko-Terroristen“ statt von Kriminellen zu sprechen. Der entscheidende Schritt folgte mit einer formellen, als geheim eingestuften Benachrichtigung an den Kongress. Darin legte Präsident Trump seine „Entscheidung“ dar, dass sich die Vereinigten Staaten in einem „nicht-internationalen bewaffneten Konflikt“ mit diesen neu deklarierten Terrororganisationen befänden.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Diese Deklaration ist der juristische Dreh- und Angelpunkt der gesamten Operation. Sie erlaubt es dem Pentagon, das Kriegsrecht anzuwenden, was im Kern bedeutet, dass mutmaßliche Gegner als „ungesetzliche Kombattanten“ behandelt und ohne Anklage oder Gerichtsverfahren getötet werden dürfen. Dies ist eine radikale Abkehr von der bisherigen Praxis, bei der die Küstenwache und die Drogenbekämpfungsbehörde DEA Verdächtige verhafteten und der Justiz zuführten. Die Begründung für diesen Paradigmenwechsel ist dünn und juristisch höchst umstritten. Während der „Krieg gegen den Terror“ nach den Anschlägen vom 11. September 2001 als Reaktion auf einen direkten, militärisch organisierten Angriff auf die USA legitimiert wurde, fehlt ein solcher Auslöser im Fall der Kartelle. Drogenkartelle, so argumentieren zahlreiche Rechtsexperten, verfolgen primär wirtschaftliche, nicht ideologisch-politische Ziele. Ihre Gewalt dient der Sicherung von Märkten und Routen, nicht dem Sturz einer Regierung oder der Zerstörung einer Gesellschaftsordnung. Die Analogie zu Al-Qaida ist daher nicht nur unpassend, sondern eine bewusste Verzerrung, die darauf abzielt, die Grenzen zwischen Polizeiarbeit und Kriegsführung zu verwischen. Kritiker, darunter erfahrene Militärjuristen, bezeichnen dieses Vorgehen als „Zerfetzen“ des Völkerrechts – ein Prätext, um sich außerordentliche militärische Befugnisse anzueignen.
Ein tief gespaltenes Washington
Hinter der Fassade einer entschlossenen Regierungspolitik tobt ein erbitterter Richtungsstreit über den richtigen Umgang mit Venezuela. Auf der einen Seite stehen die Hardliner, angeführt vom ebenso einflussreichen wie kompromisslosen Außenminister und Nationalen Sicherheitsberater Marco Rubio. Für Rubio und seine Verbündeten, zu denen CIA-Direktor John Ratcliffe und der innenpolitische Chefberater Stephen Miller zählen, ist Nicolás Maduro nicht nur ein Diktator, sondern der Kopf eines kriminellen Terrorregimes, das eine direkte Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellt. Ihre Strategie ist klar und unnachgiebig: maximaler Druck, militärische Einschüchterung und letztlich der erzwungene Regimewechsel. In dieser Weltsicht sind die Militärschläge auf See nur die erste Stufe einer Eskalationsleiter, die potenziell Angriffe auf venezolanisches Territorium und die gewaltsame Entfernung Maduros aus dem Amt vorsieht. Rubio argumentiert, Maduro sei ein „Flüchtling der amerikanischen Justiz“, und seine Regierung müsse wie eine feindliche Organisation bekämpft werden.
Auf der anderen Seite dieses internen Konflikts steht eine kleine, aber beharrliche Fraktion, die für eine diplomatische Lösung plädiert. Ihr prominentester Vertreter ist Richard Grenell, Trumps Sondergesandter für Venezuela. Grenell und seine Unterstützer warnen davor, dass eine militärische Intervention die USA in einen jener langwierigen und kostspieligen Kriege verwickeln könnte, die Trump einst zu beenden versprach. Sie sehen Verhandlungen als den einzig gangbaren Weg, um amerikanische Interessen, einschließlich der Freilassung von US-Geiseln, zu wahren und eine stabile Lösung für Venezuela zu finden. Grenell selbst reiste nach Venezuela und traf sich mit Maduro, was den Zorn der Hardliner auf sich zog. Dieser Riss innerhalb der Administration offenbart einen fundamentalen Widerspruch in der amerikanischen Außenpolitik: Während die eine Fraktion auf Kanonenbootdiplomatie setzt und eine Konfrontation anstrebt, versucht die andere, durch Dialog eine Eskalation zu verhindern. Bislang scheint die Linie Rubios die Oberhand zu haben, was die militärische Präsenz in der Karibik und die aggressive Rhetorik des Präsidenten belegen.
Die Fiktion der Bedrohung
Die gesamte militärische Operation stützt sich auf eine einzige, zentrale Behauptung: Venezuela sei die Quelle einer Drogenflut, die Hunderttausende Amerikaner das Leben koste und somit eine existenzielle Bedrohung darstelle. Diese Darstellung, die von Präsident Trump und seinen Ministern unablässig wiederholt wird, hält einer Überprüfung durch die Fakten jedoch kaum stand. Berichte der amerikanischen Drogenbekämpfungsbehörde DEA und des Außenministeriums zeichnen ein gänzlich anderes Bild. Demnach ist Venezuela im globalen Kokainhandel zwar ein Transitland, aber bei weitem kein Hauptakteur. Ein Großteil des in die USA geschmuggelten Kokains stammt aus Kolumbien und wird über die Pazifikroute transportiert, nicht durch die Karibik. Noch deutlicher wird die Diskrepanz beim Fentanyl, der mit Abstand tödlichsten Droge in den USA. Dieses synthetische Opioid wird fast ausschließlich in Mexiko mit chemischen Vorprodukten aus China hergestellt. Venezuelas Rolle in diesem Geschäft ist praktisch inexistent.
Die von der Regierung in den Raum gestellten Opferzahlen sind ebenfalls massiv übertrieben. Präsident Trump sprach von über 300.000 Drogentoten jährlich, während die offizielle Statistik der Gesundheitsbehörde CDC für das letzte erfasste Jahr 87.000 Todesfälle ausweist – eine tragisch hohe Zahl, die aber weit von den Behauptungen des Weißen Hauses entfernt ist. Diese bewusste Manipulation von Fakten und Zahlen legt den Verdacht nahe, dass der Drogenkrieg nur ein Vorwand ist. Die eigentliche Motivation scheint nicht die öffentliche Gesundheit, sondern die persönliche Demütigung zu sein, die Trump durch das Scheitern seiner ersten Kampagne zum Sturz Maduros erlitten hat. Die erneute Konfrontation wirkt wie ein Akt der Rache, eine machtpolitische Inszenierung, die eine schwache faktische Grundlage mit martialischer Rhetorik und militärischer Gewalt kompensiert. Der „Narko-Terrorismus“ aus Venezuela ist weniger eine reale Bedrohung als vielmehr ein sorgfältig konstruiertes Feindbild, das eine aggressive, interventionistische Politik rechtfertigen soll.
Venezuelas zerrissene Seele
Die amerikanische Militärpräsenz vor der Küste trifft auf ein Land, das von Jahren der politischen Repression, des wirtschaftlichen Zusammenbruchs und der Massenflucht tief gezeichnet und gespalten ist. Die Reaktionen auf die drohende Intervention könnten unterschiedlicher nicht sein. Ein Teil der Opposition, angeführt von der kompromisslosen María Corina Machado, befürwortet ein Eingreifen der USA offen. Aus ihrer Sicht ist das Maduro-Regime eine kriminelle Diktatur, die nur mit Gewalt von außen entfernt werden kann. Ihre Berater bestätigen, in Kontakt mit der Trump-Administration zu stehen und Pläne für die Zeit nach einem möglichen Sturz Maduros zu entwickeln. Sie sehen die US-Militärmacht als notwendiges Werkzeug, um das Ergebnis der Wahlen von 2024 durchzusetzen, das Maduro nach Ansicht unabhängiger Beobachter nur durch massiven Betrug für sich beanspruchen konnte.
Doch diese Haltung ist innerhalb der Opposition keineswegs unumstritten. Erfahrene Politiker wie Henrique Capriles warnen eindringlich vor den Folgen einer ausländischen Intervention. Sie befürchten, dass ein amerikanischer Angriff das Land in ein unkontrollierbares Chaos stürzen und zu einem blutigen Bürgerkrieg zwischen verschiedenen bewaffneten Gruppen – dem Militär, Guerillas und paramilitärischen Banden – führen würde. Die Vorstellung einer sauberen, chirurgischen „Extraktion“ Maduros sei eine „Netflix-Fantasie“, so Capriles. In der breiten Bevölkerung herrscht eine Mischung aus Kriegsmüdigkeit, Angst und tiefem Skeptizismus. Während einige in der US-Intervention die letzte Hoffnung auf einen Wandel sehen, fürchten andere die Zerstörung und den Verlust von noch mehr Menschenleben. Viele können es sich schlicht nicht leisten, Vorräte anzulegen oder sich auf einen Krieg vorzubereiten; der tägliche Überlebenskampf dominiert alles. Die Maduro-Regierung ihrerseits nutzt die amerikanische Drohkulisse für ihre Propaganda. Sie inszeniert martialische Militärparaden, bewaffnet loyale Milizen und ruft zur Verteidigung der nationalen Souveränität auf, während sie gleichzeitig hinter den Kulissen versucht, über diplomatische Kanäle eine Deeskalation zu erreichen. Venezuela ist somit ein Pulverfass, in dem die Hoffnung auf Befreiung und die Angst vor der totalen Zerstörung untrennbar miteinander verbunden sind.
Der Preis der Eskalation
Die aktuelle Strategie der Trump-Administration ist ein Spiel mit extrem hohem Einsatz und unkalkulierbaren Risiken. Die außergerichtlichen Tötungen auf See, die von den Vereinten Nationen und zahlreichen Rechtsexperten als Verbrechen kritisiert werden, haben bereits jetzt verheerende Konsequenzen. Für die Zivilbevölkerung in den armen Küstenregionen Venezuelas, wo Fischerei, Schmuggel und Migration oft die einzigen Überlebensstrategien sind, bedeuten die Angriffe eine tödliche Bedrohung. Es ist kaum nachprüfbar, ob es sich bei den Getöteten tatsächlich um bewaffnete Kartellmitglieder oder um einfache Fischer, Migranten oder Kleinschmuggler handelte. Diese Politik untergräbt nicht nur das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, sondern sät auch Angst und Hass.
Das größte Risiko liegt jedoch in der Gefahr einer unbeabsichtigten militärischen Eskalation. Die massive Präsenz von US-Kriegsschiffen, die Provokationsflüge von Kampfflugzeugen und die aggressive Rhetorik könnten leicht zu einem Zwischenfall führen, der einen offenen Krieg auslöst. Ein solcher Konflikt würde nicht nur Venezuela verwüsten, sondern die gesamte Region destabilisieren. Die Folgen wären unvorstellbar: massive neue Fluchtwellen, die Nachbarländer wie Kolumbien und Brasilien überfordern würden, ein Zusammenbruch der Ölförderung mit globalen Auswirkungen und ein humanitäres Desaster von historischem Ausmaß.
Selbst im unwahrscheinlichen Fall eines schnellen und erfolgreichen Sturzes von Maduro steht Washington vor einem strategischen Vakuum. Es gibt keinen klaren Plan für die Zeit danach. Eine neue Regierung, selbst wenn sie von der Opposition gestellt würde, müsste sich mit einem tief korrupten und illoyalen Sicherheitsapparat, rivalisierenden bewaffneten Gruppen und einer zerstörten Wirtschaft auseinandersetzen. Die Gefahr, dass Venezuela nach einem erzwungenen Machtwechsel in ein „zweites Haiti“ zerfällt – ein gescheiterter Staat, der von Bandengewalt regiert wird –, ist real. Damit steht die US-Regierung vor einem fundamentalen Zielkonflikt: Der erklärte Krieg gegen den Drogenhandel droht genau jene Instabilität zu schaffen, die den Nährboden für Kriminalität und Chaos bildet. Die Politik, die vorgibt, ein Problem zu lösen, könnte es am Ende auf katastrophale Weise verschlimmern. Es ist eine Strategie, die kurzfristige, machtpolitische Ziele über langfristige Stabilität und menschliche Sicherheit stellt – mit potenziell verheerenden Kosten für alle Beteiligten.