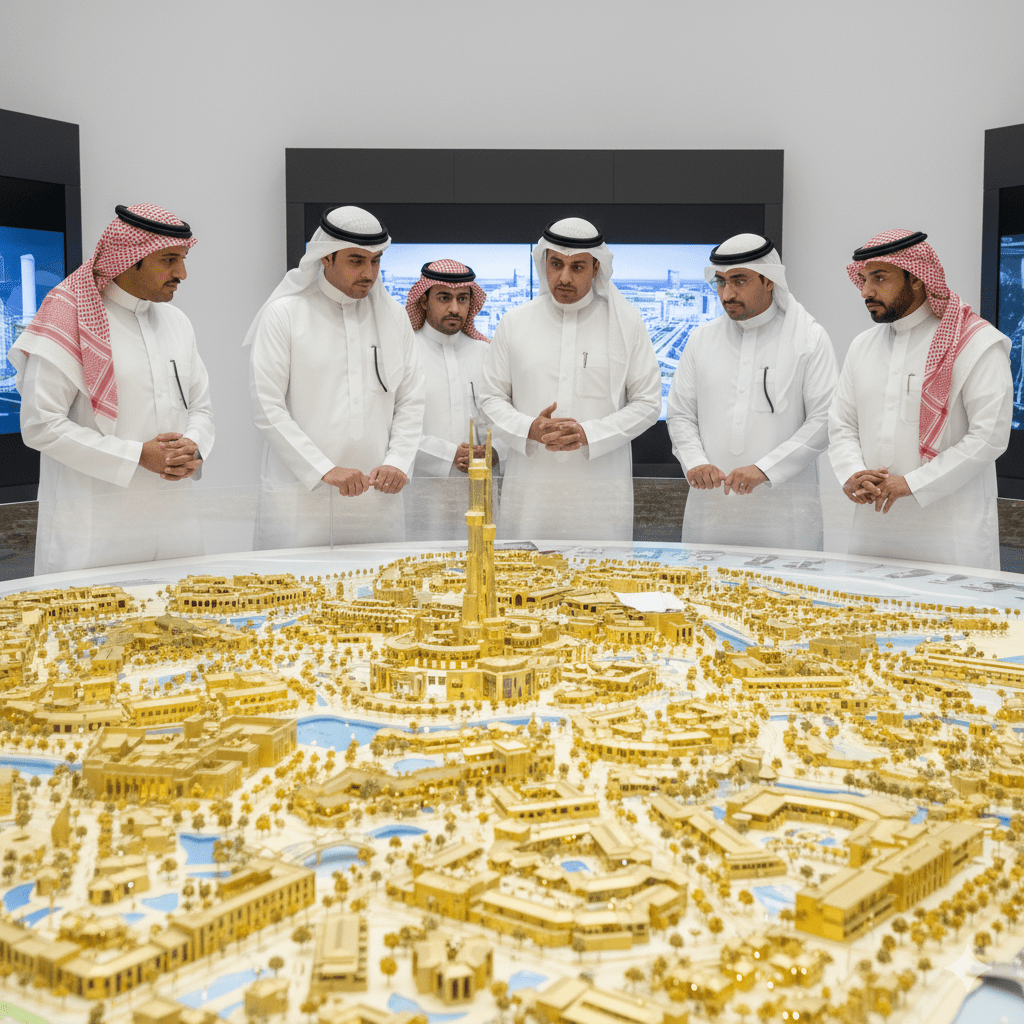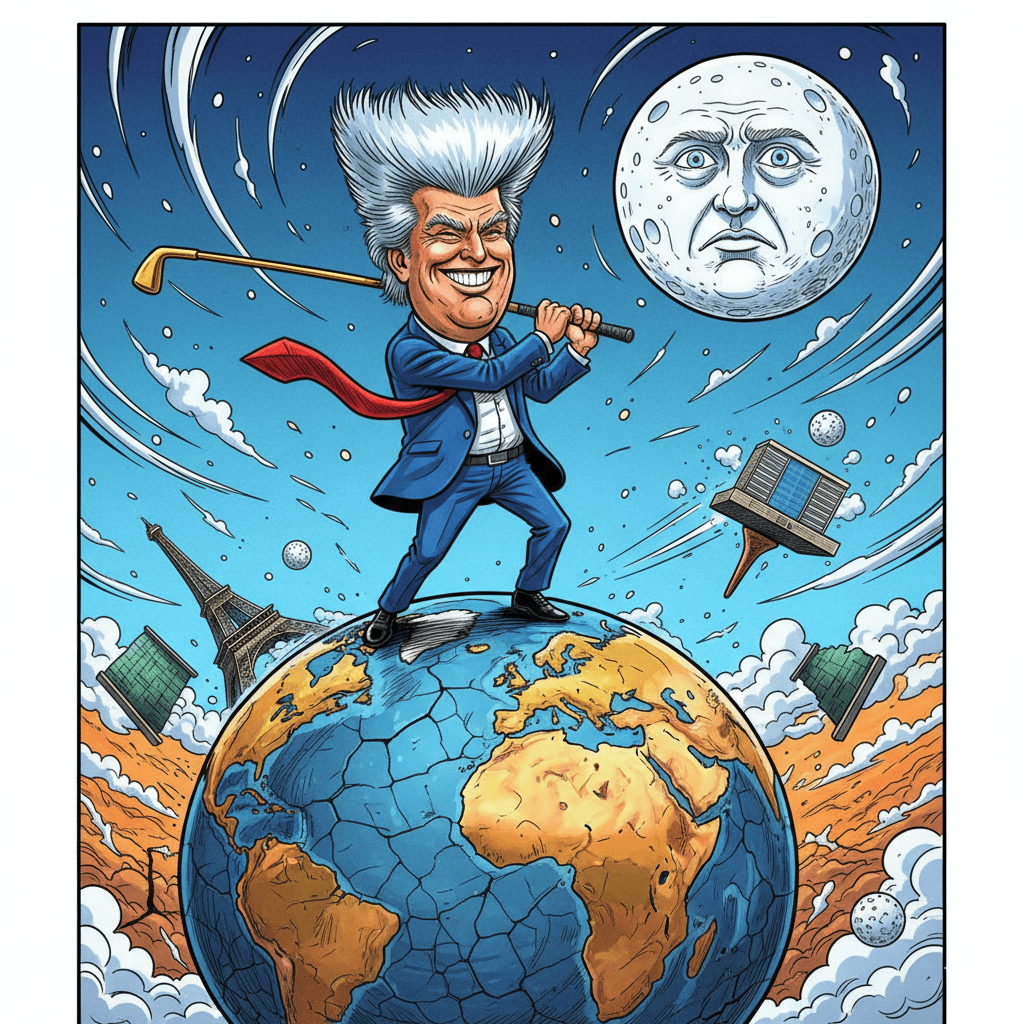
Fünfzig Jahre, nachdem der Watergate-Skandal die amerikanische Demokratie in ihren Grundfesten erschütterte und zum ersten Rücktritt eines Präsidenten führte, steht die Nation erneut am Abgrund. Doch die Krise, die sich in der vergangenen Woche vom 22. bis 27. September 2025 in Washington und weit darüber hinaus entfaltete, ist von einer neuen, gefährlicheren Qualität. Es ist nicht mehr der heimliche Machtmissbrauch Richard Nixons, der im Verborgenen agierte und an funktionierenden Institutionen scheiterte. Es ist der offene, im grellen Licht der Öffentlichkeit zelebrierte Angriff von Präsident Donald Trump auf ebenjene Schutzwälle – Justiz, Medien, Wissenschaft und die globale Ordnung –, die einst die Republik retteten.
Die vergangene Woche war keine Aneinanderreihung isolierter politischer Scharmützel. Sie war die Manifestation einer systematischen Strategie, die darauf abzielt, das Fundament der rechtsstaatlichen und faktenbasierten Ordnung zu zerstören und durch das Diktat des präsidialen Willens zu ersetzen. Von der fieberhaften Jagd auf politische Gegner durch ein unterjochtes Justizministerium über die Erpressung von Medienkonzernen durch politisierte Regulierungsbehörden bis hin zur bewussten Demontage des Staatsapparats und der Verhöhnung internationaler Allianzen – die Ereignisse zeichnen das Bild einer Präsidentschaft, die nicht nur die Regeln bricht, sondern das Spiel selbst verändern will. Watergate war eine Verfassungskrise, die das System überlebte. Die Sorge, die nach dieser Woche bleibt, ist, dass die aktuelle Krise das System selbst an den Rand des Zusammenbruchs führt, weil der parteiübergreifende Konsens darüber, was eine Demokratie schützt, zerbrochen ist.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Justiz als Waffe: Der Fall Comey und die Unterwerfung des Rechtsstaats
Die wohl dramatischste Eskalation im Angriff auf die Gewaltenteilung spielte sich in den Korridoren des Justizministeriums ab. Mit einer öffentlichen, in Großbuchstaben formulierten Forderung auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social befahl Präsident Trump seiner Justizministerin Pam Bondi, politische Gegner wie den ehemaligen FBI-Direktor James Comey, die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James und den Kongressabgeordneten Adam Schiff „schnell“ anzuklagen, da sie „schuldig wie die Hölle“ seien. Dieser Akt markiert die endgültige Zerstörung der nach Watergate mühsam errichteten Brandmauer, die das Weiße Haus von den operativen Entscheidungen der Strafverfolgungsbehörden trennen sollte.
Die Umsetzung dieses politischen Willens offenbarte eine fast schon chirurgische Präzision bei der Beseitigung institutionellen Widerstands. Im Zentrum stand der Bundesanwaltsbezirk Eastern District of Virginia, wo die Ermittlungen gegen Comey und James geführt wurden. Der dortige amtierende US-Staatsanwalt, Erik S. Siebert – ein von Trump selbst ernannter Jurist –, wurde kurzerhand aus dem Amt gedrängt. Sein Vergehen: professionelle Integrität. Gemeinsam mit seinem Team aus erfahrenen Karriere-Staatsanwälten war er nach sorgfältiger Prüfung zum Schluss gekommen, dass die Beweislage gegen Comey und James für eine Anklage nicht ausreiche. In der neuen Realität des Justizministeriums war diese juristische Einschätzung jedoch keine Faktenfrage, sondern ein Akt der Illoyalität, der personell sanktioniert wurde.
An seine Stelle trat Lindsey Halligan, eine Juristin, deren vornehmliche Qualifikation ihre rückhaltlose Loyalität zum Präsidenten ist, dem sie zuvor als persönliche Anwältin gedient hatte. Ohne jegliche Erfahrung als Staatsanwältin erhielt sie den Auftrag, das zu vollbringen, was erfahrene Profis für juristisch unhaltbar hielten: eine Anklage gegen Comey zu erzwingen, bevor die Verjährungsfrist am 30. September ablief. Halligan ignorierte ein internes Memo ihrer eigenen Untergebenen, das die Schwächen des Falls detailliert auflistete, und trieb die Anklage im Eilverfahren voran.
Diese Vorgehensweise verkehrt das rechtsstaatliche Verfahren ins Gegenteil. Am Anfang stand nicht die Entdeckung einer potenziellen Straftat, sondern der öffentlich formulierte politische Wille des Präsidenten, einen Gegner zu Fall zu bringen. Erst danach wurde der Apparat in Bewegung gesetzt, um das passende Verbrechen und eine willfährige Anklägerin zu finden. Kritiker sind sich einig, dass der Sieg für das Weiße Haus bereits in der Anklage selbst liegt, unabhängig von deren juristischer Fragilität. Der Prozess selbst ist die Strafe („the process is the punishment“) – eine Form der „Lawfare“, die darauf abzielt, Gegner finanziell und psychisch zu zermürben und ein Exempel für jeden Beamten im Regierungsapparat zu statuieren: Widerstand gegen den Willen des Präsidenten wird nicht geduldet und kann Jahre später strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Zensur per Erlass: Wie ein Witz über Jimmy Kimmel zur Staatsaffäre wurde
Parallel zur Unterwerfung der Justiz demonstrierte die Administration, wie sie auch andere Regulierungsbehörden als Waffe gegen kritische Stimmen einsetzt. Auslöser war ein Monolog des Late-Night-Moderators Jimmy Kimmel, in dem er die Reaktionen der MAGA-Bewegung auf die Ermordung des rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk thematisierte. Die Reaktion kam prompt von Brendan Carr, dem von Trump installierten Vorsitzenden der mächtigen Medienaufsichtsbehörde Federal Communications Commission (FCC).
In einer kaum verhüllten Drohung, die selbst der konservative Senator Ted Cruz mit den Methoden eines „Mafioso“ verglich, erklärte Carr, man könne die Sache auf die „einfache oder die harte Tour“ regeln. Dies war eine gezielte Erpressung, die auf die wirtschaftliche Verwundbarkeit der Medienkonzerne abzielte. Während der direkte Entzug von Sendelizenzen eine extrem hohe rechtliche Hürde darstellt, liegt die wahre Macht der FCC in der Genehmigung von Fusionen und Übernahmen im Wert von Milliarden von Dollar. Carrs Botschaft war unmissverständlich: Wer sich nicht fügt, riskiert sein Geschäft.
Die Strategie zeigte sofort Wirkung. Die beiden größten lokalen Sendergruppen des Landes, Nexstar und Sinclair, die zusammen mehr als ein Fünftel aller ABC-Partnerstationen kontrollieren, kündigten an, „Jimmy Kimmel Live!“ aus ihrem Programm zu nehmen – ein Akt des vorauseilenden Gehorsams. Beide Konzerne hatten milliardenschwere Interessen, die von der Gunst der FCC abhingen; insbesondere Nexstar stand kurz vor dem Abschluss einer 6,2-Milliarden-Dollar-Übernahme, die eine Aufweichung bestehender Regeln durch die FCC erforderte. Ihr Boykott war weniger ein Akt redaktioneller Verantwortung als ein opportunistischer Versuch, sich politisches Wohlwollen zu erkaufen.
Unter dem Druck des Regulators und der rebellierenden Partner kapitulierte auch der Mutterkonzern Disney und setzte die Show landesweit aus. Doch die Entscheidung löste eine Welle der Empörung in Hollywood und der Zivilgesellschaft aus, die Disney offenbar völlig unterschätzt hatte. Hunderte Stars protestierten, und Boykottaufrufe gegen den Streaming-Dienst Disney+ machten die Runde.
Am Ende war es jedoch die kalte Logik des Marktes, die den Boykott beendete. Während Nexstar und Sinclair auf die Werbeeinnahmen verzichteten, explodierten Kimmels Einschaltquoten durch die Kontroverse auf 6,2 Millionen Zuschauer – fast das Vierfache des Durchschnitts. Die Konzerne mussten für die Sendezeit teures und quotenschwaches Ersatzprogramm produzieren, was zu einem finanziellen Aderlass führte. Zudem trieben sie ihre Zuschauer geradewegs in die Arme der Streaming-Dienste wie Disney+, wo Kimmel weiterhin verfügbar war – und wo Disney die Einnahmen direkt und ohne Umwege kassiert. Nach nur wenigen Tagen kapitulierten die Konzerne und nahmen die Show wieder ins Programm auf. Der Vorfall hinterlässt jedoch eine fragmentierte Medienlandschaft, in der die politische Ausrichtung des lokalen Sendereigentümers darüber entscheidet, welche Inhalte die Zuschauer empfangen.
Trumps Abrissbirne: Die Aushöhlung der globalen Ordnung
Auf der Weltbühne verfolgte Präsident Trump in der vergangenen Woche eine Politik der gezielten Zerstörung. Seine Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen war nicht nur die bekannte Polemik gegen den Multilateralismus, sondern die Vollstreckung eines lange angekündigten Urteils über die nach 1945 unter amerikanischer Führung geschaffene Weltordnung. Die Strategie ist eine Kombination aus rhetorischer Abrissbirne und finanzieller Austrocknung. Seit seiner Rückkehr ins Amt wurden Zahlungen an die UN in Milliardenhöhe zurückgehalten, was die Organisation in eine hausgemachte Haushaltskrise stürzt und Friedensmissionen sowie humanitäre Hilfsprogramme lähmt.
Die dramatischste Wende vollzog sich jedoch in der Ukraine-Politik. Nach einem Gipfeltreffen mit Wladimir Putin in Alaska hatte Trump noch einen „Land-gegen-Frieden“-Deal gepredigt, bei dem die Ukraine Teile ihrer Souveränität aufgeben sollte. In einer spektakulären Kehrtwende per Social-Media-Post erklärte er nun, er glaube an einen vollständigen militärischen Sieg der Ukraine. Diese Volte, die ohne jede Absprache mit den Verbündeten erfolgte, wird von Beobachtern weniger als strategische Neuausrichtung denn als Akt der Rache eines gekränkten Egos interpretiert. Putin hatte Trumps Vermittlerrolle nicht mitgespielt und stattdessen die Bombardements auf die Ukraine intensiviert, was Trump als öffentliche Demütigung empfand.
Die wahre Brisanz von Trumps neuem Kurs liegt jedoch in der damit verbundenen Lastenverschiebung. Er verspricht der Ukraine den Sieg, stellt aber klar, dass die dafür notwendige militärische und finanzielle Unterstützung von Europa und der NATO kommen müsse. Die USA ziehen sich damit aus der Rolle des Anführers zurück und nehmen die Position eines Waffenlieferanten ein, der die Rechnung an andere weiterreicht. Für Europa ist dies eine gefährliche Situation: Es erhält zwar grünes Licht für eine härtere Gangart gegenüber Moskau, muss aber die volle Verantwortung für die Sicherheit des Kontinents aufgebürdet bekommen, ohne sich auf die Verlässlichkeit seines wichtigsten Partners stützen zu können.
Der Shutdown als Waffe: Angriff auf den Staatsapparat von innen
Die Strategie der Aushöhlung richtet sich nicht nur gegen externe, sondern auch gegen die internen Strukturen des Staates. Mit dem nahenden Ende des Fiskaljahres am 30. September droht der US-Regierung ein Shutdown, der diesmal jedoch mehr ist als nur ein parteipolitisches Kräftemessen. Ein Memorandum des Office of Management and Budget (OMB) wies die Bundesbehörden an, sich nicht nur auf temporäre Beurlaubungen („furloughs“), sondern auf permanente Entlassungen („Reduction in Force“) vorzubereiten.
Diese Drohung transformiert den Shutdown von einem Instrument des politischen Stillstands in eine Waffe zur Disziplinierung und politischen Säuberung des Staatsapparats. Die vage Formulierung, es sollen vor allem jene Positionen eliminiert werden, die nicht mit der politischen Agenda des Präsidenten übereinstimmen, entlarvt den wahren Charakter des Vorhabens. Es soll ein Klima der Angst geschaffen werden, in dem Loyalität gegenüber der Exekutive wichtiger wird als die neutrale Ausübung des Amtes.
Dieses Vorgehen ist Teil eines größeren Feldzugs gegen die eigene Bundesverwaltung, wie der Fall der Katastrophenschutzbehörde FEMA zeigt. Unter dem Deckmantel einer Effizienzreform wird die Behörde systematisch demontiert. Heimatschutzministerin Kristi Noem installierte eine Regelung, wonach jede einzelne Ausgabe der FEMA über 100.000 US-Dollar ihrer persönlichen Genehmigung bedarf – eine bürokratische Aderpresse, die im Katastrophenfall schnelle Hilfe unmöglich macht. Während der verheerenden Flut in Texas im Juli, bei der über hundert Menschen starben, saßen spezialisierte Rettungsteams tagelang fest, weil die Genehmigung aus Washington ausstand.
Gleichzeitig wurde mit David Richardson ein politisch loyaler, aber fachlich unqualifizierter kommissarischer Leiter an die Spitze der Behörde gesetzt, der während der entscheidenden ersten 24 Stunden der Flut für seine Mitarbeiter unerreichbar war. Dieses Vorgehen hebelt systematisch die nach dem Hurrikan Katrina 2005 geschaffenen Schutzmechanismen aus, die genau solche politischen Fehlbesetzungen und Einmischungen verhindern sollten. Die Folge ist ein Exodus an erfahrenen Mitarbeitern; fast ein Drittel der permanenten Belegschaft hat die FEMA seit Januar 2025 verlassen.
Kulturkampf und Glaubenskrieg: Vom Tylenol-Mythos zur Heiligsprechung Charlie Kirks
Der Angriff der Trump-Administration richtet sich nicht nur gegen Institutionen, sondern auch gegen die Fundamente einer faktenbasierten Gesellschaft: Wissenschaft und Vernunft. Dies zeigte sich in der bizarren Kampagne gegen das weitverbreitete Schmerzmittel Tylenol (Acetaminophen). In einer Pressekonferenz warnte der Präsident die Nation eindringlich: „Nehmen Sie kein Tylenol, nehmen Sie es nicht“.
Die Regierung stützt ihre dramatische Warnung, das Medikament könne bei Einnahme während der Schwangerschaft Autismus oder ADHS bei Kindern auslösen, auf eine einzelne wissenschaftliche Überblicksstudie, die lediglich eine statistische Assoziation, aber keinen kausalen Zusammenhang fand. Der überwältigende wissenschaftliche Konsens führender Gesundheitsorganisationen und eine massive schwedische Studie mit 2,5 Millionen Kindern, die diese Assoziation widerlegte, werden von der Administration gezielt ignoriert. Die Kampagne wurzelt in der persönlichen, langjährigen und von Anekdoten geprägten Überzeugung des Präsidenten, es gebe einen Zusammenhang zwischen Impfungen, Medikamenten und Autismus – eine Mission, die er nun mit seinem Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., einem bekannten Impfgegner, von höchster Regierungsebene aus legitimiert. Die Folgen sind potenziell fatal: Ärzte warnen, dass unbehandeltes Fieber während der Schwangerschaft ein belegtes Risiko für Mutter und Kind darstellt.
Gleichzeitig wurde der Tod als ultimatives politisches Kapital genutzt. Die Trauerfeier für den ermordeten Aktivisten Charlie Kirk in einem Football-Stadion in Arizona wurde zu einer bombastischen, stundenlangen politischen Messe inszeniert. Der Zweck war nicht Trauer, sondern die Transformation eines Menschen in einen Märtyrer und einer politischen Bewegung in eine Heilslehre. Redner wie Vizepräsident J.D. Vance sprachen von Kirk als einem „Märtyrer für den christlichen Glauben“ und beschworen einen „spirituellen Krieg“, zu dem die Anhänger nun die „volle Rüstung Gottes“ anlegen müssten. Diese Verschmelzung von politischer Agenda und religiöser Rhetorik dient dazu, politische Gegner zu Häretikern zu erklären und ihre Zerstörung als göttliche Pflicht darzustellen. Den bemerkenswertesten Kontrapunkt setzte die Witwe Erika Kirk, die in ihrer Rede dem Mörder ihres Mannes im Sinne des christlichen Glaubens vergab. Dieser Moment der Versöhnung wurde von Donald Trump persönlich zunichtegemacht, als er erklärte: „Ich hasse meine Gegner und will nicht das Beste für sie. Tut mir leid, Erika.“. Er ersetzte die christliche Botschaft bewusst durch das Gesetz des politischen Dschungels: unversöhnlicher Hass als Tugend.
Fazit: Jenseits von Watergate
Die vergangene Woche hat die Konturen einer Präsidentschaft offengelegt, deren Gefahr weit über die von Richard Nixon hinausgeht. Während Nixon an einem System scheiterte, das sich wehrte, agiert Trump in einem politischen Umfeld, in dem die Schutzmechanismen erodiert sind. Eine tief gespaltene Medienlandschaft ohne gemeinsame Faktenbasis, ein Kongress, der durch parteipolitische Loyalität gelähmt ist, und eine Öffentlichkeit, die gegenüber Skandalen abgestumpft scheint, schaffen ein Umfeld, in dem selbst die dreistesten Angriffe auf den Rechtsstaat verpuffen oder von der eigenen Anhängerschaft gefeiert werden.
Der Schaden, der durch die Normalisierung dieser Taktiken entsteht, ist bereits angerichtet. Das Vertrauen in die Institutionen ist nachhaltig erschüttert. Die Krise offenbart ein politisches System, in dem das kurzfristige Interesse am Machterhalt die langfristige Verantwortung für das Gemeinwohl verdrängt. Die Frage, die nach diesen turbulenten Tagen bleibt, ist nicht mehr nur, ob einzelne Politiker standhaft bleiben, sondern ob die amerikanische Demokratie als Ganzes noch die Kraft besitzt, die Erosion ihrer fundamentalsten Prinzipien aufzuhalten.