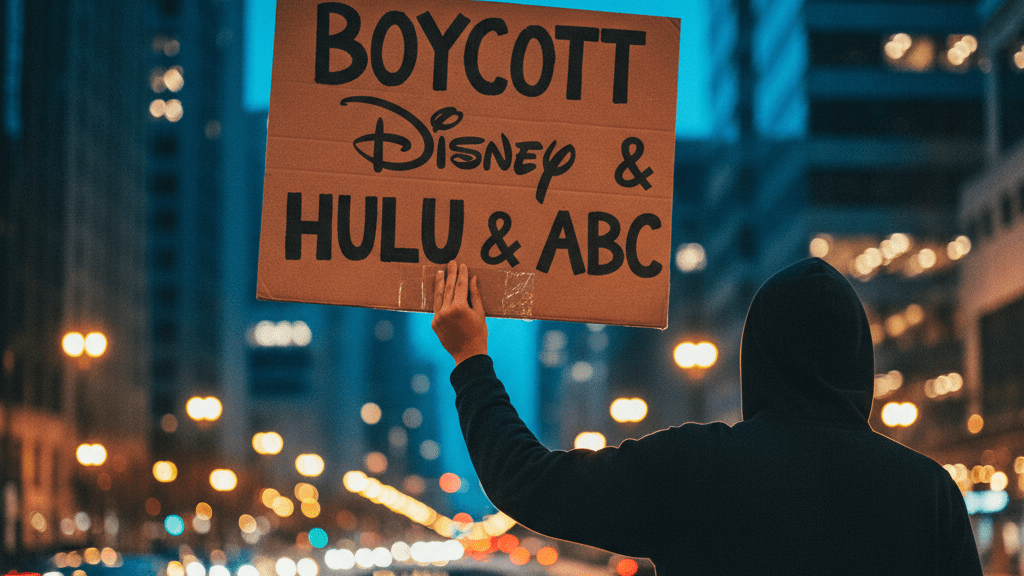
Ein Sturm im Wasserglas, so schien es zunächst. Eine Late-Night-Show, die für ein paar Tage von den Bildschirmen einiger lokaler Fernsehsender verschwindet. In der aufgeheizten Atmosphäre der zweiten Amtszeit von Donald Trump wirkt ein solcher Vorfall beinahe wie eine Alltäglichkeit, ein weiteres kleines Scharmützel im unermüdlichen Kulturkampf der Nation. Doch wer im September 2025 genauer hinsah, konnte in diesem scheinbar unbedeutenden Ereignis die Erschütterungen eines politischen Erdbebens spüren. Der Boykott von „Jimmy Kimmel Live!“ durch die Mediengiganten Sinclair und Nexstar war weit mehr als eine Reaktion auf einen missglückten Witz. Es war ein kalkuliertes, politisches Manöver, ein Spiel mit gezinkten Karten, das am Ende nicht nur scheiterte, sondern auch die tektonischen Verschiebungen in der amerikanischen Medien- und Machtlandschaft brutal offenlegte. Die Geschichte dieses Boykotts ist die Geschichte einer Hybris, einer fundamentalen Fehleinschätzung der eigenen Stärke und einer unfreiwilligen Offenbarung, wer im Ringen um Einfluss und Milliarden wirklich die Zügel in der Hand hält.
Ein fragiles Gleichgewicht: Wer im US-Fernsehen wirklich die Fäden zieht
Um das Drama in seiner vollen Tragweite zu verstehen, muss man tief in das Nervensystem des amerikanischen Fernsehens eintauchen – ein komplexes Geflecht aus nationalen Netzwerken und lokalen Partnerstationen, den sogenannten „Affiliates“. Man kann es sich wie ein Franchise-System vorstellen: Die großen Netzwerke wie ABC, eine Tochter des Disney-Konzerns, produzieren die teuren, glamourösen Inhalte – die landesweiten Nachrichten, die großen Sportübertragungen, die Late-Night-Shows. Die lokalen Stationen, die über das ganze Land verteilt sind, strahlen dieses Programm aus und erhalten im Gegenzug das Recht, einen Teil der Werbezeit mit lokaler Reklame zu füllen und so Einnahmen zu generieren. Für die Affiliates ist dieser Pakt überlebenswichtig. Zwar behalten sie 100 % der Einnahmen aus ihren eigenen Produktionen, wie den Lokalnachrichten, doch die nationalen Prime-Time-Shows und Sportevents ziehen in der Regel ein weitaus größeres Publikum an und generieren damit deutlich höhere Werbeeinnahmen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Dieses System funktionierte jahrzehntelang in einem relativ stabilen Gleichgewicht. Doch in den letzten zwei Jahrzehnten hat eine schleichende Revolution stattgefunden: die Konsolidierung. Hunderte ehemals unabhängiger Lokalsender wurden von einer Handvoll riesiger Konzerne aufgekauft. An der Spitze dieser Bewegung stehen die Nexstar Media Group und die Sinclair Broadcast Group. Gemeinsam besitzen sie heute rund 40 % aller lokalen Fernsehstationen des Landes und kontrollieren allein etwa ein Fünftel aller ABC-Partner. Diese neu gewonnene Größe verlieh ihnen ein Selbstbewusstsein, das weit über das eines einfachen Franchise-Nehmers hinausging. Sie sahen sich nicht mehr nur als passive Ausspielkanäle, sondern als mächtige Gatekeeper mit eigenen Agenden und dem vermeintlichen Recht, dem nationalen Netzwerk die Stirn zu bieten. Der Moment, diese Macht zu testen, schien im September 2025 gekommen zu sein.
Mehr als Moral: Das politische Kalkül hinter dem Boykott
Der Zündfunke war ein Monolog von Jimmy Kimmel nach der Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk. Kimmel kritisierte die politische Rechte und insbesondere die Anhänger von Donald Trump für ihre Reaktion auf die Tat. Die Empörung im konservativen Lager war groß und schnell. Doch der entscheidende Impuls kam aus Washington. Brendan Carr, der von Donald Trump ernannte Vorsitzende der Federal Communications Commission (FCC), der mächtigen Medienaufsichtsbehörde, schaltete sich öffentlich ein. Er warf Kimmel Irreführung vor und drohte Disney und seinen lokalen Partnern unverhohlen mit Konsequenzen, sollten sie nicht handeln. Seine Botschaft, man könne die Sache „auf die einfache oder die harte Tour“ regeln, klang weniger nach regulatorischer Aufsicht als nach einer Szene aus einem Mafiafilm.
Für Nexstar und Sinclair war dies offenbar das Signal, auf das sie gewartet hatten. Innerhalb von Stunden kündigten sie an, „Jimmy Kimmel Live!“ aus ihrem Programm zu nehmen. ABC, unter Druck gesetzt von seinem wichtigsten Regulator und den rebellierenden Partnern, zog nach und suspendierte die Show zunächst landesweit. Offiziell begründeten die Konzerne ihren Schritt mit Kimmels angeblich unsensiblen Kommentaren und ihrer Verantwortung gegenüber den lokalen Gemeinschaften. Doch blickt man hinter diese Fassade aus zur Schau gestellter moralischer Integrität, offenbart sich ein weitaus pragmatischeres, politisches Kalkül.
Beide Medienriesen hatten zu diesem Zeitpunkt milliardenschwere Interessen, die direkt von der Gunst der FCC und ihres Vorsitzenden abhingen. Nexstar stand kurz vor dem Abschluss einer gigantischen 6,2-Milliarden-Dollar-Übernahme des Konkurrenten Tegna. Ein Deal dieser Größenordnung erforderte nicht nur die Zustimmung der FCC, sondern auch die Aufweichung bestehender Regeln, die die maximale Reichweite eines einzelnen Senders begrenzen – eine Regeländerung, für die sich Carr bereits offen gezeigt hatte. Sinclair, seit langem für seine konservative Ausrichtung bekannt, sondierte ebenfalls strategische Deals für sein riesiges Sendernetzwerk. War es also wirklich Kimmels Monolog, der die Manager in den Vorstandsetagen erzürnte, oder vielmehr die verlockende Aussicht, sich vor einem mächtigen Fürsprecher in Washington zu verneigen? Die Kritiker waren sich einig: Der Boykott war weniger ein Akt redaktioneller Verantwortung als ein opportunistischer Versuch, sich bei der Trump-Administration politisches Wohlwollen zu erkaufen.
Ein teurer Fehlschlag: Die unerbittliche Logik des Marktes
Der Plan schien aufzugehen. Carr applaudierte der Entscheidung von Nexstar und Sinclair öffentlich. Doch als ABC die Show nach kurzer Pause wieder ins Programm nahm, begingen die beiden Konzerne einen fatalen Fehler: Sie setzten ihren Boykott fort und spielten damit ein Spiel, das sie nicht gewinnen konnten – ein ökonomisches „Game of Chicken“. Sie hatten die Machtverhältnisse fundamental falsch eingeschätzt und die unerbittliche Logik des Marktes unterschätzt.
Der Fehlschlag manifestierte sich auf mehreren Ebenen. Zunächst waren da die Finanzen. Der Boykott entpuppte sich als kostspieliges Unterfangen. Während sie auf die Werbeeinnahmen aus Kimmels Show verzichten mussten, explodierten dessen Einschaltquoten durch die Kontroverse förmlich. Bei seiner Rückkehr schalteten 6,2 Millionen Zuschauer ein – fast viermal so viele wie an einem durchschnittlichen Abend. Diese Einnahmen entgingen Nexstar und Sinclair komplett. Schlimmer noch: Sie mussten für die frei gewordene Sendezeit teures Ersatzprogramm produzieren, meist zusätzliche lokale Nachrichten, das jedoch weitaus weniger Zuschauer anzog. Der Boykott wurde zu einem finanziellen Aderlass, der von Tag zu Tag schmerzhafter wurde.
Gleichzeitig offenbarte sich die überlegene Macht von Disney. Der Konzern hielt ein Druckmittel in der Hand, das für die lokalen Stationen einer nuklearen Option gleichkam: die Übertragungsrechte für die NFL und College-Football. Diese Sportprogramme sind für viele Affiliates die wertvollste und profitabelste Ware überhaupt. Die Vorstellung, den eigenen Zuschauern erklären zu müssen, warum das entscheidende Spiel am Wochenende nicht übertragen wird, weil man einen Konflikt mit einem Late-Night-Moderator austrägt, war ein politisches Selbstmordkommando.
Der vielleicht größte strategische Fehler war jedoch ein anderer. Mit ihrem Boykott trieben Nexstar und Sinclair ihre eigenen Zuschauer geradewegs in die Arme ihres größten Konkurrenten: der Streaming-Dienste. Wer Kimmel auf seiner lokalen ABC-Station nicht sehen konnte, fand ihn problemlos auf Disney+ oder Hulu. Jeder Tag des Boykotts war eine kostenlose Werbekampagne für die digitale Zukunft des Fernsehens – eine Zukunft, in der Disney die Einnahmen direkt und ohne Umwege über lokale Partner kassiert. Der Versuch, die eigene Macht zu demonstrieren, beschleunigte so ausgerechnet jenen Trend, der das Geschäftsmodell des traditionellen Rundfunks auf lange Sicht am stärksten bedroht.
Lehren aus einer Niederlage: Die Zukunft des amerikanischen Fernsehens
Nach nur wenigen Tagen war das Spiel vorbei. Sinclair und Nexstar kapitulierten und nahmen Jimmy Kimmel wieder ins Programm auf. Ihre Pressemitteilungen sprachen von „konstruktiven Gesprächen“ und dem „Feedback der Zuschauer“, doch in Wahrheit war es eine bedingungslose Unterwerfung unter die ökonomische Realität. Sie hatten ihre Hand überreizt und verloren.
Was bleibt, ist mehr als nur die Anekdote eines gescheiterten Medienboykotts. Der Vorfall ist ein Lehrstück über die wahren Machtverhältnisse im Amerika des Jahres 2025. Er zeigt, dass die Konsolidierung lokaler Medien zwar die Illusion von Macht erzeugt, diese aber brüchig ist, wenn sie auf die geballte Kraft eines globalen Unterhaltungskonzerns wie Disney trifft, der die wertvollsten Inhalte kontrolliert.
Die Episode entlarvt zudem die Gefahr, die von einer politisierten Regulierungsbehörde ausgeht. Die offene Drohung des FCC-Vorsitzenden Carr war ein alarmierender Angriff auf die redaktionelle Unabhängigkeit der Medien, der einen gefährlichen Präzedenzfall schafft, auch wenn er in diesem Fall ins Leere lief. Es wirft ein Schlaglicht auf ein System, in dem Unternehmen versucht sein könnten, journalistische Entscheidungen zu treffen, um sich bei der Regierung beliebt zu machen.
Am Ende war es jedoch keine moralische Einsicht oder ein Sieg der freien Rede, der den Boykott beendete, sondern der kalte, harte Druck des Marktes. Nexstar und Sinclair haben gelernt, dass sie zwar groß genug sind, um Lärm zu machen, aber nicht stark genug, um denjenigen die Stirn zu bieten, die die Inhalte besitzen, die die Menschen wirklich sehen wollen. Die wahre Macht liegt nicht mehr allein bei denen, die die Sendemasten kontrollieren, sondern bei denen, die die Geschichten erzählen, die über alle Plattformen hinweg ein Publikum finden. Der Vorhang für das kurze Drama um Jimmy Kimmel ist gefallen, aber die Bühne des amerikanischen Medienzirkus hat sich durch diesen fehlgeschlagenen Putschversuch für immer verändert.


