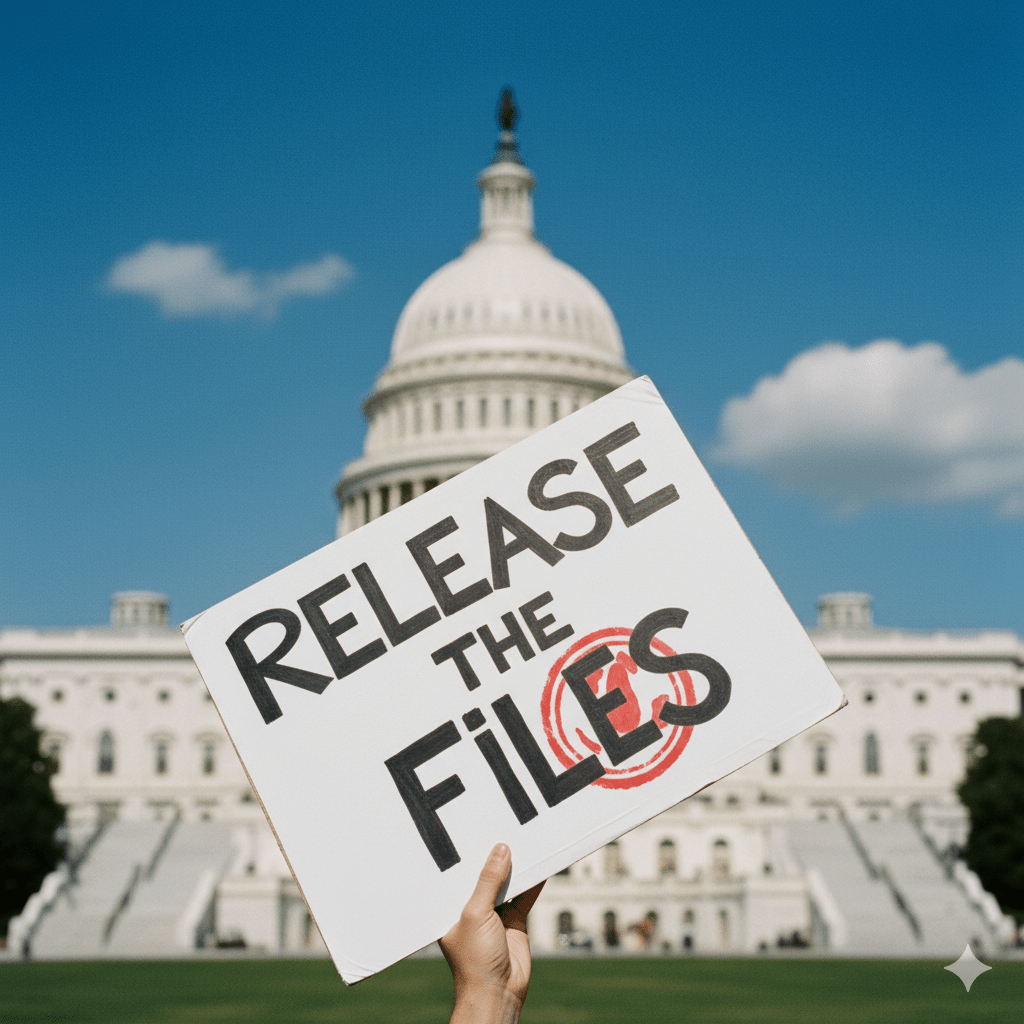Es ist ein Gefühl stiller Resignation, das wohl jeder Flugreisende kennt: die Ohnmacht angesichts einer annullierten Verbindung, eines verschollenen Koffers oder undurchschaubarer Gebühren, die den Ticketpreis im Nachhinein explodieren lassen. Lange schien es, als hätte die Politik in den Vereinigten Staaten begonnen, diese Asymmetrie zwischen mächtigen Luftfahrtkonzernen und dem einzelnen Passagier zumindest ansatzweise zu korrigieren. Unter der Regierung von Joe Biden erlebten die USA eine vorsichtige, aber signifikante Stärkung der Fluggastrechte – ein Versuch, dem Konsumenten ein Minimum an Schutz und Vorhersehbarkeit in einem notorisch unberechenbaren Sektor zurückzugeben. Doch was wir gegenwärtig unter der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump erleben, ist nicht weniger als die systematische Demontage dieses Schutzwalls. Es handelt sich hierbei nicht um eine simple politische Kurskorrektur oder den üblichen Pendelschlag zwischen zwei Administrationen. Vielmehr beobachten wir den Kulminationspunkt einer jahrzehntelangen deregulatorischen Ideologie, die den Staat nicht nur aus seiner Schutzfunktion entlässt, sondern ihn zum aktiven Wegbereiter konzerneigener Interessen umfunktioniert. Der einzige Sheriff, der in der gesetzlosen Weite des amerikanischen Luftraums für Ordnung sorgen könnte, legt seinen Stern ab und überlässt das Feld den Oligopolisten.
Die Mechanik der Rückabwicklung
Die Neuausrichtung des amerikanischen Transportministeriums (Department of Transportation, DOT) unter dem von Trump ernannten Minister Sean P. Duffy vollzieht sich mit einer fast schon chirurgischen Präzision. Es ist ein Vorgehen auf mehreren Ebenen, das darauf abzielt, das regulatorische Korsett der Biden-Ära nicht nur zu lockern, sondern es vollständig aufzulösen. Ein zentrales Instrument ist dabei die Agenda der vorgeschlagenen regulatorischen Änderungen, die einen klaren Bruch mit der verbraucherorientierten Politik der Vorgängerregierung signalisiert. So wurde ein ambitionierter Vorschlag, der eine Entschädigungspflicht für Fluggesellschaften bei selbstverschuldeten Annullierungen und erheblichen Verspätungen nach dem Vorbild der Europäischen Union vorsah, kurzerhand zurückgezogen. Diese Maßnahme allein hätte das Machtgleichgewicht entscheidend zugunsten der Passagiere verschoben und einen Anreiz für pünktlicheren und verlässlicheren Betrieb geschaffen. Ihr Ende markiert einen symbolischen Sieg für die Industrie.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Gleichzeitig werden bereits etablierte Regeln, die als Meilensteine des Verbraucherschutzes galten, zur Disposition gestellt. Dazu gehört insbesondere die Vorschrift zur automatischen und unkomplizierten Rückerstattung von Gebühren für nicht erbrachte Dienstleistungen – etwa für defektes WLAN an Bord oder für Gepäckstücke, die ihr Ziel erst mit erheblicher Verspätung erreichen. Die Begründung des Ministeriums, man wolle die Fluggesellschaften von „übermäßigen regulatorischen Lasten“ befreien, verschleiert dabei den wahren Kern der Sache: Die Beweis- und Klagelast wird wieder vollständig auf den einzelnen Konsumenten abgewälzt, der sich fortan erneut durch den Dschungel von Hotlines und Antragsformularen kämpfen muss.
Hierbei offenbart sich eine entscheidende rechtliche Nuance im amerikanischen System: Während einige grundlegende Schutzmaßnahmen, etwa das Recht auf eine Rückerstattung bei ersatzlos gestrichenen Flügen, durch den vom Kongress verabschiedeten Federal Aviation Administration (FAA) Act gesetzlich verankert und somit schwerer angreifbar sind, handelt es sich bei vielen der detaillierteren Ausführungsbestimmungen um ministerielle Verordnungen. Diese können von einer neuen Administration mit veränderten Prioritäten relativ unkompliziert revidiert oder eliminiert werden. Genau diese Schwachstelle nutzt die Trump-Regierung nun gezielt aus, um die von ihr als ideologisch überladen empfundenen Regelungen der Biden-Jahre systematisch auszuhöhlen.
Das Echo der Deregulierung von 1978
Um die aktuelle Entwicklung in ihrer ganzen Tragweite zu verstehen, ist ein Blick in die Geschichte unerlässlich. Die gegenwärtige Konfrontation ist letztlich nur das jüngste Kapitel in einer Grundsatzdebatte, die mit dem Airline Deregulation Act von 1978 ihren Anfang nahm. Damals wurde die Luftfahrtindustrie aus der strengen staatlichen Kontrolle über Routen und Preise entlassen, getragen von dem Versprechen, dass der freie Wettbewerb unweigerlich zu sinkenden Preisen, neuen Anbietern und einem besseren Service führen würde. Ob diese Utopie je Realität wurde, ist bis heute Gegenstand erbitterter Auseinandersetzungen.
Die Industrielobby, allen voran der einflussreiche Verband Airlines for America, zeichnet das Bild einer Erfolgsgeschichte. Doch Kritiker, darunter Juristen und Ökonomen, konstatieren ein gänzlich anderes Ergebnis: Statt eines blühenden Marktes habe die Deregulierung ein unkontrolliertes Oligopol geschaffen. Durch eine Welle von Fusionen und Übernahmen konsolidierte sich der Markt in den Händen weniger Giganten, die ihre Marktmacht durch das sogenannte Hub-and-Spoke-System zementierten und auf wichtigen Routen quasi-monopolistische Stellungen einnahmen. Für den Passagier manifestierte sich diese Entwicklung in einer schleichenden Erosion des Reiseerlebnisses: Die Flugzeuge wurden voller, die Sitze enger, und einst selbstverständliche Leistungen wie die Gepäckaufgabe oder die Sitzplatzreservierung wurden zu kostenpflichtigen Zusatzleistungen zerstückelt.
Die aktuelle politische Offensive der Trump-Administration ist vor diesem Hintergrund als eine Art „Re-Deregulierung“ zu verstehen – ein Versuch, auch die letzten verbliebenen Fesseln zu sprengen, die eine vollständige Unterwerfung des Marktes unter die Interessen der Konzerne verhindern. Die Rhetorik der Befürworter von damals und heute ist dabei verblüffend ähnlich: Es ist der Ruf nach unternehmerischer Freiheit und die Warnung vor staatlicher Überregulierung, die angeblich Innovation ersticke und die Effizienz des Kapitalismus behindere. Die Lehren aus vier Jahrzehnten Markterfahrung, die zeigen, dass diese Freiheit oft zu Lasten der Servicequalität und der Transparenz geht, werden dabei geflissentlich ignoriert.
Die Wunschliste der Konzerne
Wie radikal die Vorstellungen der Industrie sind, belegt ein 93-seitiges Dokument, das Airlines for America beim Transportministerium eingereicht hat. Es liest sich wie ein Generalangriff auf sämtliche verbraucherpolitischen Errungenschaften der letzten Jahre. Ganz oben auf der Wunschliste steht die endgültige Beseitigung der Transparenzregeln für sogenannte „Junk Fees“ – also jener versteckten Zusatzgebühren, deren Offenlegung vor dem Buchungsabschluss die Biden-Administration durchsetzen wollte. Ein Gericht hatte diese Regelung zwar vorläufig blockiert, doch das Ministerium signalisiert nun, sie gar nicht mehr verteidigen, sondern aktiv zurücknehmen zu wollen.
Des Weiteren fordert die Lobby ein Ende der Haftungsregeln für beschädigte Rollstühle, was eine empfindliche Verschlechterung für Reisende mit Behinderungen bedeuten würde. Auch die Regeln zu Rückerstattungen werden als unzulässiger Eingriff in die Vertragsfreiheit gebrandmarkt. Besonders aufschlussreich ist jedoch die Forderung, die öffentlichen Berichtspflichten der Fluggesellschaften zu reduzieren. Hierbei geht es um essenzielle Leistungsdaten wie Pünktlichkeitsstatistiken, die Rate an fehlgeleitetem Gepäck oder die Dauer von Wartezeiten auf dem Rollfeld. Dies ist kein trivialer Wunsch nach bürokratischer Entlastung, sondern ein strategischer Vorstoß, die eigene Performance zu verschleiern und damit genau jene Marktmechanismen auszuhebeln, die eine informierte Entscheidung der Konsumenten erst ermöglichen.
Der hohe Preis der Intransparenz
Die Konsequenzen dieser Entwicklung wären für die amerikanischen Fluggäste gravierend und vielfältig. Die Abschaffung der Gebührentransparenz würde den Preisvergleich zwischen verschiedenen Anbietern endgültig zu einer Farce machen. Der am Anfang angezeigte Ticketpreis verlöre jede Aussagekraft, da die Gesamtkosten erst am Ende eines verschachtelten Buchungsprozesses sichtbar würden. Dies untergräbt nicht nur die finanzielle Planbarkeit für Reisende, sondern verzerrt auch den Wettbewerb, da Airlines mit einer aggressiven, aber irreführenden Preispolitik belohnt würden.
Die Reduzierung der Datenberichterstattung würde den Markt zusätzlich in eine Blackbox verwandeln. Ohne verlässliche, standardisierte und öffentliche Daten über die Servicequalität einer Airline können Passagiere ihre Wahl nicht mehr auf Grundlage von Leistung, sondern nur noch auf Basis von Preis und Marketing treffen. Eine Fluggesellschaft, die notorisch unpünktlich ist oder überdurchschnittlich oft Gepäck verliert, hätte kaum noch einen Anreiz, diese Mängel zu beheben, solange sie im Dunkeln bleiben.
Besonders hart träfen die Änderungen vulnerable Gruppen. Familien mit kleinen Kindern, die bereits heute oft darum kämpfen müssen, ohne horrende Zusatzgebühren nebeneinander sitzen zu können, sähen sich einem noch größeren finanziellen Druck ausgesetzt, sollte die geplante Regelung zur kostenlosen Familienbestuhlung endgültig scheitern. Für Menschen mit Behinderungen wäre die Aufweichung der Haftungsregeln für ihre Mobilitätshilfen eine existenzielle Bedrohung, die ihre Reisefreiheit empfindlich einschränken würde. Es ist ein Politikansatz, der die Lasten konsequent auf die schwächsten Schultern verteilt.
Die Abdankung der einzigen Aufsichtsinstanz
Der vielleicht gefährlichste Aspekt dieser Entwicklung liegt jedoch in der fundamentalen Neudefinition der Rolle des Transportministeriums selbst. Im amerikanischen Rechtssystem kommt dem DOT eine einzigartige und unverzichtbare Funktion zu. Durch die föderale Gesetzgebung sind die Kompetenzen der einzelnen Bundesstaaten im Bereich der Luftfahrt stark beschnitten. Ein Passagier in Texas kann eine Fluggesellschaft nicht einfach vor einem staatlichen Gericht wegen unlauterer Geschäftspraktiken verklagen. Diese Aufgabe obliegt allein der Bundesbehörde in Washington. Das DOT ist, wie es ein Experte treffend formulierte, „der einzige Sheriff in der Stadt“.
Wenn dieser Sheriff nun aber nicht mehr die Bürger, sondern die Saloon-Besitzer schützt, bricht das gesamte System des Verbraucherschutzes zusammen. Die aktuelle Politik des Ministeriums deutet genau auf einen solchen Paradigmenwechsel hin: von einer Aufsichtsbehörde, die Verstöße ahndet und Regeln durchsetzt, hin zu einem Dienstleister für die Industrie, dessen primäres Ziel die Beseitigung von „regulatorischen Hindernissen“ ist. Die Partnerschaft mit den Generalstaatsanwälten der Bundesstaaten zur gemeinsamen Untersuchung von Missständen wird aufgekündigt, laufende Ermittlungen werden eingestellt. Das Ministerium dankt als Schutzmacht der Konsumenten ab und wird zum Erfüllungsgehilfen einer Industrie, die seit jeher jeden Versuch einer wirksamen Kontrolle bekämpft hat.
Ein Szenario der kalkulierten Entmachtung
Was sich vor unseren Augen abspielt, ist somit weit mehr als nur die Deregulierung eines einzelnen Wirtschaftszweiges. Es ist die bewusste Entmachtung des Konsumenten und die Zementierung einer Marktstruktur, in der wenige Konzerne die Regeln diktieren. Sollten die angekündigten Maßnahmen vollständig umgesetzt werden, ist das wahrscheinlichste mittelfristige Szenario eine weitere Verschlechterung der Servicequalität bei gleichzeitig steigender Intransparenz der Kosten. Die Flugreise in den USA würde noch stärker zu einem Produkt, bei dem der Kunde systematisch im Unklaren über seine Rechte und die tatsächliche Gegenleistung für sein Geld gelassen wird.
Die Auseinandersetzung um die Fluggastrechte ist letztlich eine Auseinandersetzung um die Frage, welche Rolle der Staat im 21. Jahrhundert spielen soll. Soll er als neutraler Schiedsrichter agieren, der faire Spielregeln für alle Marktteilnehmer sicherstellt? Oder soll er sich zum Komplizen der Stärksten machen und die Interessen der Allgemeinheit einer vermeintlichen wirtschaftlichen Effizienz opfern? Die Trump-Administration hat ihre Antwort auf diese Frage unmissverständlich gegeben. Für Amerikas Fluggäste bedeutet dies eine Zukunft mit erheblichen Turbulenzen – und ohne einen Sheriff, der ihnen im Notfall beisteht.