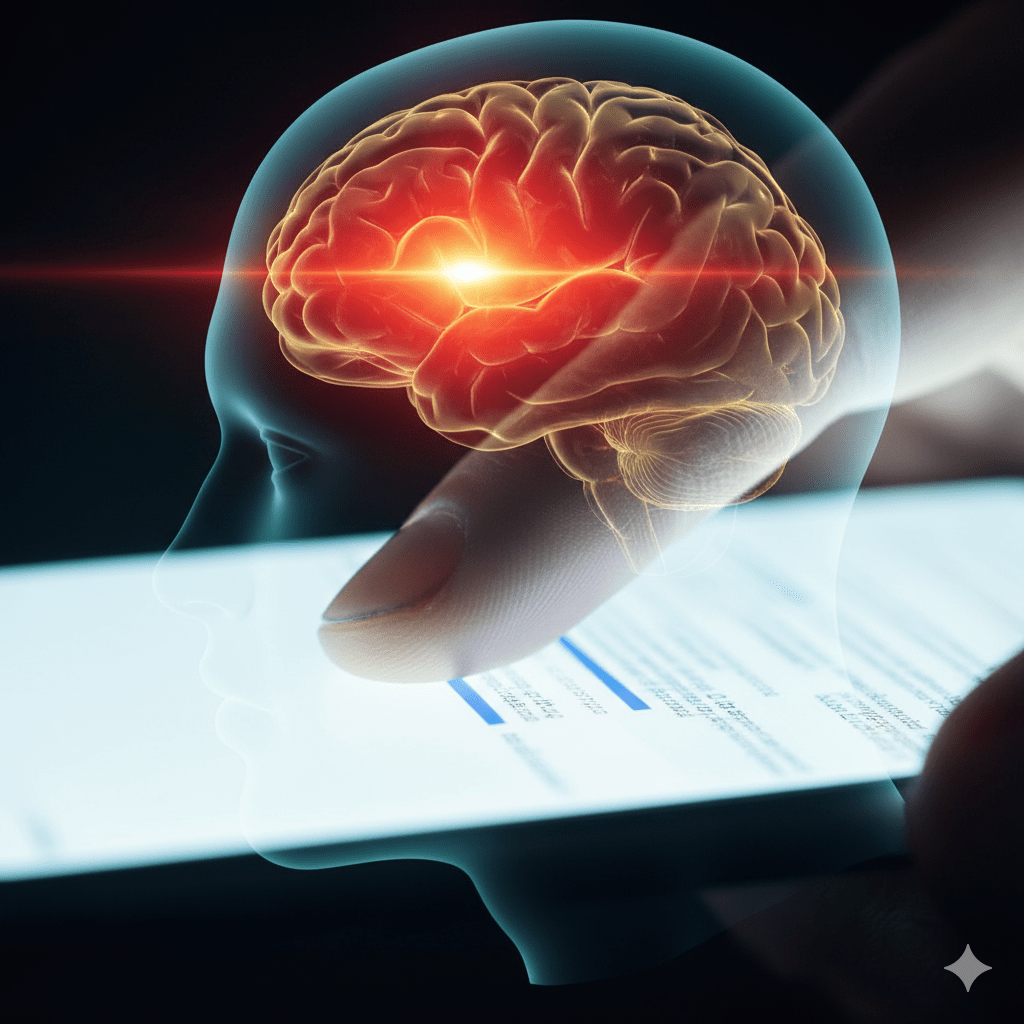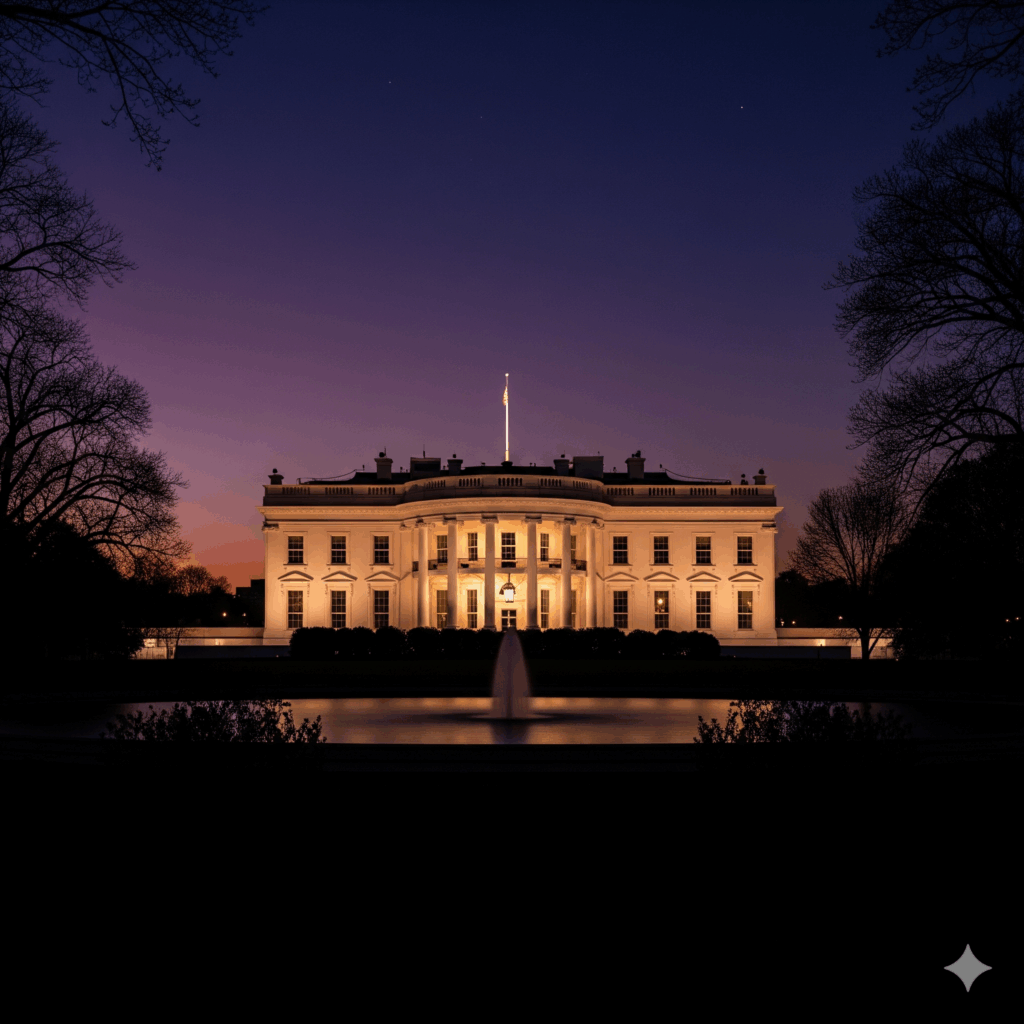Ein durchgesickerter Plan des Pentagon zur Entsendung von Truppen nach Louisiana ist mehr als nur eine administrative Notiz. Er enthüllt eine Strategie der Trump-Regierung, die das Fundament der amerikanischen Zivilgesellschaft erschüttert: den Einsatz von Soldaten als innenpolitisches Werkzeug gegen politische Gegner.
Es gibt Momente, in denen ein einziges Dokument, ein unscheinbarer Entwurf, den Blick auf eine tiefgreifende Verschiebung im Machtgefüge einer Nation freilegt. Die Papiere, die nun aus den Tiefen des Pentagon an die Öffentlichkeit gelangt sind, sind ein solcher Moment. Sie skizzieren keinen gewöhnlichen Einsatz, keine Reaktion auf eine Flutkatastrophe oder einen Flächenbrand. Sie beschreiben die minutiös geplante Entsendung von 1.000 Nationalgardisten in die urbanen Zentren Louisianas, um dort bis weit in das Jahr 2026 hinein Polizeiaufgaben zu übernehmen.
Auf den ersten Blick mag dies wie eine robuste Antwort auf Kriminalität wirken. Doch bei genauerer Betrachtung entpuppt sich der Plan als das, was er wirklich ist: ein Lehrstück über die Aushöhlung demokratischer Normen und die Instrumentalisierung des Militärs für politische Zwecke. Es ist die Geschichte einer Regierung, die gezielt die Grenzen zwischen Militär und Polizei verwischt, um ihren Einfluss in jenen Städten zu zementieren, die von der politischen Opposition regiert werden. Was wir in Louisiana beobachten, ist kein isolierter Vorfall, sondern der vorläufige Höhepunkt einer Strategie, die das Verhältnis zwischen Staat, Bürger und Soldat neu definieren könnte.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Title 32: Der juristische Dietrich zur Machtentfaltung
Um die wahre Dimension dieses Vorhabens zu verstehen, muss man einen Blick in den juristischen Werkzeugkasten der Administration werfen. Dort findet sich ein Instrument, das sich als besonders wirkmächtig erwiesen hat: Title 32 des U.S. Code. Diese Rechtsgrundlage ist der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Operation. Sie erlaubt es, Truppen der Nationalgarde unter der Kontrolle des jeweiligen Gouverneurs zu belassen, während ihre Kosten vollständig vom Bund getragen werden. Es ist ein genialer Kniff, der zwei entscheidende Hürden auf einmal überwindet.
Zum einen umgeht er den sogenannten Posse Comitatus Act, ein altes und ehrwürdiges Gesetz, das dem Bund grundsätzlich verbietet, das Militär für Polizeiaufgaben im eigenen Land einzusetzen. Da die Truppen formal unter dem Kommando des Staates Louisiana stehen, greift dieses Verbot nicht. Zum anderen hebelt dieser Mechanismus den Widerstand demokratischer Gouverneure aus, wie ihn die Trump-Administration zuvor in Kalifornien und Illinois erfahren hat. Die neue Strategie zielt nun auf republikanisch geführte Bundesstaaten mit demokratisch regierten Städten ab. Ein republikanischer Gouverneur wie Jeff Landry in Louisiana, der der Idee grundsätzlich positiv gegenübersteht, wird so zum entscheidenden Partner, um Truppen in demokratische Hochburgen wie New Orleans oder Baton Rouge zu bringen.
Die Interessenlagen sind klar verteilt: Präsident Trump kann Härte und Entschlossenheit demonstrieren und gleichzeitig in die Verwaltung politischer Gegner eingreifen. Gouverneur Landry kann auf massive föderale Ressourcen zurückgreifen, ohne die eigene Staatskasse zu belasten, und sich als verlässlicher Verbündeter des Präsidenten profilieren. Die Leidtragenden sind die demokratischen Bürgermeister und die Bürger ihrer Städte, über deren Köpfe hinweg eine militärische Präsenz geplant wird. Diese Vorgehensweise, die bereits bei der Übernahme der Kontrolle in Washington, D.C. zur Anwendung kam, wird hier zu einem wiederholbaren Modell weiterentwickelt – einer Blaupause für die Militarisierung der Innenpolitik.
Die Fiktion der Krise: Wenn Fakten der Erzählung weichen müssen
Jede außergewöhnliche Maßnahme verlangt nach einer außergewöhnlichen Begründung. Die Erzählung der Trump-Administration ist dabei denkbar einfach: Amerikas Städte, insbesondere die von Demokraten regierten, versinken in Gewalt und Chaos. „New Orleans ist in wirklich schlechter Verfassung“, erklärte der Präsident und versprach, die Lage „in anderthalb Wochen“ in Ordnung zu bringen. Es ist eine dystopische Rhetorik, die starke Bilder erzeugt und den Ruf nach einem starken Mann laut werden lässt.
Das einzige Problem dieser Erzählung ist, dass sie mit der Realität, wie sie sich in den offiziellen Kriminalitätsstatistiken widerspiegelt, kollidiert. Die der Planung zugrunde liegenden Dokumente werden durch die eigenen Daten konterkariert. Gerade in New Orleans ist die Zahl der Gewaltverbrechen nach einem Anstieg während der Pandemie signifikant gesunken. Die Mordrate hat einen Tiefstand erreicht, wie man ihn seit den 1970er Jahren nicht mehr gesehen hat. Bis Anfang September dieses Jahres ging die Gesamtkriminalität im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent zurück. Auch in Memphis, das ebenfalls als Ziel für einen ähnlichen Einsatz genannt wurde, sind die Zahlen für Gewaltverbrechen rückläufig. Lediglich in Baton Rouge zeigt sich ein gemischtes Bild, das aber keinesfalls das Bild einer außer Kontrolle geratenen Stadt zeichnet.
Was hier geschieht, ist die Erschaffung einer Realität durch schiere Behauptung. Die militärische Intervention ist nicht die Antwort auf eine existierende Krise, sondern die Krise wird als Vorwand für die bereits geplante Intervention heraufbeschworen. Der Einsatz ist, wie es in den Planungsdokumenten heißt, nicht an ein konkretes Notstandsereignis geknüpft. Er ist eine proaktive Machtdemonstration, die ihre Legitimation aus einer selbst geschaffenen Erzählung schöpft – einer Erzählung, die den Fakten nicht standhält.
Der Dammbruch: Wie etablierte Regeln geschleift werden
Vielleicht ist der beunruhigendste Aspekt dieses Plans nicht einmal die Diskrepanz zwischen Rhetorik und Realität, sondern der offene Bruch mit etablierten Verfahrensweisen. Traditionell ist der Einsatz der Nationalgarde ein Prozess, der von unten nach oben verläuft. Ein Gouverneur stellt nach einer Katastrophe oder in einer extremen Notlage einen Antrag auf Bundeshilfe. Das Pentagon prüft und genehmigt diesen Antrag.
In Louisiana scheint dieser Prozess auf den Kopf gestellt zu werden. Die Dokumente legen nahe, dass die Initiative vom Pentagon selbst ausgeht, das der Landesregierung einen Einsatzplan vorschlägt. Bisher ist nicht einmal klar, ob Gouverneur Landry überhaupt einen formellen Antrag gestellt hat. Randy Manner, ein ehemaliger Zwei-Sterne-General der Nationalgarde, nennt diesen Vorgang einen beispiellosen „politischen Griff nach der Macht“. In seiner gesamten 35-jährigen Dienstzeit habe er so etwas noch nie erlebt. Es ist, als würde ein Arzt einem gesunden Patienten eine Operation aufdrängen, die dieser nie verlangt hat.
Diese Umkehrung der Befehlskette ist ein Dammbruch. Sie verwandelt die Nationalgarde von einer Hilfstruppe, die von den Bundesstaaten im Notfall angefordert wird, in ein Instrument, das die Zentralregierung nach politischem Gutdünken in den Bundesstaaten platzieren kann. Die Tatsache, dass dieser weitreichende Plan durch ein Leak an die Öffentlichkeit gelangte und das Pentagon jeglichen Kommentar zu „vorläufigen“ Dokumenten verweigert, verstärkt das Bild einer intransparenten Politik, die im Verborgenen ausgehandelt wird. Das Misstrauen, das durch ein solches Vorgehen gesät wird, gräbt sich tief in das Fundament des föderalen Systems und des Vertrauens der Bürger in ihre Institutionen.
Soldaten als Kulisse: Die Belastung für Mensch und System
Hinter den abstrakten Debatten über Rechtsgrundlagen und Zuständigkeiten stehen die Menschen. Die Männer und Frauen der Nationalgarde sind keine Berufssoldaten im klassischen Sinne. Sie sind Bürger in Uniform, die ein ziviles Leben führen, in Unternehmen arbeiten, Familien haben. Sie haben sich verpflichtet, ihrem Land in echten Notfällen zu dienen – bei Naturkatastrophen oder zur Landesverteidigung.
Ihre wiederholte und langfristige Aktivierung für innenpolitische Polizeimissionen, die von Experten als „fabrizierte Notfälle“ bezeichnet werden, hat tiefgreifende Konsequenzen. Sie reißt die Gardisten aus ihrem Alltag, belastet ihre Arbeitgeber und Familien und untergräbt ihre eigene berufliche Entwicklung. Kori Schake vom American Enterprise Institute warnt vor einem „ätzenden Effekt“ auf die Beziehung zwischen der amerikanischen Gesellschaft und ihrem Militär. Wenn der Nachbar in Uniform plötzlich nicht mehr den Deich sichert, sondern im Nachbarviertel patrouilliert, verändert sich etwas Grundlegendes.
Hinzu kommen handfeste strategische Zielkonflikte. Der Plan würde rund 11 Prozent der verfügbaren Katastrophenschutzkräfte Louisianas binden – und das während der Hurrikansaison. Der Kommandeur der dortigen Nationalgarde räumte bereits ein, dass man im schlimmsten Fall auf die Hilfe von Truppen aus anderen Bundesstaaten angewiesen wäre. Ressourcen, die für echte Krisen gebraucht werden, werden für eine politisch motivierte Operation blockiert. Gleichzeitig bleibt die entscheidende Frage offen, welche Befugnisse diese Truppen überhaupt haben sollen. Dürfen sie Verhaftungen vornehmen? Die Dokumente schweigen dazu. Diese Ungewissheit stellt eine erhebliche Gefahr für die Bürgerrechte der Menschen in den betroffenen Vierteln dar.
Der Präzedenzfall und die offene Frage: Wohin steuert die Republik?
Der Plan für Louisiana steht nicht im luftleeren Raum. Er ist Teil eines Musters, einer erkennbaren Entwicklungslinie der zweiten Amtszeit Trumps. Wir sehen eine Regierung, die bereit ist, die traditionelle Rolle des Militärs auszuweiten und es als Werkzeug in der innenpolitischen Arena einzusetzen.
Jeder dieser Einsätze schafft einen neuen Präzedenzfall. Er normalisiert den Anblick von Soldaten auf amerikanischen Straßen und senkt die Hemmschwelle für zukünftige Interventionen. Langfristig könnte dies die föderale Balance der USA nachhaltig verschieben und die Rolle der Nationalgarde von einer bürgernahen Reserve zu einer nationalen Gendarmerie umdefinieren, die der Zentralregierung zur Verfügung steht.
Die entscheidende Frage, die der durchgesickerte Plan aufwirft, lautet daher nicht nur, ob 1.000 Soldaten nach New Orleans geschickt werden. Sie lautet: Welches Land wollen die Vereinigten Staaten sein? Ein Land, in dem die Trennung zwischen ziviler Strafverfolgung und militärischer Gewalt eine heilige Grenze bleibt? Oder ein Land, in dem diese Grenze je nach politischer Wetterlage verschoben werden kann? Der Entwurf aus dem Pentagon ist mehr als nur Tinte auf Papier. Er ist ein Blick in eine mögliche Zukunft – und es ist eine Zukunft, die Anlass zu ernster Sorge gibt.