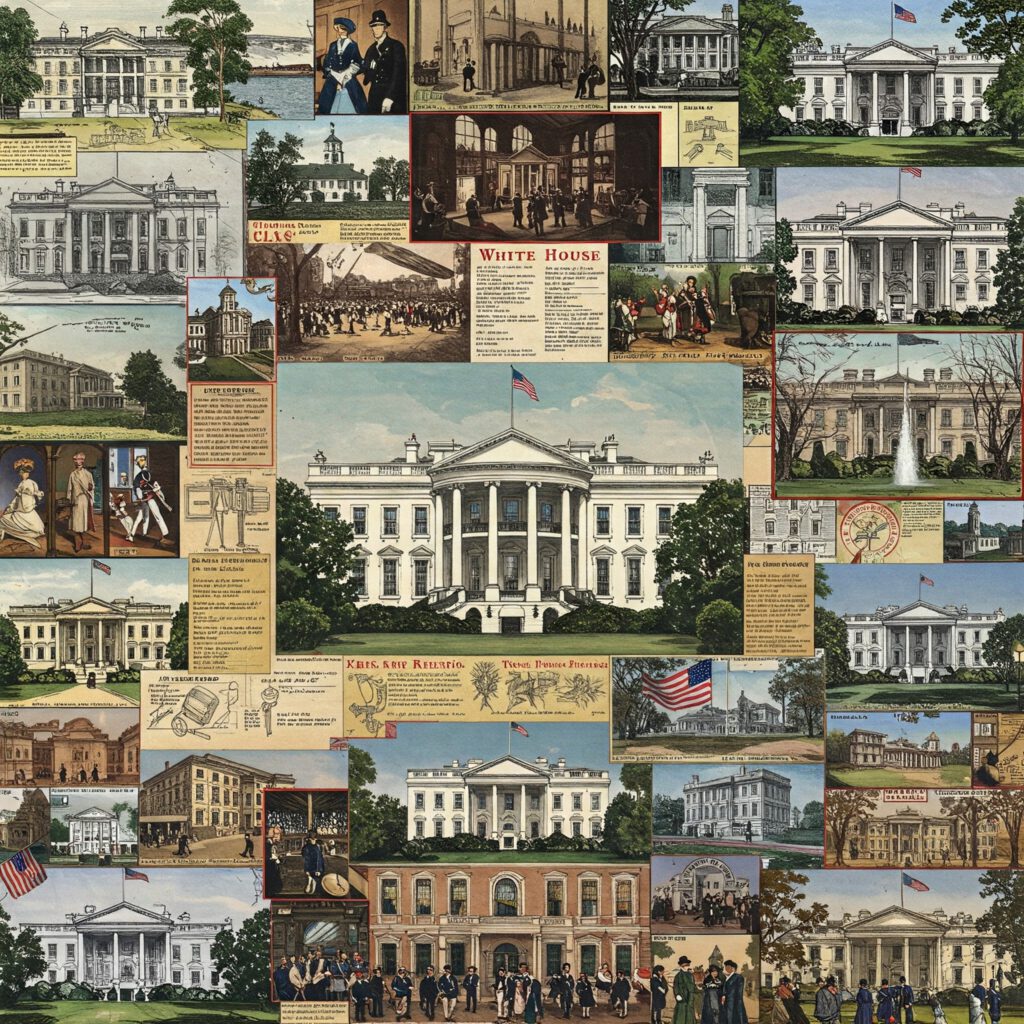Ein Porträt hängt an der Wand des Oval Office, links vom Resolute Desk. Es zeigt Ronald Reagan, den vierzigsten Präsidenten der Vereinigten Staaten, dessen Lächeln für eine ganze Generation von Konservativen zum Symbol wurde – ein Symbol für grenzenloses Vertrauen in den freien Markt, für die unantastbare Kraft des Individuums und für einen Staat, der sich aus dem Leben der Bürger und der Unternehmen zurückzieht. Doch in der zweiten Amtszeit von Donald Trump wirkt dieses Porträt wie ein Relikt aus einer fernen, fast vergessenen Epoche. Der Mann, der unter ihm am Schreibtisch sitzt, hat Reagans Slogan „Make America Great Again“ entliehen, doch er regiert mit einer wirtschaftspolitischen Agenda, die das Fundament der Reaganomics nicht nur erschüttert, sondern gezielt demontiert.
Wir erleben gerade keinen sanften Kurswechsel, sondern einen tektonischen Bruch. Die republikanische Partei, über vierzig Jahre lang die unangefochtene Hüterin des Marktradikalismus, wird Zeuge, wie ihr Präsident den Staat zurück ins Cockpit der amerikanischen Wirtschaft holt. Es ist eine Politik, die auf staatliche Beteiligungen, protektionistische Mauern und direkte politische Einflussnahme setzt – Werkzeuge, die Reagan als Vorboten der „sozialistischen“ Knechtschaft gegeißelt hätte. Die zentrale These, die sich aus Trumps Handeln herausschält, ist beunruhigend und radikal zugleich: Die Ära des ideologischen Glaubens an den Markt ist vorbei. An seine Stelle tritt ein pragmatischer, fast raubtierhafter Nationalismus, bei dem der Staat nicht länger nur Schiedsrichter, sondern aktiver, strategischer Spieler auf dem Feld der Konzerne ist. Dies ist keine Weiterentwicklung, es ist eine Revolution – und sie lässt die Geister der Vergangenheit im Grab rotieren.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Der Staat als Aktionär: Ein Pakt mit unkalkulierbarem Risiko
Der wohl dramatischste Bruch mit der republikanischen Orthodoxie manifestiert sich in einer Praxis, die in den USA bislang nur in tiefsten Krisen- oder Kriegszeiten denkbar war: Der Staat wird zum Anteilseigner privater Unternehmen. Als die Regierung einen Anteil von zehn Prozent an einem Giganten wie Intel übernahm, war das mehr als nur ein Finanzgeschäft; es war ein symbolischer Akt. Es folgten Beteiligungen am Seltene-Erden-Produzenten MP Materials und eine sogenannte „goldene Aktie“ an U.S. Steel, die dem Präsidenten persönliche Kontrolle über zentrale Unternehmensentscheidungen einräumt. Und dies scheint erst der Anfang zu sein. Das Handelsministerium liebäugelt bereits offen mit Einstiegen bei Rüstungskonzernen wie Lockheed Martin, während Analysten weitere Sektoren wie Pharma, Telekommunikation und Cybersicherheit auf der Liste sehen.
Hier offenbart sich der fundamentale Unterschied zur Reaganomics. Reagans Philosophie basierte auf der tiefen Überzeugung, dass der private Sektor per se effizienter, innovativer und freier sei als jede staatliche Bürokratie. Seine Politik zielte darauf ab, die Fesseln zu lösen, nicht, neue anzulegen. Trump kehrt diese Logik um. Sein Mechanismus ist der direkte Zugriff. Wo Reagan deregulierte, investiert Trump. Wo Reagan auf die unsichtbare Hand des Marktes vertraute, setzt Trump auf die sehr sichtbare Hand des Präsidenten. Die offizielle Begründung dafür lautet stets „nationale Sicherheit“. Es ist ein machtvolles Argument in einer Welt geopolitischer Spannungen, ein Passepartout, das fast jede Intervention zu rechtfertigen scheint. Die Regierung argumentiert, sie müsse in Schlüsselindustrien die Kontrolle behalten, um nicht von geopolitischen Rivalen wie China abhängig zu sein.
Doch Kritiker sehen darin einen gefährlichen Präzedenzfall. Sie fragen: Wo endet die nationale Sicherheit und wo beginnt der politische Dirigismus? Was passiert, wenn ein Unternehmen, an dem der Staat beteiligt ist, in Schieflage gerät? Ein Scheitern wäre nicht mehr nur eine betriebswirtschaftliche Niederlage, sondern ein politisches Debakel für die amtierende Regierung. Die Versuchung für den Staat, ein solches Unternehmen künstlich am Leben zu erhalten, wäre immens – zulasten des Steuerzahlers und auf Kosten des gesunden Wettbewerbs. Die Grenze zwischen Staat und Wirtschaft, einst eine heilige Doktrin, verschwimmt zu einer gefährlichen Grauzone, in der unternehmerische Entscheidungen nicht mehr allein nach Effizienz, sondern nach politischer Opportunität getroffen werden. Es ist ein vergiftetes Privileg, denn wer die Regierung als Partner im Aufsichtsrat hat, dessen unternehmerische Freiheit endet am Gitterzaun des Weißen Hauses.
Zölle als Allheilmittel: Die große Umverteilung nach oben
Ein weiteres Schlachtfeld, auf dem Trumps Bruch mit der Vergangenheit ausgetragen wird, ist die Handelspolitik. Reagan, obgleich kein dogmatischer Freihändler, warnte stets vor den Gefahren des Protektionismus, der am Ende nur Arbeitsplätze vernichte. Seine gelegentlichen Schutzmaßnahmen, wie die Zölle auf japanische Halbleiter oder Motorräder, waren taktische Nadelstiche in einem ansonsten auf offene Märkte ausgerichteten System – Ausnahmen, die die Regel bestätigten. Für Trump hingegen sind Zölle kein Notfallinstrument, sondern das Herzstück seiner Wirtschaftspolitik. Er feiert sie als geniale Strategie, die Billionen in die Staatskasse spülen soll.
Doch diese Feier beruht auf einer ökonomischen Fiktion. Trump insistiert darauf, dass das Ausland für die Zölle aufkommt. In Wahrheit sind es die amerikanischen Importeure, die die Abgaben an der Grenze entrichten und die Kosten an die Verbraucher weitergeben. Der Präsident bejubelt also effektiv eine massive Steuererhöhung für die eigene Bevölkerung. Die Verteilungswirkung ist fatal: Während die Zolleinnahmen den Staatshaushalt aufblähen, belasten sie vor allem die Konsumenten und jene Unternehmen, die auf importierte Vorprodukte angewiesen sind. Es ist eine Umverteilung von unten nach oben, getarnt als patriotischer Akt. Die Ironie dabei ist, dass Reagan einst mit dem Versprechen antrat, die Steuerlast der Bürger zu senken, während Trump nun, unter dem Deckmantel des Schutzes amerikanischer Interessen, eine der größten indirekten Steuererhöhungen der jüngeren Geschichte durchsetzt.
Der Angriff auf die Institutionen: Wenn der Präsident den Schiedsrichter entmachtet
Die vielleicht subtilste, aber langfristig schädlichste Abweichung von der republikanischen Tradition ist Trumps Umgang mit den unabhängigen Institutionen der Wirtschaft. Sein andauernder Feldzug gegen die Federal Reserve und ihren Vorsitzenden Jerome H. Powell steht in krassem Gegensatz zu Reagans respektvollem Verhalten. In den frühen 1980er-Jahren, als Fed-Chef Paul Volcker die Zinsen drastisch anhob, um die galoppierende Inflation zu brechen, stürzte die US-Wirtschaft in eine tiefe Rezession, und die Arbeitslosigkeit schnellte auf fast elf Prozent. Der politische Druck auf Reagan war enorm. Dennoch stärkte er Volcker öffentlich den Rücken und ernannte ihn sogar für eine zweite Amtszeit. Er verstand, dass die Unabhängigkeit der Zentralbank eine unantastbare Säule für die Stabilität des Dollars und der gesamten Wirtschaft ist.
Trump hingegen behandelt die Fed wie eine widerspenstige Abteilung seines eigenen Unternehmens. Er attackiert Powell öffentlich, fordert radikale Zinssenkungen, die die meisten Ökonomen für brandgefährlich halten, und versuchte sogar, eine Gouverneurin wegen haltloser Vorwürfe zu entlassen. Diese Erosion der institutionellen Unabhängigkeit ist pures Gift für das Vertrauen der Märkte. Sie signalisiert, dass geldpolitische Entscheidungen nicht mehr auf Basis ökonomischer Daten, sondern nach den politischen Wünschen des Präsidenten getroffen werden könnten. Ähnlich verhält es sich im Kleinen: Wenn der Präsident eine Restaurantkette wie Cracker Barrel öffentlich zur Änderung ihres Logos drängt oder seine Macht nutzt, um den Namen eines Football-Teams zu beeinflussen, sendet er eine klare Botschaft an die gesamte amerikanische Unternehmenslandschaft: Loyalität zum Präsidenten ist wichtiger als die Loyalität zum Kunden oder zum Aktionär.
Eine neue Doktrin oder nur ein opportunistischer Machtrausch?
Stehen wir also am Beginn einer neuen, kohärenten Wirtschaftslehre – dem „Trumpismus“? Die Fakten legen einen anderen Schluss nahe. Statt einer durchdachten Doktrin gleicht Trumps Vorgehen eher einem opportunistischen Zugriff auf die Schalthebel der Konzerne. Es ist die Politik eines „Dealmakers“, der von Fall zu Fall entscheidet, wo er Druck ausüben, einen Deal machen oder einen Anteil für den Staat herausschlagen kann. Es geht weniger um eine ideologische Vision für den amerikanischen Kapitalismus als um die Maximierung der eigenen Macht und des wahrgenommenen nationalen Vorteils im Hier und Jetzt. Die Vergleiche mit Chinas staatsgetriebener Wirtschaft, in der Staatsunternehmen fast die Hälfte des Börsenwertes ausmachen, sind alarmierend, aber vielleicht nicht ganz treffend. Chinas Modell folgt einer langfristigen strategischen Planung. Trumps Modell wirkt impulsiv, transaktional und zutiefst persönlich.
Die große Frage, die über seiner zweiten Amtszeit schwebt, ist, ob sich dieser Stil verfestigen und zu einem dauerhaften Modell entwickeln kann. Könnte ein pragmatischer Nationalismus, der sich je nach Bedarf kapitalistischer oder dirigistischer Instrumente bedient, die neue Normalität für die Republikanische Partei werden? Die Verteidiger im Weißen Haus betonen, man kombiniere die Interventionen ja mit klassischen republikanischen Rezepten wie Steuersenkungen und Deregulierung. Doch das ist kein kohärentes Ganzes, es ist ein Widerspruch in sich. Es ist, als würde man gleichzeitig aufs Gaspedal und auf die Bremse treten.
Was am Ende bleibt, ist die Erosion einer einst festen Gewissheit. Der amerikanische Kapitalismus, wie ihn die Republikaner seit Reagan gepredigt haben, ist zu einem Verhandlungsobjekt geworden. Sein Schicksal hängt nicht mehr von unpersönlichen Marktgesetzen ab, sondern vom Willen eines Mannes im Oval Office. Ronald Reagan blickt von der Wand herab, und es ist schwer vorstellbar, dass er das, was er sieht, wiedererkennen würde. Er wollte einen gefesselten Riesen befreien. Sein Nachfolger scheint damit zufrieden zu sein, ihn an eine neue, kürzere Leine zu legen – seine eigene.