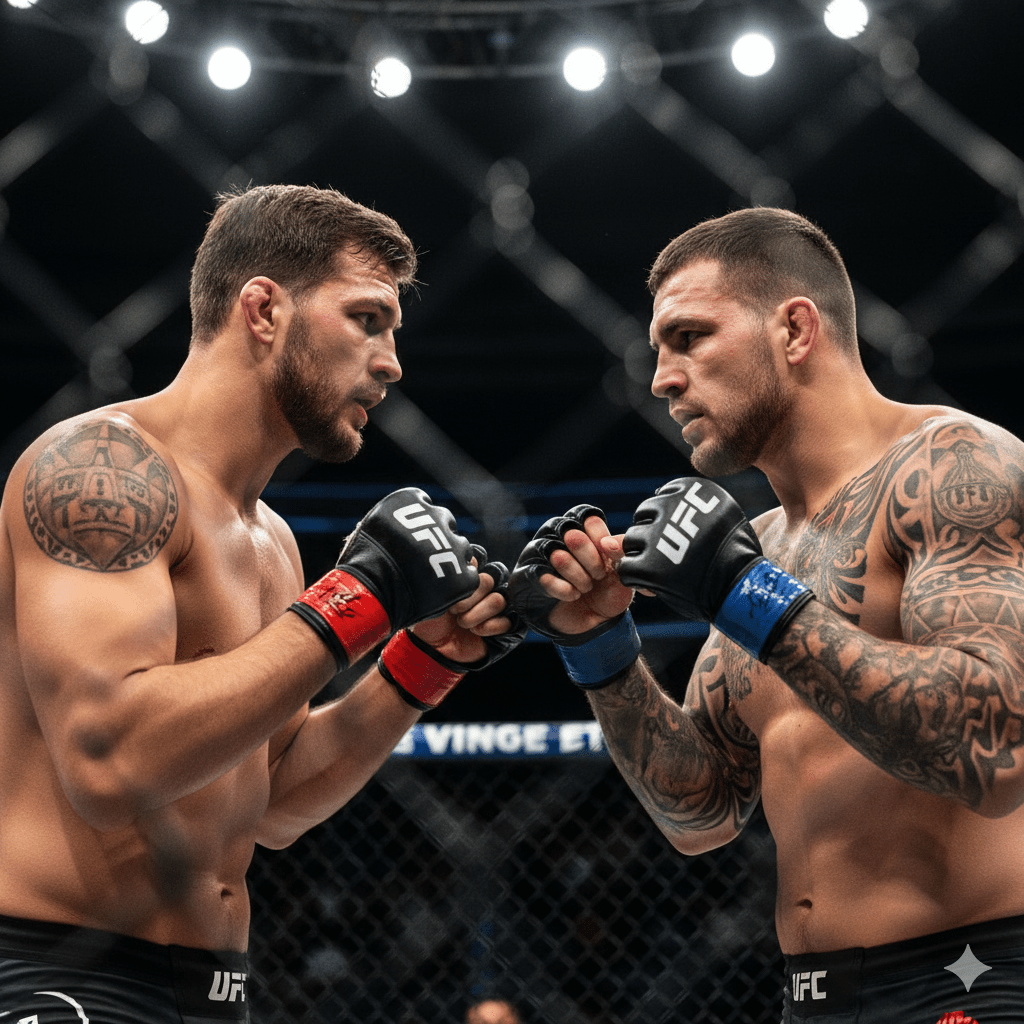Ein Krieg, verkündet und für beendet erklärt per Social-Media-Post. Ein Ultimatum an die engsten Verbündeten, das eine 75 Jahre alte Sicherheitsarchitektur in ihren Grundfesten erzittern lässt. Ein Feldzug gegen die eigene Justiz, die Wissenschaft und die renommiertesten Universitäten des Landes. Die letzte Juniwoche des Jahres 2025 war keine gewöhnliche Woche. Sie war ein Brennglas, das mit unbarmherziger Schärfe die Konturen einer neuen globalen und nationalen Realität nachzeichnete. Angetrieben von der erratischen und konfrontativen Politik des US-Präsidenten Donald Trump, offenbarte sich ein Muster, das weit über tagespolitische Manöver hinausgeht: die systematische Zerstörung von etablierten Normen und Institutionen als primäres Werkzeug der Macht. Von den Bomben auf iranische Atomanlagen bis zu den diplomatischen Gefechten in Den Haag, von den Gerichtssälen in Maryland bis zu den Hörsälen in Harvard – die Ereignisse dieser Woche erzählen die Geschichte eines Amerikas und einer Welt an einem gefährlichen Wendepunkt.
Der Zwölf-Tage-Krieg: Ein Sieg, auf Twitter verkündet, mit ungewissem Ausgang
Im Zentrum der globalen Anspannung stand zweifellos der als „Zwölf-Tage-Krieg“ bezeichnete Konflikt mit dem Iran, der die Welt an den Rand eines Flächenbrandes brachte. Die Eskalation begann mit massiven israelischen Angriffen, die laut Premierminister Benjamin Netanjahu das Ziel hatten, das iranische Nuklear- und Raketenprogramm zu neutralisieren. Den entscheidenden Wendepunkt markierte jedoch der direkte Eintritt der USA, die mit B-2-Tarnkappenbombern drei zentrale iranische Atomanlagen attackierten. Präsident Trump feierte die Operation als „spektakulären militärischen Erfolg“ und sprach von der „kompletten und totalen Auslöschung“ der Anlagen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Doch hinter der triumphalen Rhetorik offenbarte sich eine Realität voller Widersprüche und beunruhigender Ungewissheit. Erste Einschätzungen von US-Geheimdiensten zeichneten ein weitaus nüchterneres Bild: Die unterirdischen Anlagen in Fordo und Natans seien zwar beschädigt, aber nicht zerstört, das iranische Programm lediglich um Monate, nicht Jahre, zurückgeworfen. Weit bedrohlicher ist jedoch die Erkenntnis, dass der Iran offenbar mit einem Angriff gerechnet hatte. Geheimdienstinformationen und Satellitenbilder deuten darauf hin, dass Teheran den Großteil seines auf 60 Prozent angereicherten Urans – genug für den Bau mehrerer Bomben – rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben könnte. Wo sich diese fast 408 Kilogramm waffenfähigen Materials nun befinden, ist eine der gefährlichsten offenen Fragen nach dem Konflikt.
Die iranische Reaktion auf die Angriffe war ein Meisterstück strategischer Kalkulation. Ein vorab angekündigter Raketenangriff auf die US-Basis Al-Udeid in Katar diente als gesichtswahrende, aber deeskalierende Revanche. Trump nutzte diese „sehr schwache Reaktion“ umgehend, um per Social-Media-Post einen „vollständigen und totalen Waffenstillstand“ zu verkünden und den Krieg im Alleingang für beendet zu erklären. Dieser Frieden per Mausklick erwies sich jedoch als brüchig. Während das Weiße Haus feierte, wurden weitere Raketeneinschläge in Israel gemeldet. Die Episode hinterlässt einen Scherbenhaufen: Der militärische Schlag könnte den Iran nun erst recht motivieren, im Geheimen und mit aller Macht nach der Bombe zu streben, um sein Überleben zu sichern. Statt Klarheit herrscht die Angst vor einem langen, schmutzigen Schattenkrieg, geführt durch Terror und verdeckte Operationen.
Europas teuer erkaufte Gnadenfrist: Das Fünf-Prozent-Diktat in Den Haag
Während die USA im Nahen Osten Fakten schufen, fanden sich die europäischen Verbündeten in der Rolle unbeteiligter Zuschauer wieder, die einmal mehr vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Diese Erfahrung der Machtlosigkeit bildete den düsteren Hintergrund des NATO-Gipfels in Den Haag, der zu einer „Trump-Appeasement-Show“ verkam. Getrieben von der Angst vor dem russischen Feind und dem unberechenbaren amerikanischen Freund, unterwarfen sich die Europäer einem Diktat aus Washington: Die Verteidigungsausgaben sollen auf fünf Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung ansteigen.
Diese Zahl ist kein strategisches Erfordernis, sondern ein politisches Instrument, das Misstrauen und eine neue transaktionale Logik in die Allianz trägt. Um die politisch motivierte Marke zu erreichen, wurde ein Kompromiss voller semantischer Tricks und kreativer Buchführung geschmiedet. Nur 3,5 Prozent sind für klassische Militärausgaben vorgesehen; die restlichen 1,5 Prozent können für vage „verteidigungs- und sicherheitsrelevante Ausgaben“ wie Infrastruktur oder Cybersicherheit angerechnet werden – eine „Trump-Prämie“. Die Einigung, die mit flexiblen Fristen bis 2035 und nationalen Spielräumen erkauft wurde, kann die tiefen Risse im Bündnis kaum kitten. An der Ostflanke herrscht existenzielle Dringlichkeit, während hochverschuldete Staaten wie Spanien das Ziel als „unvereinbar mit unserem Sozialstaat“ ablehnen.
Die dramatischste Konsequenz dieser Neuordnung ist die Marginalisierung der Ukraine. Um Trump, der eine offene Abneigung gegen Präsident Selenskyj hegt, nicht zu provozieren, wurde Kiew auf dem Gipfel zur Randnotiz degradiert. Die einstige Formel vom „unumkehrbaren Weg“ in die NATO fehlte im Abschlussdokument komplett. Europa kauft sich mit dem 5-Prozent-Versprechen Zeit, doch der Preis ist hoch: Die einstige Wertegemeinschaft verwandelt sich in eine fragile Zweckgemeinschaft, deren Sicherheitsgarantie vom Wohlwollen eines unzuverlässigen Schutzherrn abhängt.
Die Heimatfront: Trumps systematischer Angriff auf Justiz, Wissenschaft und Academia
Parallel zur Neuausrichtung der Weltordnung eskaliert die Trump-Administration den Kampf an der Heimatfront – gegen jene Institutionen, die als unabhängige Korrektive der Macht fungieren. Ein zentrales Schlachtfeld ist die Justiz. Der Fall des illegal abgeschobenen Kilmar Abrego Garcia, dessen Rückkehr von mehreren Gerichten bis zum Supreme Court angeordnet, aber von den Behörden wochenlang verweigert wurde, ist hierfür symptomatisch. Ein Whistleblower-Bericht enthüllte die tiefsitzende Verachtung für richterliche Urteile in der Administration, gipfelnd in der kolportierten Anweisung eines hochrangigen Beamten, dem Gericht „,Fuck youʻ zu sagen“ und eine Anordnung zu ignorieren. Diese Praxis der Missachtung wird durch eine strategische Schwächung der Justiz ergänzt. Mit einer 6:3-Entscheidung schränkte der Supreme Court das mächtigste Werkzeug unterer Instanzen, die landesweite einstweilige Verfügung, drastisch ein und verschob so das Machtgefüge zugunsten des Präsidenten.
Dieser Angriff auf unabhängige Institutionen erstreckt sich auch auf die Wissenschaft und die Hochschullandschaft. Die Ernennung des bekennenden Impfskeptikers Robert F. Kennedy Jr. zum Gesundheitsminister führte zu einer systematischen Demontage der wissenschaftlichen Impfpolitik. Wissenschaftliche Gremien wurden durch ideologische Verbündete ersetzt, und jahrzehntelanger wissenschaftlicher Konsens wurde infrage gestellt. Ebenso gezielt war der Feldzug gegen die Harvard University. Unter dem Vorwand des Antisemitismus-Kampfes nutzte die Regierung den gesamten staatlichen Instrumentenkasten – vom Entzug der Visa-Zertifizierung für 7.000 internationale Studierende bis zum Einfrieren von Forschungsgeldern in Milliardenhöhe –, um eine der renommiertesten Universitäten der Welt auf politische Linie zu zwingen.
Widersprüche und Willkür: Wenn Politik an der Realität zerschellt
Ein weiteres Kennzeichen der Woche war die offene Kollision zwischen politischer Rhetorik und den Realitäten von Wirtschaft und Gesellschaft. Während Präsident Trump einen umfassenden Angriff auf die Elektromobilität startete, haben Amerikas Autogiganten bereits 146 Milliarden Dollar in ebenjene Zukunftstechnologie investiert. Die Politik, die die heimische Industrie zu schützen vorgibt, droht diese nun im globalen Wettbewerb mit China entscheidend zu schwächen. Dieser Widerspruch zwischen politischem Willen und ökonomischer Vernunft ist kein Einzelfall.
Das Debakel um das „T1-Smartphone“, das vollmundig als „Made in the U.S.A.“ beworben wurde, entlarvte die nationalistische Rhetorik als Farce. Mangels Infrastruktur und Know-how in den USA musste das patriotische Versprechen klammheimlich von der Website verschwinden. Gleichzeitig peitschten die Republikaner im Kongress ein unpopuläres Gesetzespaket, die „One Big Beautiful Bill“, durch, das massive Kürzungen im sozialen Netz vorsieht, um weitere Steuersenkungen zu finanzieren. Angetrieben von der Angst vor dem eigenen Wähler und dem Druck des Präsidenten, wurde mit buchhalterischen Tricks gearbeitet, um die wahren Kosten zu verschleiern – eine Form „fiskalischer Alchemie“.
Die Fieberkurve einer Nation im Stresstest
All diese politischen Verwerfungen finden nicht im luftleeren Raum statt, sondern in einer Gesellschaft, die bereits am Limit ist. Eine erstickende Hitzewelle, gefangen unter einem sogenannten „Hitzedom“, legte sich über weite Teile der USA und fungierte als unbarmherziger Stresstest. Die Hitze, die offiziell als die „tödlichste Wettergefahr“ gilt, ist mehr als ein meteorologisches Phänomen. Sie legt die tiefen Risse der amerikanischen Gesellschaft offen: die bröckelnde Infrastruktur, die soziale Ungleichheit, die den Zugang zu einer Klimaanlage über Leben und Tod entscheiden lässt, und die politische Polarisierung. Der Kampf um das größte Klimaschutzgesetz der US-Geschichte, den Inflation Reduction Act (IRA), den die Republikaner vollständig abschaffen wollen, zeigt, dass selbst angesichts einer existenziellen Bedrohung kein Konsens möglich ist. Die Klimakrise ist nicht länger nur ein politisches Debattenthema; sie wird zu einer physischen Kraft, die die fundamentalen Prozesse der Demokratie, wie den Gang zur Wahlurne, direkt beeinflusst und stört. Die sengende Hitze ist die Fieberkurve einer Nation, die in einem Strudel aus internen Konflikten und externem Druck gefangen ist und deren institutionelles Immunsystem auf eine historische Probe gestellt wird.