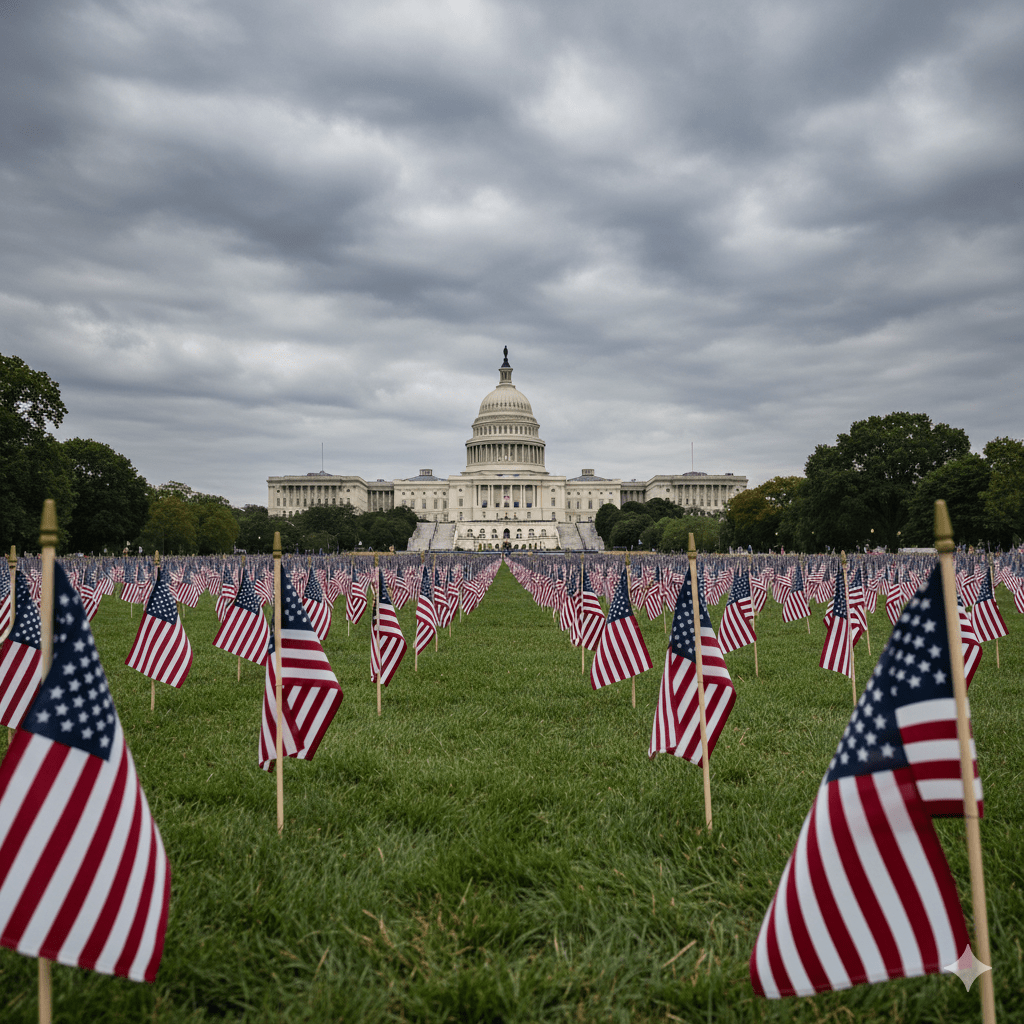Ein per Social-Media-Post ausgerufener Frieden, der binnen Stunden von Raketeneinschlägen und gegenseitigen Schuldzuweisungen erschüttert wird. Ein US-Präsident, der sich erst als kompromissloser Feldherr und dann als überparteilicher Friedensfürst inszeniert. Ein israelischer Premier, der aus dem Konflikt innenpolitisch gestärkt hervorgeht, und ein iranisches Regime, das eine militärische Demütigung in einen propagandistischen Sieg umdeutet. Die Bilanz des zwölftägigen Krieges zwischen Israel und dem Iran, der durch das direkte Eingreifen der USA eine neue, globale Dimension erhielt, ist ein Amalgam aus Widersprüchen, Propaganda und strategischer Unschärfe. Der von Donald Trump verkündete Waffenstillstand ist kein Fundament für eine stabile Ordnung, sondern vielmehr ein brüchiges Dach über einem schwelenden Brand, dessen Flammen jederzeit neu auflodern können – womöglich in noch gefährlicherer, asymmetrischer Form. Die vergangenen 24 Stunden haben die Illusion einer klaren Lösung pulverisiert und stattdessen ein Kaleidoskop an neuen Risiken und ungelösten Fragen offengelegt.
„Totale Vernichtung“ oder nur ein Kratzer? Der Streit um den Erfolg der Schläge
Im Zentrum der Verwirrung steht die fundamentale Frage nach dem Ergebnis der Militärschläge. Während Präsident Trump mit gewohntem Superlativ von einer „kompletten und totalen Vernichtung“ der iranischen Atomanlagen sprach, zeichnen erste Analysen von US-Geheimdiensten ein dramatisch anderes Bild. Demnach sei das iranische Atomprogramm keineswegs ausgelöscht, sondern lediglich um wenige Monate zurückgeworfen worden. Die hochgelobten bunkerbrechenden Bomben, abgeworfen von B-2-Tarnkappenbombern in einer logistisch beeindruckenden Mission von Missouri aus, haben laut diesen ersten Einschätzungen zwar die Zugänge zu den tief in den Bergen vergrabenen Anlagen in Fordo versiegelt, die unterirdischen Hallen selbst aber nicht zum Einsturz gebracht. Satellitenbilder bestätigen schwere Schäden an oberirdischen Strukturen in Fordo, Natanz und Isfahan, doch das Herz des Programms tickt womöglich weiter.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Noch brisanter ist die Erkenntnis, dass das iranische Regime offenbar mit einem Angriff gerechnet hatte. Geheimdienstinformationen und Satellitenaufnahmen deuten darauf hin, dass Teheran einen Großteil seines hochangereicherten Urans – genug für mehr als ein Dutzend Bomben – rechtzeitig vor den Angriffen an geheime, unbekannte Orte verlegt haben könnte. Damit verfehlt die militärische Operation ihr strategisches Hauptziel: dem Iran das waffenfähige Material zu entziehen. Die Diskrepanz zwischen Trumps triumphaler Rhetorik und der nüchternen Analyse der Nachrichtendienste könnte kaum größer sein und unterstreicht, dass der Konflikt weniger durch Fakten als durch Narrative bestimmt wird.
Nach den Bomben: Irans Rache auf leisen Sohlen
Die relative Milde der offiziellen iranischen Vergeltung – ein vorab angekündigter Raketenangriff auf einen US-Stützpunkt in Katar, der ohne Verluste blieb – sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die eigentliche Reaktion Teherans noch ausstehen dürfte. Westliche Sicherheitsdienste gehen davon aus, dass ein geschwächter Iran nun verstärkt auf seine bewährte Strategie der asymmetrischen Kriegsführung setzen wird. Statt einer offenen militärischen Konfrontation, die das Land nicht gewinnen kann, dürfte der Fokus auf verdeckten Operationen liegen: Terroranschläge, gezielte Attentate im Ausland und die Destabilisierung der Region durch Stellvertretermilizen.
Die Erfahrungen nach der Tötung von Quds-Force-General Qasem Soleimani dienen hier als Blaupause. Auch damals schien die offizielle Reaktion verhalten, doch in den Folgejahren wurden zahlreiche Mordkomplotte gegen hochrangige US-Vertreter wie John Bolton und Mike Pompeo aufgedeckt. Neu und besorgniserregend ist dabei die zunehmende Verflechtung iranischer Geheimdienste mit internationalen kriminellen Organisationen wie Biker-Gangs oder Drogenkartellen, um Operationen auf westlichem Boden durchzuführen und die eigene Urheberschaft zu verschleiern. Diese Taktik, obwohl oft von stümperhafter Ausführung geprägt, zeugt von einer wachsenden Verzweiflung und Unberechenbarkeit.
Ein politischer Sieg für Netanyahu, eine Niederlage für Teheran
Während die strategische Bilanz des Konflikts unklar bleibt, sind die innenpolitischen Gewinner und Verlierer bereits deutlich auszumachen. Für den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu erweist sich der Schlagabtausch als politischer Glücksfall. Nach Monaten innenpolitischer Krisen und sinkender Umfragewerte im Zuge des Gaza-Krieges hat ihn die entschlossene Konfrontation mit dem Erzfeind Iran in der Gunst der israelischen Öffentlichkeit wieder steigen lassen. Selbst seine schärfsten Kritiker zollen ihm für die Kühnheit, die USA zu einem direkten Eingreifen bewegt zu haben, Anerkennung. Dieses neu gewonnene politische Kapital verschafft Netanyahu erheblichen Handlungsspielraum. Analysten spekulieren, dass er nun aus einer Position der Stärke heraus die verfahrenen Verhandlungen über den Gaza-Krieg und die Freilassung der Geiseln zu einem Abschluss bringen könnte, ohne den Zusammenbruch seiner rechtsgerichteten Koalition fürchten zu müssen.
Auf der anderen Seite steht das iranische Regime, das eine schwere militärische Niederlage erlitten hat. Die Zerstörung von Luftverteidigungssystemen, Raketenstellungen und Teilen der Nuklearanlagen sowie der Verlust hochrangiger Militärführer stellen eine empfindliche Schwächung dar. Nach innen wird diese Realität jedoch in eine heroische Siegeserzählung umgedeutet. Staatliche Medien feiern den Waffenstillstand als einen dem „zionistischen Feind aufgezwungenen“ Triumph, der die militärische Stärke und Widerstandsfähigkeit der Islamischen Republik beweise. Dieser krasse Widerspruch zwischen Propaganda und Realität birgt erhebliches internes Konfliktpotenzial. Während das Regime versucht, mit nationalistischer Rhetorik seine Basis zu konsolidieren, wächst in der Bevölkerung der Unmut über die Unfähigkeit der Führung, das Land zu schützen.
Chinas zögerliche Zurückhaltung und die Spaltung des Westens
Auf der globalen Bühne offenbarte der Konflikt die Grenzen geopolitischer Ambitionen. China, das sich in den letzten Jahren als neuer diplomatischer Schwergewicht im Nahen Osten positionieren wollte, blieb auffallend passiv. Trotz seiner strategischen Partnerschaft mit Teheran und seiner Abhängigkeit von Öl aus der Region verurteilte Peking die Angriffe zwar, vermied aber jede substanzielle Unterstützung für den Iran. Chinas oberste Priorität ist die Stabilität der Handelsrouten, insbesondere der Straße von Hormus, ein Interesse, das es letztlich mit den USA teilt. Diese eigennützige Zurückhaltung demonstrierte, dass Washington auf absehbare Zeit der entscheidende militärische und diplomatische Akteur in der Region bleibt, während Chinas Einfluss primär ein kommerzieller ist.
Gleichzeitig legte die Krise die tiefen Gräben im Westen offen. In den USA löste Trumps eigenmächtiges Vorgehen eine heftige verfassungsrechtliche Debatte aus. Führende Demokraten im Kongress versuchen, mit einer „War Powers Resolution“ die Befugnisse des Präsidenten zur Kriegsführung zu beschneiden. Doch die Partei ist in der Frage gespalten, da viele Abgeordnete zögern, Maßnahmen zu unterstützen, die als Schwächung der Unterstützung für Israel interpretiert werden könnten. Die Republikaner stellen sich indes geschlossen hinter den Präsidenten und erklären das Gesetz, das dem Kongress die Kriegserklärung vorbehält, teils für verfassungswidrig.
Das Völkerrecht als Kollateralschaden
Der wohl größte langfristige Schaden des Konflikts betrifft die internationale Ordnung selbst. Die präventiven Schläge Israels und der USA, deren unmittelbare Notwendigkeit von kaum einem Experten bestätigt wird, haben das völkerrechtliche Gewaltverbot weiter ausgehöhlt. Kommentatoren stellen fest, dass westliche Staaten ihre moralische Autorität verspielen, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine völkerrechtlich zu verurteilen, wenn sie selbst nach dem „Recht des Stärkeren“ handeln. Diese Entwicklung befeuert eine kognitive Dissonanz bei jenen, die an die Kraft von Diplomatie und internationalem Recht glauben, nun aber mit einem vermeintlichen Erfolg der militärischen Hardliner konfrontiert sind.
Nukleare Doppelmoral: Israels Erbe und Irans Zukunft
Die Konfrontation wird zusätzlich durch den Vorwurf einer eklatanten Doppelmoral belastet. Analysen rufen in Erinnerung, dass der Iran bei seiner nuklearen Täuschungsstrategie einem Drehbuch folgt, das einst von Israel selbst geschrieben wurde. In den 1950er- und 60er-Jahren täuschte Israel systematisch die USA und die Weltgemeinschaft, um heimlich zur Atommacht aufzusteigen – von der Behauptung, eine Atomanlage sei eine Textilfabrik, bis hin zum Bau von Scheinkontrollräumen, um Inspektoren zu täuschen. Dass die USA diese Realität letztlich akzeptierten und Israel bis heute außerhalb des Atomwaffensperrvertrags dulden, während sie dem Iran ebenjenes Streben mit militärischer Gewalt verwehren, nährt seit Jahrzehnten den Vorwurf des zweierlei Maßes im Nahen Osten.
Langfristige Risiken einer militärischen Lösung
Die kurzfristige militärische Schwächung des iranischen Atomprogramms könnte sich langfristig als Pyrrhussieg erweisen. Kritiker wie der ehemalige US-Außenminister Antony Blinken argumentieren, Trump versuche nun, „ein Feuer zu löschen, das er selbst angefacht hat“, indem er 2018 aus dem funktionierenden Atomabkommen ausstieg. Durch die Angriffe hat der Iran nun nicht nur einen stärkeren Anreiz, die Bombe als ultimative Überlebensgarantie zu bauen, sondern auch das Wissen, wie seine Anlagen verwundbar sind. Es ist zu befürchten, dass Teheran sein Programm nun an neuen, noch tieferen und besser geschützten Standorten wieder aufbauen wird, die für zukünftige Luftangriffe unerreichbar wären. Die militärische Option hat das Problem nicht gelöst, sondern womöglich nur in die Zukunft verlagert und erschwert.
Ein brüchiger Friede mit ungewissem Verfallsdatum
Am Ende bleibt das Bild eines Präsidenten, der den Konflikt nach Belieben eskaliert und deeskaliert, angetrieben von innenpolitischen Motiven und dem Wunsch, sich auf der Weltbühne als triumphaler Macher zu inszenieren. Sein erratisches Krisenmanagement, das von Drohungen zu Friedensangeboten und von Wutausbrüchen zu Selbstlob changiert, hat einen Waffenstillstand hervorgebracht, dem niemand traut. Dieser „Friede“ ist nicht das Ergebnis einer strategischen Klärung, sondern einer gegenseitigen Erschöpfung und politischer Kalkulationen. Er löst keine der zugrundeliegenden Konfliktlinien, sondern verschiebt sie lediglich ins Verdeckte und Asymmetrische. Die Welt ist nach diesen zwölf Tagen nicht sicherer, sondern mit einem neuen, noch unberechenbareren Kapitel des Nahostkonflikts konfrontiert – mit einem Waffenstillstand, dessen Verfallsdatum niemand kennt.