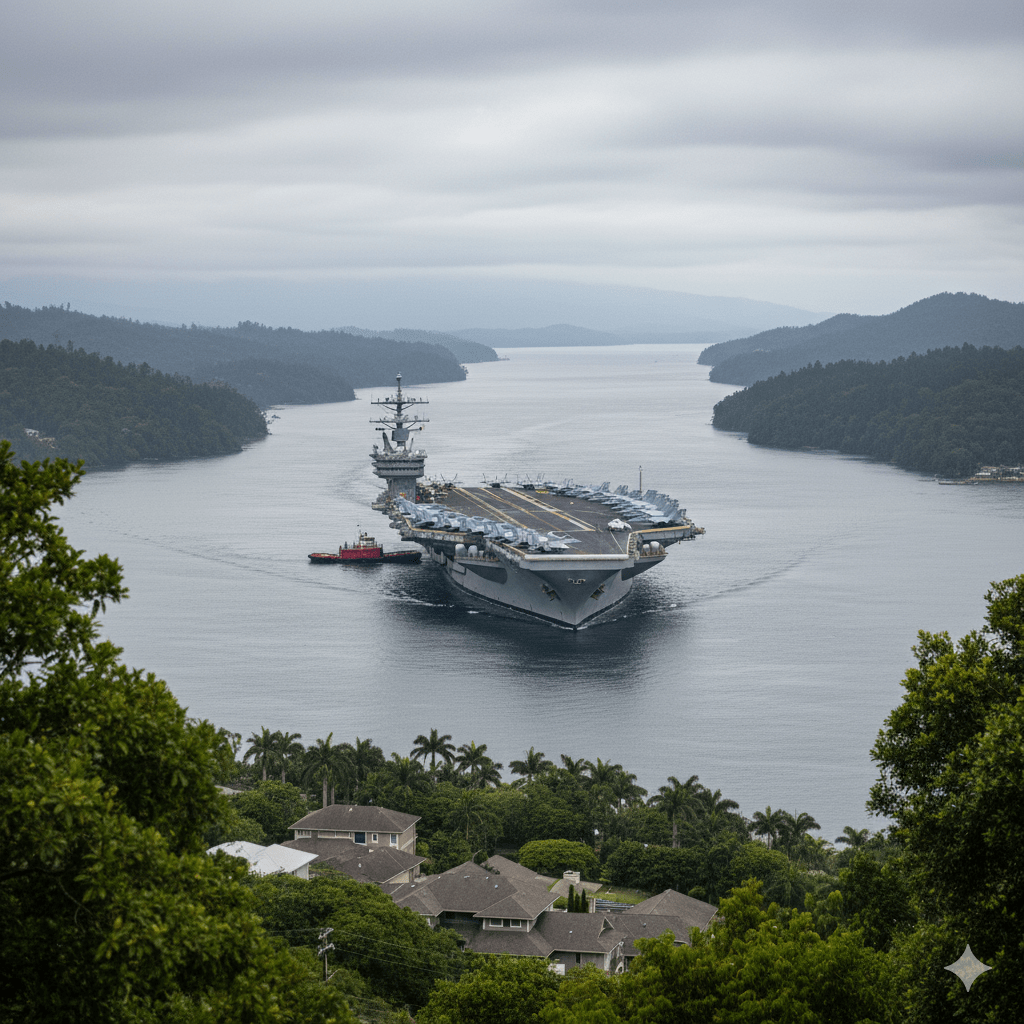Eine Politik, die als Schutzschild für die heimische Industrie angetreten war, erweist sich zunehmend als Bumerang. Die von Donald Trump entfesselte Zollspirale, gekrönt von einer Verdopplung der Abgaben auf Stahl und Aluminium, stürzt Unternehmen in ein beispielloses Chaos, vernichtet mehr Arbeitsplätze als sie schafft und erschüttert das Fundament der globalen Wirtschaftsordnung. Die aggressive „America First“-Doktrin, verkauft als Allheilmittel für die amerikanische Wirtschaft, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als ein selbstzerstörerisches Manöver, dessen tiefgreifende Widersprüche und unbeabsichtigte Konsequenzen die USA und ihre Partner teuer zu stehen kommen.
Die offizielle Rhetorik aus dem Weißen Haus klingt simpel und bestechend: Zölle von bis zu 50 Prozent auf Stahl und Aluminium sollen die nationale Sicherheit schützen, unfaire Handelspraktiken ausmerzen und die amerikanische Schwerindustrie wiederbeleben. Doch die Realität, die sich in den Fabrikhallen und Vorstandsetagen des Landes abspielt, erzählt eine völlig andere Geschichte. Anstatt eines schützenden Schildes erleben unzählige US-Unternehmen die Zölle als einen direkten Angriff auf ihr Geschäftsmodell. Die Politik, die angeblich amerikanische Arbeitsplätze sichern soll, treibt jene Firmen in die Enge, die für ihre Produktion auf importierte Metalle angewiesen sind – und das sind weit mehr, als die Administration wahrhaben will.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die große Illusion: Wie der Schutz der Industrie zum Bumerang wird
Der Kaskadeneffekt der Zölle durchzieht die gesamte amerikanische Wirtschaft und entlarvt die fundamentale Fehleinschätzung der Regierung. Stahl und Aluminium sind keine Nischenprodukte, sondern das Rückgrat unzähliger Industriezweige. Die Abgaben führen zu einer direkten und schmerzhaften Verteuerung von Vorprodukten, was die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Hersteller untergräbt. Die Folgen sind für alle spürbar. Die Automobilindustrie, die Stahl für rund 54 Prozent eines Fahrzeugs benötigt, rechnet mit Kostensteigerungen pro Neuwagen, die umgerechnet Tausende Dollar betragen könnten. Diese Kosten werden unweigerlich an die Konsumenten weitergereicht, was die Nachfrage dämpft und die gesamte Branche unter Druck setzt. Der CEO von Ford warnte bereits vor „Kosten und Chaos“, eine Prognose, die sich nun zu bewahrheiten scheint.
Doch es trifft nicht nur die Autogiganten. Quer durchs Land spüren Unternehmen die Last. Independent Can, ein 96 Jahre altes Familienunternehmen, das Blechdosen für Lebensmittel herstellt, sieht sich gezwungen, die erhöhten Kosten an seine Kunden – und damit an Millionen amerikanischer Familien – weiterzugeben. Nach Jahren vergeblicher Versuche, sich gegen übermächtige Konkurrenten auf dem heimischen Markt durchzusetzen und Zugang zu US-Stahl zu erhalten, ist das Unternehmen auf Importe angewiesen. Die Zölle zwingen die Firma nun, geplante Investitionen in alternde Maschinen aufzuschieben, was ihre langfristige Zukunftsfähigkeit gefährdet. Selbst Hersteller von Kochgeschirr aus Edelstahl finden schlicht keine brauchbaren US-Alternativen für ihre spezialisierten Metalle und stehen vor dem Aus. Die Politik trifft damit genau jene mittelständischen Produktionsbetriebe, die sie zu schützen vorgibt. Die Gleichung ist einfach und brutal: Was als Schutz für einige wenige Stahlproduzenten gedacht war, entwickelt sich zu einer flächendeckenden Belastung für die verarbeitende Industrie.
Das Gift der Ungewissheit: Amerikas Wirtschaft im Blindflug
Schlimmer noch als die direkten Kosten ist das Gift der Ungewissheit, das die erratische Handelspolitik in der Wirtschaft verbreitet. Unternehmer und Manager beschreiben ein Klima des Chaos, das jede langfristige Planung unmöglich macht. Die Regierung agiert in einer schwindelerregenden Geschwindigkeit, in der Zölle angekündigt, wieder zurückgenommen, Fristen gesetzt und verschoben werden. Diese „Zickzack-Politik“, wie sie der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) nennt, lähmt die Investitionstätigkeit. Unternehmen stellen Budgets auf den Prüfstand, stoppen Projekte und zögern bei Neueinstellungen, weil sie nicht wissen, wie ihre Kostenstruktur morgen aussehen wird. Rick Huether, der Chef von Independent Can, fasst die Verzweiflung vieler Unternehmer zusammen: „Wir leben und sterben von Stabilität und Vorhersehbarkeit, und im Moment haben wir keines von beidem“.
Die Unsicherheit zwingt Unternehmen, enorme Ressourcen für die reine Beobachtung und Reaktion auf politische Wendungen aufzuwenden, anstatt sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Einige Firmen richten regelrechte „Kriegsräume“ ein, um politische Manöver zu verfolgen und ihre Lieferketten kurzfristig umzuleiten. Ein Manager berichtet, dass er fast ein Drittel seiner Büroangestellten dafür einsetzen muss, die ständigen Politikänderungen zu bewältigen. Diese permanente Krisenreaktion bindet Kapital und Managementkapazitäten, die dringend für Innovation und Wachstum benötigt würden. Die konstanten Störfeuer aus Washington haben ein Geschäftsumfeld geschaffen, das einige Wirtschaftsführer in seiner Chaotik mit der frühen Phase der Corona-Pandemie vergleichen. Das Versprechen von Stärke und Stabilität verkehrt sich in sein exaktes Gegenteil: eine hausgemachte, lähmende Instabilität.
Der Arbeitsplatz-Mythos: Warum die Zoll-Rechnung nicht aufgeht
Das zentrale Versprechen der Zollpolitik – die Schaffung von gut bezahlten amerikanischen Arbeitsplätzen – erweist sich bei näherer Betrachtung als gefährlicher Mythos. Zwar deuten einige Studien darauf hin, dass durch frühere Zollrunden einige wenige Arbeitsplätze in der Stahlproduktion geschaffen wurden, etwa 1.000 Stellen. Doch diesem marginalen Gewinn steht ein Vielfaches an Verlusten in anderen Bereichen gegenüber. Dieselben Studien schätzen, dass die Zölle von 2018 zu einem Verlust von 75.000 Arbeitsplätzen im Rest der US-Fertigungsindustrie führten. Historische Vergleiche sind noch dramatischer: Die Stahlzölle der Bush-Regierung im Jahr 2002 kosteten die amerikanische Wirtschaft rund 200.000 Arbeitsplätze – mehr, als die gesamte US-Stahlindustrie zu diesem Zeitpunkt beschäftigte. Die Zölle sind damit kein Jobmotor, sondern eine Jobvernichtungsmaschine.
Die Idee, man könne durch Strafzölle im großen Stil die Produktion nach Amerika zurückholen („Reshoring“), scheitert zudem an fundamentalen strukturellen Hürden. Die USA verfügen in vielen Branchen schlicht nicht mehr über das notwendige industrielle Ökosystem. Ein anschauliches Beispiel liefert die Textilindustrie: Das Unternehmen Saitex kann zwar Jeans in Los Angeles nähen, ist aber auf ein riesiges Schwesterwerk in Vietnam angewiesen, das Stoffe, Knöpfe und Reißverschlüsse liefert, weil es in den USA keine entsprechenden Zulieferer in der benötigten Größenordnung mehr gibt. Hinzu kommt ein massiver Arbeitskräftemangel. Schon jetzt sind rund 500.000 Stellen in amerikanischen Fabriken unbesetzt. Ökonomen haben errechnet, dass für eine Rückkehr zum Beschäftigungsniveau der 1970er Jahre 22 Millionen neue Fabrikarbeiter benötigt würden – eine utopische Zahl angesichts von nur 7,2 Millionen Arbeitslosen. Das Problem wird durch eine restriktive Einwanderungspolitik noch verschärft, da viele der anstrengenden und geringer bezahlten Tätigkeiten in der Vergangenheit von Immigranten ausgeübt wurden. Letztlich scheitert die Vision auch an der harten Realität der Kosten: Ein Näher in Los Angeles kostet rund 4.000 Dollar im Monat, sein Pendant in Vietnam nur 500 Dollar. Die romantische Vorstellung von der Rückkehr der Fabriken kollidiert mit der unerbittlichen Logistik und Ökonomie einer globalisierten Welt.
Globales Chaos: Wie Trump das Fundament der Weltordnung erschüttert
Die Auswirkungen der Zollpolitik beschränken sich nicht auf die USA. Sie senden Schockwellen durch die ganze Welt und treffen Freund wie Feind gleichermaßen. Engste Verbündete wie die EU, Kanada und Mexiko werden genauso mit Strafzöllen überzogen wie der strategische Rivale China. Dies untergräbt nicht nur jahrzehntelang gewachsene Wirtschaftsbeziehungen, sondern zerstört auch das Vertrauen, das die Grundlage für internationale Kooperation bildet. Die Reaktionen der Partner fallen dabei unterschiedlich aus. Die Europäische Union kritisierte die Verdopplung der Zölle scharf, insbesondere da sie inmitten laufender Verhandlungen erfolgte, und droht mit gezielten Gegenmaßnahmen auf symbolträchtige US-Produkte wie Jeans, Whiskey oder Motorräder. Gleichzeitig halten die EU-Unterhändler die Tür für eine diplomatische Lösung offen und zeigen sich optimistisch, eine Einigung erzielen zu können.
Für direkte Nachbarn wie Kanada und Mexiko ist die Lage weitaus existenzbedrohender. Als wichtigste Stahllieferanten der USA sehen sie ihre heimische Industrie unmittelbar gefährdet. Die kanadische Stahlproduzentenvereinigung erklärte, die Zölle würden den US-Markt für sie „im Wesentlichen schließen“. Entsprechend schärfer fällt die Rhetorik aus. Mexiko nannte die Zölle ungerecht und drohte mit eigenen Maßnahmen zum Schutz der heimischen Wirtschaft, während in Kanada Rufe nach sofortiger Vergeltung laut wurden.
Über die direkten Handelskonflikte hinaus stellt die US-Politik eine systemische Gefahr für die gesamte regelbasierte Weltordnung dar. Indem die Trump-Administration internationale Vereinbarungen und die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) missachtet oder untergräbt, schafft sie einen Zustand der Anarchie. Dies ermutigt andere Länder, ebenfalls Alleingänge zu verfolgen, was den globalen Handel weiter fragmentieren und zu einem „Auge um Auge“-Protektionismus führen könnte. Kommentatoren warnen, dass diese Entwicklung die Welt ärmer und gefährlicher macht, da stabile Wirtschaftsbeziehungen auch eine stabilisierende Wirkung auf die internationale Politik haben. Selbst im Inland steht die Politik auf wackligen Füßen. Gerichte haben die Rechtmäßigkeit der Zölle in Frage gestellt und die Exekutive des Machtmissbrauchs bezichtigt, auch wenn der Rechtsstreit durch die Instanzen noch andauert.
Der Versuch, die Zölle als multifunktionales Werkzeug für widersprüchliche Ziele einzusetzen, offenbart die innere Zerrissenheit der Strategie. Einerseits werden die Abgaben als Druckmittel in Verhandlungen präsentiert, das jederzeit wieder vom Tisch genommen werden kann, um bessere Deals zu erzielen. Andererseits preist die Administration die Zölle als verlässliche Einnahmequelle, die sogar dazu dienen könnte, massive Steuersenkungen zu finanzieren oder gar die Einkommenssteuer zu ersetzen. Wie Analysten treffend bemerken, kann man den Kuchen nicht gleichzeitig essen und behalten. Ein als Verhandlungsmasse konzipierter Zoll ist per Definition eine unsichere und temporäre Einnahmequelle.
Die Leidtragenden dieser widersprüchlichen und letztlich destruktiven Politik sind am Ende die amerikanischen Bürger. Die Zölle wirken wie eine regressive Steuer: Sie treffen einkommensschwächere Haushalte am härtesten, da diese einen größeren Teil ihres Budgets für Konsumgüter aufwenden müssen, die sich nun verteuern. Eine Studie der Yale University schätzt die Mehrkosten für einen typischen US-Haushalt auf 3.800 Dollar pro Jahr. Diese Belastung wird noch verschärft, wenn die Zolleinnahmen, wie geplant, zur Finanzierung von Steuersenkungen verwendet werden, die überproportional den Reichsten zugutekommen. Das Ergebnis ist eine Umverteilung von unten nach oben, die das genaue Gegenteil dessen bewirkt, was Trump seinen Wählern versprochen hat. Die Bilanz seiner Politik, so fasst es ein Kommentator resigniert zusammen, ist nicht amerikanische Unabhängigkeit, sondern schlicht „weniger Freiheit und weniger Wohlstand“.