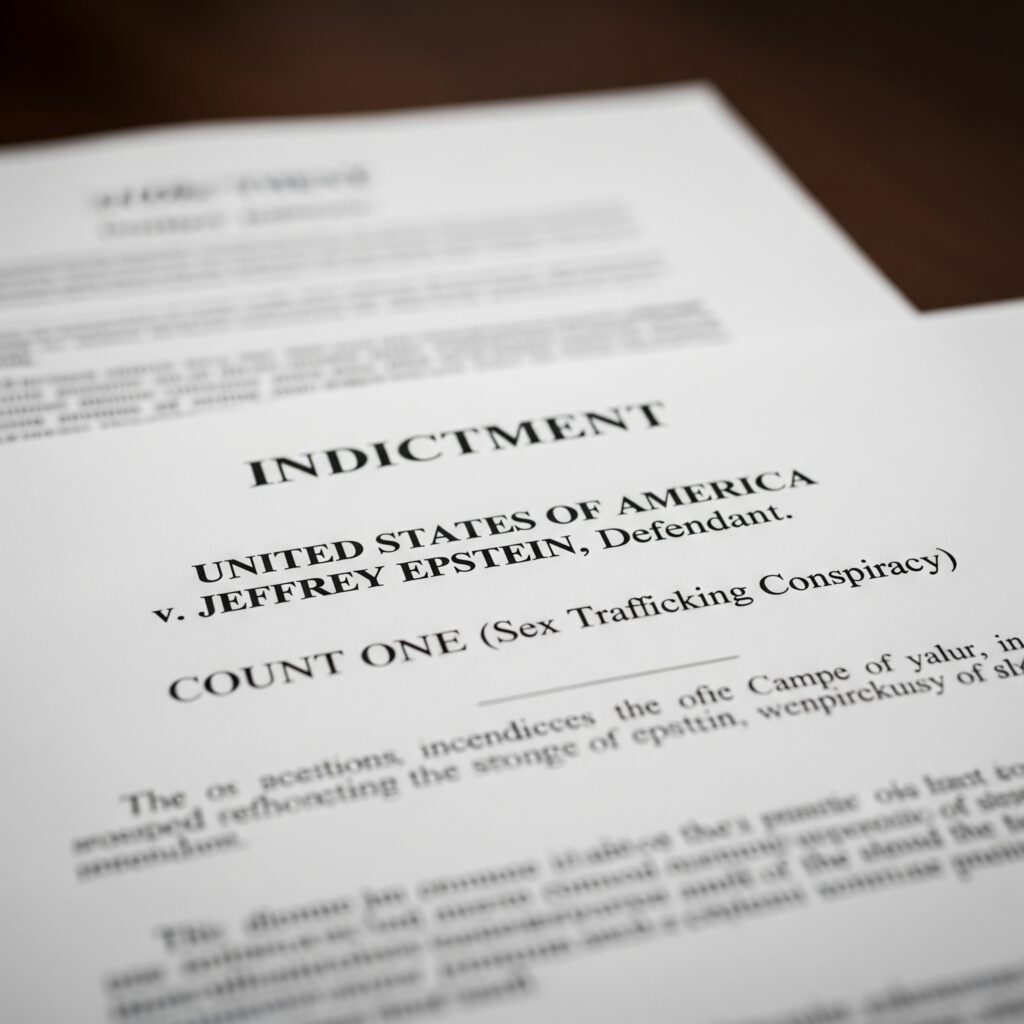In den Straßen von Los Angeles prallen zwei unversöhnliche Realitäten aufeinander. Auf der einen Seite stehen die Bilder von brennenden Autos, gewaltsamen Zusammenstößen und einer Bundesregierung, die von einem Aufstand gegen die Staatsgewalt spricht. Auf der anderen Seite steht die scharfe Verurteilung durch kalifornische Politiker, die in der Entsendung von 2.000 Nationalgardisten einen gezielten Akt der Provokation und die künstliche Fabrikation einer Krise sehen. Die Ankunft der ersten uniformierten Truppen am Sonntagmorgen, angeordnet von Präsident Donald Trump gegen den ausdrücklichen Willen von Gouverneur Gavin Newsom, markiert eine neue, gefährliche Stufe im Dauerkonflikt zwischen dem Weißen Haus und dem demokratisch regierten Kalifornien.
Doch die Ereignisse der letzten 24 Stunden sind weit mehr als nur ein Streit über Zuständigkeiten. Sie sind eine Fallstudie über die Dehnbarkeit der Verfassung, die politische Instrumentalisierung des Militärs und eine mögliche Vorschau auf künftige Konflikte. Die Konfrontation in Los Angeles, ausgelöst durch Proteste gegen verschärfte Einwanderungsrazzien der ICE-Behörde, entwickelt sich zu einem Kampf um die Deutungshoheit, die Rechtsstaatlichkeit und die zukünftige Machtverteilung in den Vereinigten Staaten. Es ist, so legen es die Analysen nahe, eine von Trump bewusst inszenierte Eskalation – und möglicherweise eine Generalprobe für den Ernstfall.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Der Funke: Proteste, Gewalt und zwei widersprüchliche Narrative
Am Anfang der Eskalation standen landesweite Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, die Teil der von Präsident Trump seit seinem Amtsantritt im Januar angeordneten, verschärften Migrationspolitik sind. In der Metropolregion Los Angeles, einem Schmelztiegel der Kulturen und Heimat unzähliger Einwandererfamilien, führten diese Aktionen am Freitag und Samstag zu spontanen Protesten. Hunderte Menschen gingen auf die Straße, um sich den Aktionen der Bundesbeamten entgegenzustellen, die sie als grausam und unmoralisch empfinden.
Über den genauen Charakter dieser Demonstrationen gehen die Darstellungen jedoch diametral auseinander und offenbaren die tiefe Kluft zwischen den Wahrnehmungen. Offizielle Stellen der Trump-Administration und konservative Medien zeichnen das Bild eines gewalttätigen Mobs. Berichte sprechen von rund 1.000 Demonstranten, die ICE-Beamte angegriffen hätten, von Stein- und Feuerwerkskörperwürfen, brennenden Autos und der Zerstörung von steuerfinanziertem Eigentum. Das Heimatschutzministerium sprach von einer „massiven Eskalation“, ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses gar von einem „Aufstand“.
Ganz anders klingt die Version der lokalen und staatlichen Behörden. Gouverneur Newsom, Bürgermeisterin Karen Bass und die lokale Polizei betonten wiederholt, die Situation sei weitgehend unter Kontrolle gewesen. Zwar habe es vereinzelte Zwischenfälle gegeben, doch die Proteste in der Innenstadt von Los Angeles seien überwiegend „friedlich“ verlaufen. Die örtlichen Sicherheitskräfte hätten keinen Bedarf für zusätzliche Hilfe angemeldet. Diese Darstellung wird von demokratischen Politikern gestützt, die der Bundesregierung vorwerfen, bewusst ein Bild des Chaos zu malen, um ein militärisches Eingreifen zu rechtfertigen.
Die Eskalation des Weißen Hauses: Zwischen Machtdemonstration und rechtlicher Grauzone
Die offizielle Begründung des Weißen Hauses für die Entsendung der Nationalgarde ist unmissverständlich: Es gehe darum, der „Gesetzlosigkeit“ ein Ende zu bereiten, Bundesbeamte bei der Durchsetzung von Bundesgesetzen zu schützen und die Ordnung wiederherzustellen. In einer offiziellen Bekanntmachung wurde der Einsatz auf 60 Tage angesetzt und sogar die Option offen gelassen, reguläre Einheiten des US-Militärs zu mobilisieren. Verteidigungsminister Pete Hegseth goss zusätzlich Öl ins Feuer, als er über seinen persönlichen Social-Media-Account drohte, auch die Marines vom nahegelegenen Stützpunkt Camp Pendleton seien in „hoher Alarmbereitschaft“ und könnten mobilisiert werden, sollte die Gewalt anhalten.
Diese Drohung und die erfolgte Aktivierung der Nationalgarde bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone und stellen laut Experten einen „beispiellosen und ungetesteten“ Vorgang dar. Normalerweise untersteht die Nationalgarde dem Befehl des jeweiligen Gouverneurs. Trump umging diese Befehlskette, indem er sich auf eine Sektion des „Armed Forces Act“ (Title 10 des U.S. Code) berief, die es dem Präsidenten erlaubt, die Nationalgarde in Bundesdienst zu stellen, um eine „Rebellion“ oder einen „Aufstand“ niederzuschlagen. Trump behauptete in seiner Anordnung, die „Unruhen“ in Südkalifornien entsprächen der Definition einer Rebellion.
Juristen weisen jedoch auf einen entscheidenden Unterschied hin: Frühere Präsidenten haben diese Autorität typischerweise in Verbindung mit dem „Insurrection Act“ von 1807 genutzt. Dieses Gesetz würde dem Militär weitreichende polizeiliche Befugnisse verleihen, etwa Verhaftungen durchzuführen, was normalerweise durch den „Posse Comitatus Act“ von 1878 verboten ist. Indem Trump den Insurrection Act nicht explizit bemüht, versucht er laut der Rechtsexpertin Elizabeth Goitein, die Machtbefugnisse dieses Gesetzes zu nutzen, ohne es formell zu aktivieren – ein „neues Terrain“. Die Konsequenz ist, dass die föderalisierten Nationalgardisten aktuell nur begrenzte Befugnisse haben, etwa den Schutz von Bundeseigentum, aber keine eigenen Razzien oder Verhaftungen durchführen dürfen. Die Gefahr einer schnellen und „tödlichen und verfassungsrechtlichen“ Eskalation bleibt jedoch bestehen, sollte Trump sich entscheiden, den Insurrection Act doch noch zu aktivieren.
Kaliforniens Widerstand: Gouverneur Newsom im Kampf gegen das „inszenierte Spektakel“
Die Reaktion aus Kalifornien fiel erwartungsgemäß heftig aus. Gouverneur Gavin Newsom, einer der profiliertesten demokratischen Gegenspieler Trumps, bezeichnete das Vorgehen als „geistesgestörtes Verhalten“ und warf dem Präsidenten vor, gezielt ein „Spektakel“ zu inszenieren und eine Krise zu „fabrizieren“. Er und andere führende Demokraten wie Senator Adam Schiff nannten den Einsatz „beispiellos“ und „bewusst darauf ausgelegt, Spannungen zu schüren, Chaos zu säen und die Situation zu eskalieren“.
Newsoms Strategie ist dabei ein Drahtseilakt. Einerseits verurteilt er die Handlungen des Präsidenten mit schärfsten Worten und verteidigt die Souveränität seines Bundesstaates. Andererseits appelliert er unentwegt an die Demonstranten, friedlich zu bleiben und der Regierung keinen Vorwand für ein noch härteres Durchgreifen zu liefern. „Gebt ihnen nicht, was sie wollen“, schrieb er auf der Plattform X und bezog sich auf das von Trump gewünschte Bild des Chaos.
Dieser Konflikt steht sinnbildlich für die tiefen Gräben zwischen der Bundesregierung und den sogenannten „Sanctuary Cities“ wie Los Angeles, die sich einer Kooperation bei Massenabschiebungen verweigern. Die demografische Realität Kaliforniens, mit einem hohen Anteil an Einwanderern und einer breiten öffentlichen Unterstützung für Programme wie DACA, steht im krassen Gegensatz zu Trumps Rhetorik und Politik. Die Drohungen aus dem Umfeld des Weißen Hauses, Newsom und Bürgermeisterin Bass könnten wegen Behinderung von Bundesbeamten verhaftet werden, sowie die tatsächliche Festnahme eines prominenten Gewerkschaftsführers während der Proteste, werden als gezielte Einschüchterungsversuche gegen politische Gegner gewertet.
Die politische Strategie: Los Angeles als „Generalprobe“ für 2026?
Analysten wie David Frum von The Atlantic interpretieren die Ereignisse in Los Angeles nicht als isolierten Vorfall, sondern als eine „Generalprobe“ für eine weitaus größere politische Agenda. Seiner Analyse zufolge verfolgt Trump eine klare dreistufige Strategie, die vor den Zwischenwahlen 2026 zur Anwendung kommen könnte:
- Provozieren einer Störung: Durch aggressive Bundesaktionen in demokratisch regierten Staaten wird gezielt Unruhe provoziert.
- Ausrufen des Notstands: Die selbst geschaffene Störung dient als Vorwand, um einen Notstand auszurufen und Bundestruppen zu entsenden.
- Übernahme der Kontrolle: Unter dem Deckmantel der Wiederherstellung der Ordnung könnte die Bundesregierung die Kontrolle über lokale Regierungsfunktionen, wie die Polizeigewalt oder sogar den Wahlprozess, an sich reißen.
Dieses Szenario, so Frum, könnte dazu dienen, Wahlen in „blauen Staaten“ zu beeinflussen oder gar auszusetzen. Was diesen Ansatz heute gefährlicher mache als in Trumps erster Amtszeit, sei das Personal. Während sich 2020 noch Verteidigungsminister Mark Esper und General Mark Milley gegen den Einsatz des Militärs gegen „Black Lives Matter“-Demonstranten stellten, sei die heutige Administration mit loyalen Figuren wie Pete Hegseth besetzt, die weniger Widerstand leisten würden.
Ein historischer Tabubruch und düstere Vorzeichen
Der aktuelle Konflikt bricht mit historischen Mustern. Als 1992 nach dem Freispruch der Polizisten im Fall Rodney King in Los Angeles schwere Unruhen ausbrachen, wurden zwar ebenfalls Marines und die Nationalgarde eingesetzt – allerdings auf explizite Anforderung des damaligen kalifornischen Gouverneurs. Und als Präsident Lyndon B. Johnson 1965 die Nationalgarde nach Alabama schickte, geschah dies, um die Bürgerrechtsdemonstranten vor der Gewalt lokaler Behörden zu schützen, nicht um sie niederzuschlagen. Die jetzige Konfrontation zwischen Bundesregierung und Bundesstaat ist in dieser Form ein Novum.
Die Drohung, aktive Kampftruppen wie die Marines im Inland gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen, wäre ein noch größerer Tabubruch und wird von Kommentatoren als „gruselig“ und zutiefst beunruhigend beschrieben. Sie symbolisiert ein „Worst-Case-Szenario“, in dem die Grenzen zwischen ziviler Strafverfolgung und militärischer Intervention weiter verschwimmen und die Gefahr einer unkontrollierbaren Eskalation mit potenziell tödlichen Folgen real wird.
Die Ereignisse von Los Angeles sind somit mehr als nur eine tagesaktuelle Nachricht. Sie sind ein Stresstest für die amerikanische Demokratie. Die Bilder der Nationalgarde vor den Wolkenkratzern der Westküstenmetropole werfen eine fundamentale Frage auf: Wo endet die legitime Durchsetzung von Bundesrecht und wo beginnt der Missbrauch von Macht zur politischen Unterdrückung? Die Antwort, die in den kommenden Tagen und Wochen in Kalifornien gegeben wird, könnte die Zukunft der gesamten Nation prägen.