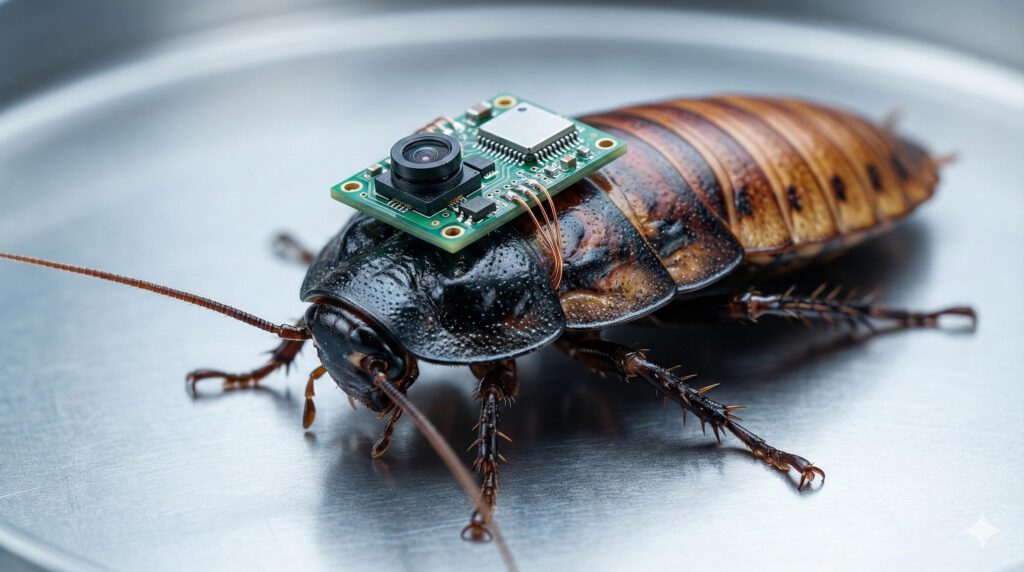Die vergangene Woche hat die Vereinigten Staaten in einen Strudel politischer Eskalationen gerissen, der die Grundfesten der amerikanischen Demokratie erschüttert. Angefacht von einem Präsidenten, der scheinbar entschlossen ist, alle institutionellen und politischen Fesseln abzuwerfen, entfaltete sich ein beispielloses Drama auf mehreren Bühnen gleichzeitig. Die Trump-Administration zog in einen offenen Krieg gegen den Bundesstaat Kalifornien, eine Auseinandersetzung von verfassungsrechtlicher Tragweite. Parallel dazu implodierte die einst gefeierte Allianz zwischen Donald Trump und dem Tech-Visionär Elon Musk in einem öffentlichen Spektakel, das weit mehr als nur persönliche Eitelkeiten offenbarte und die nationale Sicherheit der USA in Frage stellte. Gleichzeitig wurde deutlich, wie systematisch die Regierung versucht, die Justiz und unabhängige Kontrollinstanzen zu Werkzeugen ihrer Macht umzufunktionieren – sei es in der Einwanderungspolitik, bei der Verfolgung politischer Gegner oder im Kampf gegen unliebsame Haushaltswächter. Dieser Wochenrückblick, basierend auf den Analysen unserer Redaktion, zeichnet das Bild einer Nation am Rande des Nervenzusammenbruchs, angetrieben von einem Präsidenten, der keine Feinde außer den eigenen zu kennen scheint.
Kalifornien im Visier: Ein Staat wird zum Staatsfeind
Der schwelende Konflikt zwischen der Trump-Administration und dem demokratisch regierten Kalifornien hat eine neue, gefährliche Dimension erreicht. Im Zentrum der Eskalation steht das kalifornische Hochgeschwindigkeits-Bahnprojekt, ein seit Jahren von Kostenexplosionen und Verzögerungen geplagtes Infrastrukturvorhaben. Einst als Symbol für eine fortschrittliche und umweltfreundliche Zukunft gefeiert, ist der Zug zum Inbegriff politischer Dysfunktionalität geworden. Die Kosten sind von ursprünglich 33 Milliarden auf bis zu 128 Milliarden Dollar explodiert, das erste Teilstück soll frühestens 2033 fertig sein.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Für Donald Trump und die Republikaner ist dieses Debakel ein gefundenes Fressen. Doch statt politischer Sticheleien wählte die Administration die offene Konfrontation. In einer als Kriegserklärung zu wertenden Ankündigung drohte die Trump-Regierung damit, dem Projekt vier Milliarden Dollar an Bundesmitteln zu entziehen. Ein kritischer Bericht der Federal Railroad Administration (FRA), der dem Projekt Fristversäumnisse und unrealistische Passagierprognosen attestiert, lieferte die scheinbar formale Grundlage für diesen Schritt. Doch die politische Motivation dahinter ist unübersehbar: Es geht darum, das Prestigeprojekt des demokratischen Gouverneurs Gavin Newsom zu torpedieren und einen politischen Gegner zu bestrafen. Newsom konterte scharf und bezeichnete Trump als den „König der Schulden“ („King of Debt“).
Die Auseinandersetzung spitzte sich am Wochenende dramatisch zu, als Trump eine weitere, noch nie dagewesene Eskalationsstufe zündete: In „Operation Eskalation“ ordnete das Weiße Haus die Föderalisierung von 2.000 Soldaten der kalifornischen Nationalgarde an, um aggressive Razzien der Einwanderungsbehörde ICE in Los Angeles durchzusetzen – gegen den erklärten Willen des Gouverneurs. Dieser präsidiale Alleingang, rechtlich auf eine umstrittene Klausel im US-Gesetzbuch gestützt (Titel 10, Paragraf 12406), die einen Einsatz bei einer „Rebellion“ erlaubt, umgeht bewusst den etablierten Prozess, wonach der Gouverneur die Garde anfordert. Juristische Experten wie Erwin Chemerinsky von der UC Berkeley bezeichneten den Vorgang als „wahrhaft erschreckend“ und als Versuch, das Militär zur Unterdrückung von Dissens zu missbrauchen. Der Schritt weckt düstere historische Erinnerungen an den Einsatz der Nationalgarde während der Bürgerrechtsbewegung 1965, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied: Damals ging es um den Schutz von Bürgerrechten, heute geht es um die Durchsetzung einer umstrittenen Einwanderungspolitik gegen den Widerstand lokaler Behörden. Die chaotischen Szenen in Los Angeles, mit brennenden Autowracks und einem Kampf der Narrative zwischen Bundes- und Lokalbehörden, sind die sichtbare Manifestation eines von der Trump-Administration gesuchten fundamentalen Konflikts mit den sogenannten „Sanctuary States“. Der unfertige Zug im Central Valley ist so zu einem mächtigen Symbol für ein zerrissenes Land geworden.
Kollision der Titanen: Der Privatkrieg zwischen Trump und Musk erschüttert Washington
Nicht weniger dramatisch verlief die öffentliche Implosion der Allianz zwischen Donald Trump und Elon Musk. Was als Zweckgemeinschaft zwischen dem politischen Disruptor und dem Tech-Visionär begann, endete in einer Schlammschlacht, die das politische Washington erschütterte und ein erhebliches nationales Sicherheitsrisiko offenbarte. Der Bruch, der sich seit Tagen anbahnte, wurde unumkehrbar, als Musk Trumps innenpolitisches Prestigeprojekt, den „One Big, Beautiful Bill Act“, auf seiner Plattform X als „widerliche Abscheulichkeit“ und „massive, ungeheuerliche und mit Schweinefleisch gefüllte Ausgabe“ bezeichnete.
Musks fundamentale Kritik, untermauert von der Warnung vor einer explodierenden Staatsverschuldung, traf das republikanische Establishment ins Mark. Während fiskalkonservative Hardliner wie Thomas Massie den Bruch feierten, sahen sich die republikanischen Führer plötzlich mit einer innerparteilichen Opposition konfrontiert, angeführt von einem ihrer prominentesten Verbündeten. Die Motive Musks sind vielschichtig. Neben der Sorge um das Haushaltsdefizit spielen auch handfeste unternehmerische Interessen eine Rolle, da das Gesetzespaket die Streichung von Subventionen für Elektrofahrzeuge vorsah, von denen sein Unternehmen Tesla massiv profitiert hätte.
Trumps Reaktion war ein Meisterstück politischer Ambivalenz. Öffentlich drohte er damit, die milliardenschweren Regierungsaufträge für Musks Firmen, insbesondere SpaceX, zu kündigen – eine existenzielle Warnung für den Tech-Mogul. Gleichzeitig wies er hinter den Kulissen seinen Vizepräsidenten an, einen diplomatischen Ton anzuschlagen, um die Brücke zu seinem einstigen Top-Spender nicht vollständig einzureißen. Diese Doppelstrategie offenbarte, dass Trump Musk zwar als Bedrohung für seine Autorität sah, dessen potenziellen Wert als politischer Akteur aber anerkannte.
Die Brisanz dieses Konflikts wird durch die fast totale Abhängigkeit der USA von SpaceX im Bereich der bemannten Raumfahrt potenziert. Ein abrupter Stopp der Kooperation würde die NASA ihrer einzigen souveränen Möglichkeit berauben, amerikanische Astronauten zur Internationalen Raumstation zu bringen. Die USA wären praktisch handlungsunfähig. Auch das ambitionierte Artemis-Mondprogramm würde ohne SpaceX zerfallen. Zusätzliche Nahrung erhält die Besorgnis durch Berichte über Musks intensiven Drogenkonsum, darunter Ketamin, Ecstasy und Adderall, sowie sein zunehmend erratisches Verhalten. Die Vorstellung, dass eine Person mit potenziell drogenbedingt eingeschränkter Urteilsfähigkeit Zugang zu Staatsgeheimnissen hat und für systemrelevante nationale Sicherheitsprojekte verantwortlich ist, stellt ein inakzeptables Risiko dar. Die Affäre wirft die beunruhigende Frage auf, ob für Musk eine „Elon-Ausnahme“ gilt, bei der die Regierung aus Furcht, einen innovativen Schlüsselpartner zu verprellen, beide Augen zudrückt und damit fundamentale Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit untergräbt.
Justiz als Waffe: Der schleichende Angriff auf den Rechtsstaat
Die vergangene Woche hat auch die systematische Instrumentalisierung der Justiz für politische Zwecke durch die Trump-Administration offengelegt. Der Fall des Salvadorianers Kilmar Abrego Garcia dient hier als Lehrstück. Garcia wurde von der US-Regierung erst widerrechtlich außer Landes geschafft und dann, unter dem Druck der Gerichte, zurückgeholt, um ihn als Schwerverbrecher anzuklagen. Seine ursprüngliche Deportation im März 2025 geschah trotz einer richterlichen Anordnung von 2019, die dies untersagte, da sein Leben in El Salvador in Gefahr sei. Nachdem Gerichte seine Rückkehr anordneten, weigerte sich die Administration wochenlang. Erst als der juristische Druck wuchs, vollzog die Regierung eine Wende: Sie präsentierte eine Grand-Jury-Anklage aus Tennessee wegen Menschenschmuggels, um Garcia nun als Angeklagten zurückzuholen. Dieser strategische Schachzug erlaubte es der Regierung, einer Konfrontation mit der Judikative zu entgehen und gleichzeitig ihr hartes „Law-and-Order“-Image zu wahren. Die Justiz wurde so von einem Hindernis zu einem Instrument der Exekutive umfunktioniert.
Dieses Muster, den Rechtsstaat zu untergraben, zeigt sich auch in der neuen, verschärften Einwanderungspolitik, die als „Trumps eiserne Faust“ beschrieben wird. Die Administration reaktivierte den „Alien Enemies Act“ von 1798, ein Gesetz aus der Zeit der Revolutionsängste, um im März fast 140 Venezolaner ohne Anhörung nach El Salvador zu deportieren. Ein Bundesrichter verurteilte diesen Vorgang scharf und sprach von einem vollständigen Entzug des Rechts auf ein faires Verfahren .Parallel dazu hat die Einwanderungsbehörde ICE ihre Abschiebungen drastisch erhöht, mit einem Rekord von 190 internationalen Flügen im Mai 2025.
Auch die jüngsten Einreiseverbote der Trump-Administration folgen diesem Muster. Bürger aus zwölf Ländern unterliegen einem vollständigen Einreiseverbot, sieben weitere Nationen sind von massiven Beschränkungen betroffen. Die offiziellen Begründungen wie nationale Sicherheit klingen vertraut, doch Kritiker sprechen von „politischem Theater“ und einer Neuauflage des „Muslim Ban“. Die Inkonsistenz der Liste – so ist der mutmaßliche Attentäter von Boulder Ägypter, aber Ägypten steht nicht auf der Liste – nährt den Verdacht, dass politische Erwägungen und Vorurteile die Auswahl der Länder bestimmen. Die zynische Instrumentalisierung des Boulder-Vorfalls zur Rechtfertigung der bereits vorbereiteten Politik wurde als „Opportunismus“ kritisiert.
Selbst ein einstimmiges Urteil des Supreme Court wurde in dieser Woche zum Sinnbild der politischen Polarisierung. Im Fall Marlean Ames entschied der Gerichtshof mit 9:0, dass für alle Menschen die gleichen Hürden beim Nachweis von Diskriminierung am Arbeitsplatz gelten müssen, unabhängig davon, ob sie einer Mehrheits- oder Minderheitengruppe angehören. Oberflächlich ein Sieg für die formale Gleichheit, sehen Rechtsexperten darin einen logischen Folgeschritt des Urteils von 2023 zu „race-conscious admissions“. Die Sorge ist, dass das Urteil nun als Waffe in einem breiteren Kampf gegen Diversitätsbemühungen genutzt und der Abbau von Schutz- und Förderprogrammen für Minderheiten legitimiert wird. So wird selbst ein Urteil, das Gleichheit schaffen soll, zu einem potenziellen Brandbeschleuniger im Kulturkampf um Diversität.
Der Zorn der Zahlen: Trumps Krieg gegen die Fakten und die sozialen Folgen
Die Auseinandersetzung um den Bundeshaushalt eskalierte in der vergangenen Woche zu einem regelrechten Krieg gegen Fakten und unabhängige Experten. Im Zentrum der Angriffe stand das überparteiliche Congressional Budget Office (CBO). Führende Republikaner säten bereits vor der Veröffentlichung der Analyse des republikanischen Gesetzespakets Zweifel an dessen Genauigkeit. Die Strategie ist durchsichtig: die Diskreditierung des Schiedsrichters, dessen Zahlen nicht gefallen. Das CBO und andere renommierte Institute wie das Budget Lab der Yale University und das Penn Wharton Budget Model zeichnen ein einheitliches Bild: Das republikanische Gesetzespaket, das massive Steuersenkungen vorsieht, würde die Staatsverschuldung in den nächsten zehn Jahren um 2,4 bis 2,8 Billionen Dollar erhöhen. Die erhofften positiven Effekte auf das Wirtschaftswachstum würden die Kosten bei weitem nicht kompensieren.
Die Angriffe auf das CBO sind mehr als nur politisches Geplänkel; sie sägen am Fundament einer evidenzbasierten Politikgestaltung. Dieser Feldzug gegen die „unbestechlichen Rechner der Nation“ könnte nicht nur die Staatsfinanzen nachhaltig schädigen, sondern auch das Vertrauen in demokratische Prozesse untergraben. Der Vorstoß wird begleitet von konkreten Kürzungsplänen, wie sie im Artikel „Trumps Spar-Attacke“ beschrieben werden. Die Regierung fordert die Rücknahme von bereits bewilligten Mitteln in Höhe von neun Milliarden Dollar, betroffen sind vor allem Programme der Auslandshilfe und der öffentlich-rechtliche Rundfunk (NPR und PBS). Während die fiskalische Wirkung dieser Kürzungen marginal ist – sie stehen einem prognostizierten Defizit von zwei Billionen Dollar gegenüber – ist ihr symbolischer und ideologischer Gehalt enorm. Es ist der Versuch, unter dem Deckmantel der Sparsamkeit eine politische Agenda voranzutreiben und unliebsame Institutionen und Programme zu demontieren.
Die sozialen Konsequenzen dieser Politik sind gravierend. Die geplanten Ausgabenkürzungen im großen Gesetzespaket treffen vor allem soziale Sicherungssysteme. Das CBO rechnet damit, dass durch Einschnitte bei Medicaid und dem Affordable Care Act über zehn Millionen Amerikaner ihre Krankenversicherung verlieren könnten. Der Vorfall um Senatorin Joni Ernst, die auf die Sorge vor Todesfällen durch Medicaid-Kürzungen lapidar mit „Nun, wir alle werden sterben“ antwortete, entlarvte die Kaltschnäuzigkeit, mit der diese Debatte geführt wird. Dieser Vorfall ist symptomatisch für einen Politikstil, der Hohn über Empathie stellt und die menschlichen Kosten abstrakter politischer Entscheidungen ignoriert. Dies geschieht in einer Zeit, in der immer mehr Amerikaner unter finanzieller Prekarität leiden. Die alarmierende Zunahme der Nutzung von „Buy Now, Pay Later“-Diensten selbst für Lebensmittel ist ein Seismograph für die wachsende ökonomische Unsicherheit in weiten Teilen der Bevölkerung – genau jener Bevölkerung, die von den Kürzungen im sozialen Netz am härtesten getroffen würde.
Amerikas neue Fronten: Zwischen Wellness-Kult und System-Kollaps
Jenseits der großen politischen Arenen in Washington tun sich neue gesellschaftliche Verwerfungen auf. Die „Make America Healthy Again“ (MAHA)-Bewegung, angeführt von Figuren wie Robert F. Kennedy Jr. und Casey Means, ist mehr als nur ein kurzlebiger Wellness-Trend. Sie ist Ausdruck eines tiefen gesellschaftlichen Misstrauens gegenüber etablierten Institutionen wie der Pharmaindustrie, Gesundheitsbehörden und der konventionellen Medizin. Genährt von realen Problemen wie der Zunahme chronischer Krankheiten und beschleunigt durch die Corona-Pandemie, bietet die Bewegung simple Heilsversprechen und Schuldzuweisungen. Ihre wissenschaftsfeindliche Haltung, insbesondere in der Impffrage, und die Verbreitung von widerlegten Thesen bergen das Potenzial, die öffentliche Gesundheit massiv zu gefährden. Die politische Verankerung der Bewegung durch die Ernennung von RFK Jr. zum Gesundheitsminister in einer Trump-Regierung droht, Pseudowissenschaft zur Regierungspolitik zu machen und das Gesundheitssystem nachhaltig zu beschädigen.
Gleichzeitig liefert die Aufarbeitung der Ära Biden, wie sie im Enthüllungsbuch „Original Sin“ beschrieben wird, ein düsteres Bild über die Mechanismen der Macht. Die angebliche Verschwörung des Schweigens über den kognitiven Zustand des ehemaligen Präsidenten wird als Fallstudie über die Perversion von Loyalität und die Gefahren des Schweigens in einer Demokratie dargestellt. Unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Vorwürfe zeigt die Debatte, dass das Vertrauen in die Führung und die demokratischen Institutionen selbst zu erodieren droht, wenn eine Fassade aufrechterhalten wird, die nicht der Realität entspricht.
Die vergangene Woche hat somit ein Land im Krisenmodus gezeigt. Die Fronten verlaufen nicht mehr nur zwischen den Parteien, sondern quer durch Institutionen, zwischen Bund und Einzelstaaten und inmitten der Gesellschaft. Der Kampf um die Seele des amerikanischen Rechtsstaates, der Kampf um die Deutungshoheit über Fakten und die Erosion des Vertrauens in demokratische Prozesse haben eine Intensität erreicht, die das Land vor eine Zerreißprobe stellt. Die Ereignisse sind keine isolierten Episoden, sondern Symptome einer tiefen Krise, deren Ausgang ungewiss ist und deren Folgen noch lange zu spüren sein werden.