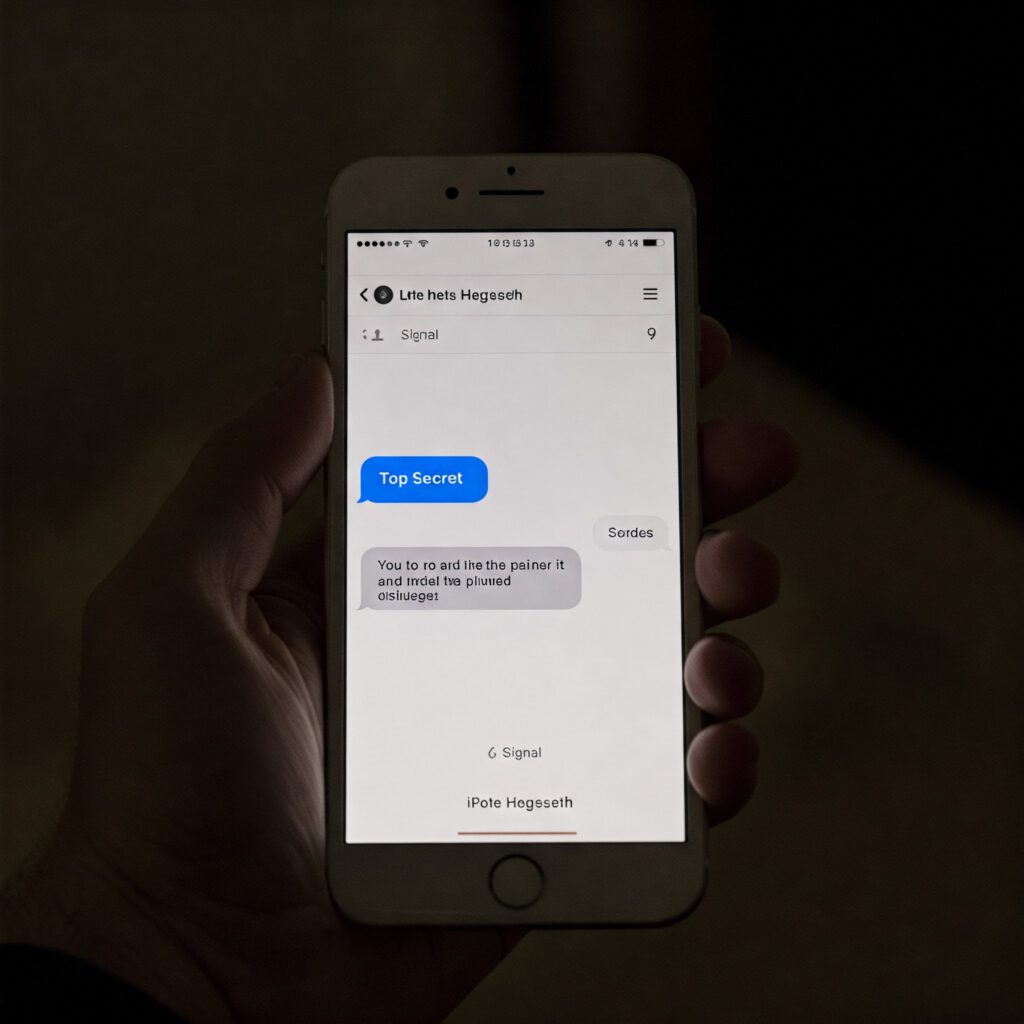Der deutsche Kanzler reiste nach Washington, um eine Beziehung zum unberechenbarsten Verbündeten aufzubauen. Er kehrte mit einer persönlichen Verbindung zurück, musste dafür aber eine Botschaft der amerikanischen Gleichgültigkeit gegenüber der Ukraine in Kauf nehmen. Eine Analyse eines Besuchs, dessen erfreuliche Atmosphäre sein vielleicht gefährlichstes Ergebnis ist.
Als Friedrich Merz am Donnerstag das Oval Office betrat, lag eine fast greifbare Anspannung in der Luft. Die politische Welt hatte den Atem angehalten und einen Eklat erwartet, wie ihn schon andere Staatsgäste vor ihm im Machtzentrum der Trump-Administration erlebt hatten. Doch der Sturm blieb aus. Stattdessen entfaltete sich eine Szenerie fast unheimlicher Harmonie, orchestriert von einem US-Präsidenten, der den deutschen Kanzler mit Lob und Schmeicheleien überhäufte. Merz, der neue Kanzler, der angetreten war, um Deutschlands Rolle auf der Weltbühne neu zu definieren, hatte seine erste und vielleicht wichtigste Prüfung im Umgang mit Donald Trump bestanden. Er verließ Washington mit dem, was er sich am meisten erhofft hatte: einem persönlichen Draht, einem direkten Zugang zum Präsidenten.
Doch dieser persönliche Erfolg, errungen durch eine meisterhafte diplomatische Choreografie, hat einen hohen Preis. Denn während der Kanzler das Gefühl gewann, einen Partner gefunden zu haben, hörte man in den Hauptstädten Europas, und vor allem in Kiew, eine andere, erschütternde Botschaft. Es ist die Botschaft eines amerikanischen Präsidenten, der den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit dem Zank zweier Kinder vergleicht, die man am besten eine Weile weiterkämpfen lässt, bevor man sie trennt. Die Analyse des Treffens offenbart ein fundamentales Paradox: Merz‘ taktischer Sieg in der Beziehungspflege könnte sich als strategischer Rückschlag für die Sicherheit Europas erweisen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die Kunst des Überlebens im Oval Office
Friedrich Merz kam nicht unvorbereitet nach Washington. Sein Team hatte die möglichen Fallstricke eines Treffens mit Trump akribisch analysiert, und der Kanzler selbst hatte sich mit anderen Staats- und Regierungschefs beraten, die die Erfahrung bereits gemacht hatten. Seine Strategie war klar: Konfrontation vermeiden, Gemeinsamkeiten betonen und eine persönliche Ebene herstellen. Dieses Ziel verfolgte er mit einer fast unterwürfigen Disziplin. Er überließ Trump die Bühne, der die Gelegenheit für ausufernde Monologe nutzte, die sich weniger um die deutsch-amerikanischen Beziehungen als um seine innenpolitischen Fehden drehten. Trump sprach über Elon Musk, über seinen Vorgänger Joe Biden und über die angebliche Notwendigkeit, internationale Studierende von Eliteuniversitäten wie Harvard fernzuhalten – Merz saß daneben, nickte freundlich und wartete ab.
Den wohl kalkuliertesten Schachzug landete der Kanzler mit seinem Gastgeschenk. Er überreichte Trump nicht etwa staatstragende Präsente, sondern ein golden gerahmtes Faksimile der Geburtsurkunde von dessen Großvater, der einst aus der Pfalz in die USA ausgewandert war. Es war ein cleverer, persönlicher Appell an die Wurzeln des Präsidenten, der sichtlich gerührt einen „Ehrenplatz“ für das Dokument versprach. Diese Geste, gepaart mit Merz‘ flüssigem Englisch und seiner wiederholten Betonung der Dankbarkeit gegenüber den USA für die Befreiung von der Nazi-Diktatur, schuf die von Merz erhoffte gute Atmosphäre. Trump lobte ihn als „großartigen Mann“ und „sehr respektierten“ Vertreter Deutschlands, der im Gegensatz zu seiner Vorgängerin Angela Merkel nicht als Gegner, sondern als potenzieller Verbündeter oder gar Leidensgenosse wahrgenommen wurde. Merz hatte verstanden, dass persönliche Beziehungen für Trump die eigentliche Währung der internationalen Politik sind.
Wenn Kinder streiten: Trumps erschütternde Gleichgültigkeit gegenüber der Ukraine
Die Grenzen dieser neuen Harmonie zeigten sich jedoch brutal beim zentralen Thema des Besuchs: dem Krieg in der Ukraine. Hier prallten zwei fundamental unterschiedliche Weltsichten aufeinander. Merz kam mit dem klaren Ziel, die USA zu einer aktiveren Rolle zu bewegen und den Druck auf Wladimir Putin zu erhöhen. Er stilisierte Trump zur „Schlüsselfigur“, die allein in der Lage sei, das Blutvergießen zu beenden. Doch Trump erteilte diesen Hoffnungen eine eiskalte Abfuhr. Er wiederholte eine Analogie, die er nach eigenen Angaben auch Putin gegenüber verwendet hatte: Russland und die Ukraine seien wie zwei kleine Kinder, die sich im Park prügeln. Manchmal, so der US-Präsident, sei es besser, sie eine Weile kämpfen zu lassen, da beide Seiten leiden müssten, bevor eine Lösung möglich sei.
Diese Aussage ist mehr als nur eine flapsige Bemerkung; sie ist ein Fenster in Trumps außenpolitische Doktrin. Sie offenbart eine zutiefst isolationistische und transaktionale Sichtweise, in der die USA nicht mehr als Garant einer liberalen Weltordnung agieren, sondern als distanzierter Akteur, der je nach Kosten-Nutzen-Abwägung interveniert – oder eben nicht. Trump ging sogar noch weiter und deutete an, dass am Ende beide Kriegsparteien bestraft werden könnten, denn zum Tango, so der Präsident, gehörten immer zwei. Für die Ukraine, deren Vertreter Merz in Berlin noch kurz zuvor Unterstützung zugesichert hatte, ist diese Haltung verheerend.
Merz versuchte, gegenzusteuern. Er widersprach Trumps Darstellung der Opfer und stellte klar, dass Russland Zivilisten bombardiere, während die Ukraine ausschließlich militärische Ziele angreife. Er bekräftigte, dass Deutschland fest an der Seite der Ukraine stehe. Doch seine Einwände waren leise, fast zaghaft formuliert, um den Hausherrn nicht zu provozieren. Trump überhörte sie geflissentlich oder wich aus, indem er auf die riesigen Öl- und Gasreserven der USA verwies. Der Kanzler befand sich in einer Zwickmühle: Ein offener Widerspruch hätte die soeben aufgebaute Beziehung sofort wieder zerstört. Sein Schweigen jedoch wurde von der Welt als Duldung der amerikanischen Passivität interpretiert.
Ein fragiler Frieden: Die ungelösten Konflikte bei Handel und Verteidigung
Auch bei anderen zentralen Themen blieben unter der Oberfläche der Freundlichkeit tiefe Gräben bestehen. Trump lobte zwar die erhöhten deutschen Verteidigungsausgaben als „positiv“, machte aber zugleich klar, dass er das von ihm ins Spiel gebrachte Ziel von fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ernst meint. Seine Kommentare zur deutschen Aufrüstung waren doppelbödig; er scherzte, man müsse aufpassen, dass Deutschland nicht zu stark werde. Diese Ambivalenz zeigt, dass das Misstrauen gegenüber Deutschland als wirtschaftlichem Konkurrenten weiterhin eine Triebfeder seiner Politik ist.
Im Bereich der Handelspolitik blieben die Aussagen vage und widersprüchlich. Während Trump einen „guten Handelsdeal“ in Aussicht stellte, wiederholte er seine Drohung mit Strafzöllen. Er beklagte das hohe deutsche Handelsdefizit und machte deutlich, dass er bereit ist, die amerikanische Wirtschaft mit protektionistischen Maßnahmen zu schützen. Auch seine Behauptung, er habe die Gaspipeline Nord Stream 2 gestoppt, wurde in den Faktenchecks als falsch entlarvt – die deutsche Regierung hatte das Projekt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine auf Eis gelegt. Merz vermied es, auf diese Falschaussagen direkt einzugehen, und verwies stattdessen auf Deutschlands hohe Direktinvestitionen in den USA. Auch hier zeigte sich sein Muster: besänftigen, ablenken und den Konflikt kleinhalten.
Der Besuch von Friedrich Merz in Washington war ein diplomatischer Balanceakt auf dem Hochseil. Der Kanzler hat sein primäres, kurzfristiges Ziel erreicht: Er hat eine funktionierende, persönliche Arbeitsbeziehung zu einem Präsidenten etabliert, den Europa fürchten und umwerben muss. Er hat bewiesen, dass er im Gegensatz zu seiner Vorgängerin in der Lage ist, einen Zugang zu Trumps Welt zu finden. Doch die Bilder der Harmonie täuschen über eine bittere Realität hinweg. Der Preis für diesen Zugang ist die öffentliche Akzeptanz einer amerikanischen Außenpolitik, die sich von den Interessen ihrer europäischen Verbündeten abkoppelt und die Ukraine ihrem Schicksal überlässt. Für den Kanzler mag sich der Besuch wie ein Erfolg anfühlen, für die transatlantische Sicherheit und die Ukraine gleicht er jedoch einem bedrohlichen Signal. Die eigentliche Frage ist nun nicht mehr, ob Merz mit Trump reden kann, sondern was Europa und Deutschland tun, wenn Trumps freundliche Worte in Tatenlosigkeit oder gar Feindseligkeit umschlagen.