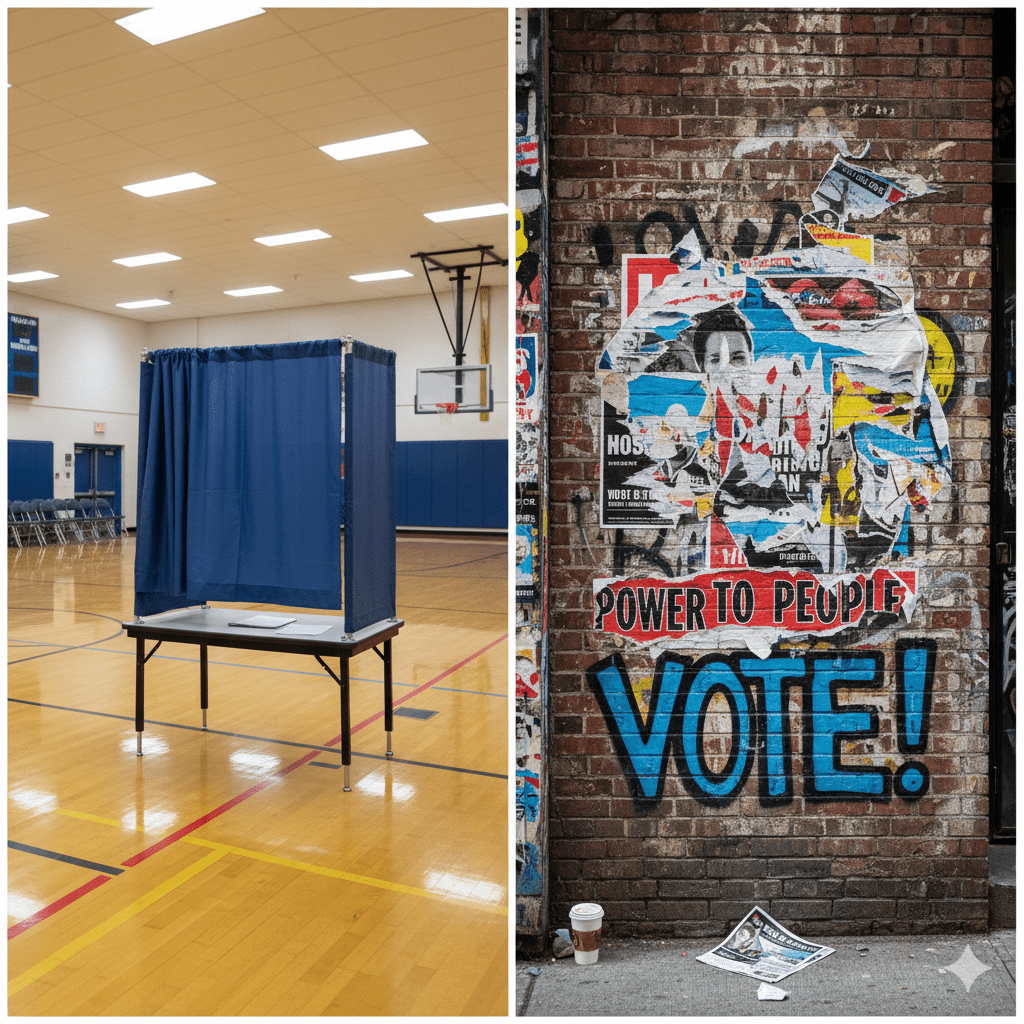In einer Zeit, in der der Oberste Gerichtshof der USA vor allem durch ideologische Grabenkämpfe und knappe 5:4-Entscheidungen von sich reden macht, gleicht ein einstimmiges Urteil einer politischen Sensation. Genau dies geschah im Fall der Marlean Ames, einer heterosexuellen Frau aus Ohio, die sich von ihrem Arbeitgeber diskriminiert fühlte. Mit 9:0 Stimmen entschieden die Richter, dass für alle Menschen, unabhängig davon, ob sie einer historischen Mehrheits- oder Minderheitengruppe angehören, die gleichen Hürden beim Nachweis von Diskriminierung am Arbeitsplatz gelten müssen. Was auf den ersten Blick wie eine rein technische Korrektur eines juristischen Sonderwegs in einigen Bundesstaaten anmutet, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als ein Urteil von erheblicher symbolischer und praktischer Sprengkraft.
Die Entscheidung ist weit mehr als nur die späte Genugtuung für eine einzelne Klägerin. Sie markiert einen Wendepunkt in der amerikanischen Rechtsauffassung von Gleichheit und dient als Katalysator in einem ohnehin schon überhitzten Kulturkampf um Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI). Das Votum, das von der liberalen Ikone Ketanji Brown Jackson verfasst und von konservativen Hardlinern wie Clarence Thomas mitgetragen wurde, legt die tiefen Widersprüche der amerikanischen Gesellschaft offen. Es zeigt eine Nation, die sich auf das Prinzip der formalen Gleichheit einigen kann, aber zutiefst gespalten ist, was dieses Prinzip in einer von Ungleichheit geprägten Realität bedeutet.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Der Fall einer Staatsangestellten und das Ende des doppelten Standards
Der Ausgangspunkt dieser weitreichenden Entscheidung war ein persönlicher und beruflicher Rückschlag für Marlean Ames. Als langjährige Mitarbeiterin im Jugendamt von Ohio, wo sie seit 2004 tätig war und sich bis zur Leiterin eines Programms gegen sexuelle Übergriffe hochgearbeitet hatte, bewarb sie sich 2019 für eine Führungsposition. Doch sie wurde übergangen. Die Stelle ging an eine lesbische Kollegin, die Ames für weniger qualifiziert hielt und die anfangs nicht einmal Interesse an dem Job gezeigt hatte. Kurz darauf verlor sie auch eine zweite Beförderungsmöglichkeit an einen jungen, homosexuellen Mann, einen ehemaligen Protegé von ihr, der laut Ames‘ Klage nicht die Mindestanforderungen für die Position erfüllte.
Anstatt einer Beförderung wurde der damals 55-jährigen Ames nach Jahrzehnten im Staatsdienst nahegelegt, in den Ruhestand zu gehen. Schließlich stellte man sie vor die Wahl: eine Degradierung mit einer Gehaltskürzung von rund 40 Prozent oder der Verlust ihres Arbeitsplatzes. Ames klagte wegen Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung als heterosexuelle Frau. Ihr Arbeitgeber, das Ohio Department of Youth Services, wies die Vorwürfe zurück. Ames fehle es an Vision und Führungskompetenz, sie habe in einem Vorstellungsgespräch schlecht abgeschnitten und sei als „scharf“ im Umgang („abrasive“) beschrieben worden.
Ihre Klage scheiterte zunächst in den unteren Instanzen. Der Grund war eine juristische Besonderheit, die in etwa der Hälfte der Bundesgerichtsbezirke der USA galt, darunter auch im für Ohio zuständigen Sixth Circuit. Gerichte verlangten von Klägern, die einer traditionellen Mehrheitsgruppe angehören (wie Weiße, Männer oder Heterosexuelle), einen erschwerten Beweis. Sie mussten sogenannte „background circumstances“ nachweisen – also besondere Umstände, die den Verdacht nahelegen, dass der spezifische Arbeitgeber untypischerweise die Mehrheit diskriminiert. Dies konnte beispielsweise durch den Nachweis geschehen, dass die Entscheidungsträger selbst einer Minderheit angehörten oder durch statistische Daten, die eine systematische Benachteiligung der Mehrheit belegen. Ames konnte beides nicht liefern; die Vorgesetzten, die sie degradierten, waren selbst heterosexuell. Damit war ihre Klage am Ende, bevor sie inhaltlich geprüft wurde.
Ein radikales Einverständnis: Warum selbst Gegner einer Meinung waren
Die zentrale Frage, die der Supreme Court zu klären hatte, war, ob diese Ungleichbehandlung vor dem Gesetz haltbar ist. Die Antwort der Richter fiel ebenso klar wie einstimmig aus: Nein. Die von Justice Jackson verfasste Urteilsbegründung stützt sich auf eine simple, aber fundamentale Lesart des entscheidenden Gesetzes, des Civil Rights Act von 1964. Dieses Gesetz verbietet Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund von Merkmalen wie Rasse, Religion, Geschlecht – und seit einem Grundsatzurteil von 2020 auch aufgrund der sexuellen Orientierung. Justice Jackson argumentierte, der Gesetzestext schütze jedes „Individuum“ und mache keinerlei Unterschied zwischen Angehörigen von Mehrheits- oder Minderheitsgruppen. Der Kongress habe den Gerichten keinen Raum gelassen, spezielle Hürden allein für Kläger aus Mehrheitsgruppen zu errichten.
Diese Konzentration auf den reinen Gesetzestext führte zu einem Phänomen, das Richter Neil Gorsuch während der mündlichen Verhandlung als „radikales Einverständnis“ bezeichnete. Nicht nur die Richter über alle ideologischen Lager hinweg waren sich einig, sondern auch die Anwälte beider Seiten. Selbst der Anwalt des Staates Ohio, der die Entscheidung der unteren Instanz eigentlich verteidigen sollte, räumte ein, dass es falsch sei, von Klägern aufgrund ihrer Identitätsmerkmale unterschiedliche Beweislasten zu verlangen.
Die eigentliche politische Brisanz des Falles zeigt sich in der ungewöhnlichen Koalition, die Marlean Ames unterstützte. An ihrer Seite stand nicht nur die konservative Rechtsorganisation America First Legal, geführt vom ehemaligen Trump-Berater Stephen Miller, die regelmäßig gegen DEI-Initiativen klagt. Auch die Regierung des demokratischen Präsidenten Joe Biden reichte ein sogenanntes Amicus Brief ein, um Ames‘ Position zu stärken. Diese seltene Einigkeit von politisch verfeindeten Lagern illustriert, dass es im Kern um ein fundamentales Rechtsprinzip ging, das beide Seiten für sich beanspruchen: die formale Gleichheit vor dem Gesetz, symbolisiert durch die Inschrift am Gebäude des Supreme Court: „Equal Justice Under Law“.
Mehr als nur ein Urteil: Ein Brandbeschleuniger im Kulturkampf um DEI
Doch diese formale Einigkeit überdeckt nur notdürftig die tiefen gesellschaftlichen Verwerfungen. Rechtsexperten sehen in dem Urteil einen logischen Folgeschritt nach der Entscheidung des Supreme Court von 2023, die „race-conscious admissions“, also die Berücksichtigung der ethnischen Herkunft bei Hochschulzulassungen, für verfassungswidrig erklärte. Dieses neue Urteil, so die Analyse, werde den Trend beschleunigen, bei dem Programme zur Förderung von Minderheiten zunehmend als diskriminierend angefochten werden.
Obwohl der Fall Ames nicht direkt DEI-Programme von Unternehmen betrifft, erhöht er den Druck auf Firmen, ihre Initiativen zur Förderung von Diversität zu überdenken. Die Entscheidung bestärkt die Position derjenigen, die argumentieren, dass jegliche Form von zielgerichteter Förderung einer Gruppe zwangsläufig eine Benachteiligung einer anderen darstellt. Dies fällt zusammen mit den politischen Angriffen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump auf DEI-Programme in Bundesbehörden und im privaten Sektor. Die Sorge ist, dass das Urteil als Waffe in einem breiteren Kampf gegen Diversitätsbemühungen genutzt wird. Während Befürworter von einer notwendigen Rückkehr zur Farbenblindheit sprechen, befürchten Kritiker eine Erosion der Schutzmechanismen für historisch benachteiligte Gruppen.
Diese Spannung spiegelte sich auch in den eingereichten Schriftsätzen wider. Der NAACP Legal Defense Fund, eine traditionsreiche Bürgerrechtsorganisation, mahnte die Richter, die Geschichte und den ursprünglichen Zweck des Title VII nicht zu vergessen, der darauf abzielte, historisch benachteiligte Minderheiten zu schützen. Die „virtuelle Abwesenheit“ von weitverbreiteter Diskriminierung gegen Weiße oder Heterosexuelle sei eine relevante und wichtige Tatsache. Auf der Gegenseite argumentierte die libertäre Pacific Legal Foundation, dass durch den Aufstieg der „DEI-Ideologie“ Diskriminierung gegen weiße und heterosexuelle Männer inzwischen „allzu gewöhnlich“ geworden sei. Die Angst vor einer Prozesswelle wurde im Verfahren zwar geäußert, aber von Ames‘ Anwalt mit dem Hinweis entkräftet, dass in den über 50 % der Gerichtsbezirke, die bereits ohne die höhere Hürde arbeiteten, keine Klagewelle zu beobachten sei.
Wer ist die „Mehrheit“? Justice Thomas und die Auflösung der Kategorien
Eine besonders tiefgreifende Analyse der Problematik lieferte der konservative Richter Clarence Thomas in einer ergänzenden Stellungnahme. Er nutzte den Fall, um die grundlegende Schwierigkeit zu thematisieren, Menschen überhaupt in starre Kategorien wie „Mehrheit“ oder „Minderheit“ einzuteilen. Solche von Gerichten geschaffenen Doktrinen, so Thomas, verzerren den ursprünglichen Gesetzestext und schaffen unnötige Komplexität.
Er führte pointierte Beispiele an, um die Fragilität dieser Labels zu demonstrieren. Frauen, so schrieb er, stellen in den USA zwar die Mehrheit der Bevölkerung, in bestimmten Branchen wie dem Baugewerbe jedoch eine Minderheit dar, während sie im Lehr- und Pflegeberuf die Mehrheit bilden. Schwarze Angestellte seien in der Stadt Detroit eine Mehrheit, im Bundesstaat Michigan oder den USA insgesamt jedoch eine Minderheit. Die Kategorien, so Thomas, seien „überdehnt“ und „ungenau“. Er griff auch die Prämisse des unteren Gerichts an, dass es „ungewöhnlich“ sei, wenn ein Arbeitgeber Mitglieder der Mehrheit diskriminiere. Angesichts der Verbreitung von DEI- und Affirmative-Action-Programmen, so seine provokante These, seien viele amerikanische Arbeitgeber geradezu „besessen“ davon, gezielt gegen jene zu diskriminieren, die sie als Angehörige von Mehrheitsgruppen betrachten. Mit dieser Argumentation entkernt er die Logik, die dem besonderen Schutzstatus von Minderheiten zugrunde lag, und deutet an, dass die Verhältnisse sich grundlegend verschoben haben könnten.
Das einstimmige Urteil im Fall Ames ist somit ein Ereignis von doppelter Bedeutung. An der Oberfläche hat der Supreme Court einen Zustand der Rechtsklarheit und formalen Gleichheit hergestellt, indem er einen juristischen Sonderweg beseitigte. Unter der Oberfläche jedoch hat er einer politischen Bewegung, die den Abbau von Schutz- und Förderprogrammen für Minderheiten zum Ziel hat, ein wirkmächtiges Werkzeug in die Hand gegeben. Die Entscheidung senkt die Hürde für Klagen wegen „umgekehrter Diskriminierung“ und legitimiert eine Sichtweise, die Gleichheit allein als identische Behandlung jedes Individuums versteht, losgelöst von historischem Kontext und gesellschaftlicher Machtverteilung. Der Kampf um die wahre Bedeutung von „Equal Justice Under Law“ hat gerade erst eine neue, schärfere Phase erreicht.