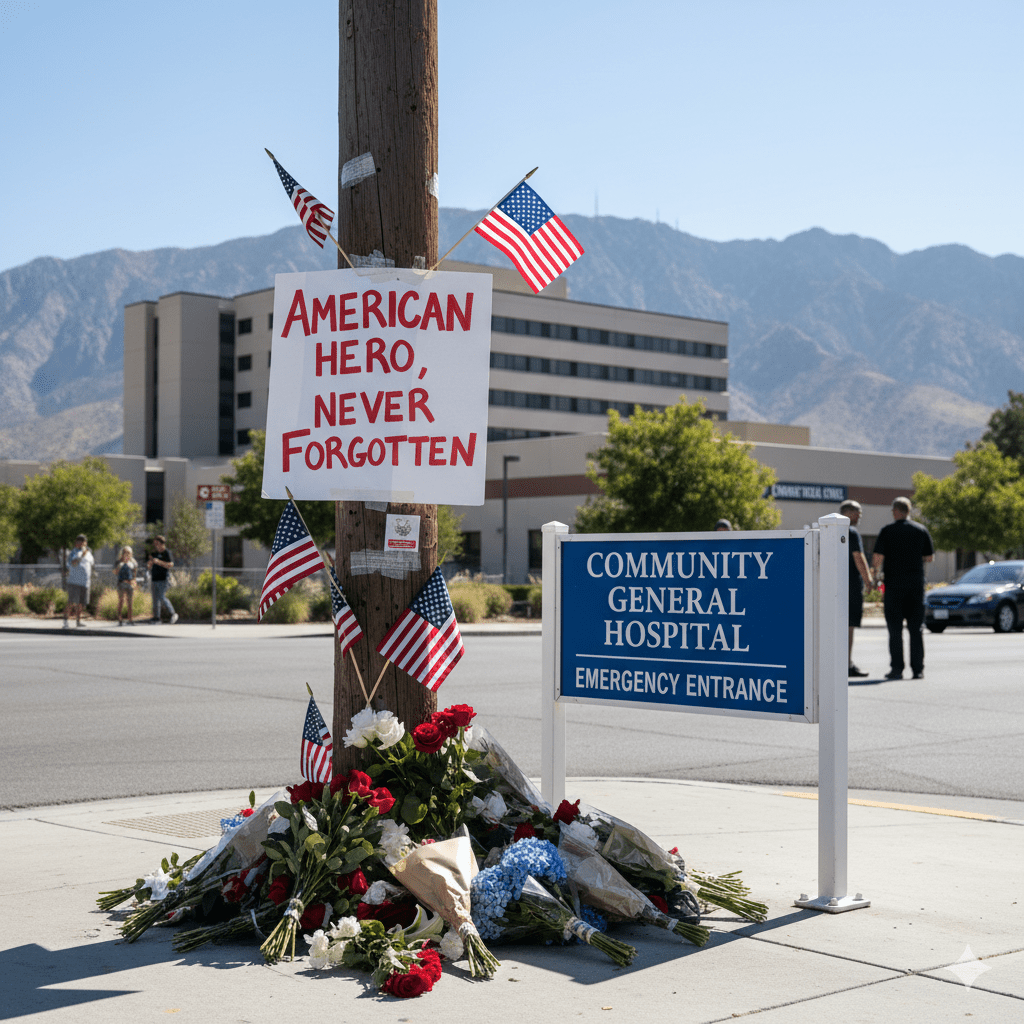Das kalifornische Hochgeschwindigkeitsbahnprojekt, einst als leuchtendes Symbol einer fortschrittlichen, umweltfreundlichen Zukunft und als Beweis amerikanischer Innovationskraft gefeiert, ist zum Inbegriff politischer Dysfunktionalität und planerischen Albtraums geworden. Mit Kosten, die von ursprünglich 33 Milliarden Dollar auf bis zu 128 Milliarden Dollar explodiert sind, und einer Fertigstellung, die sich um Jahrzehnte verzögert, dient das Vorhaben heute vor allem als abschreckendes Beispiel. Es ist eine Chronik des Scheiterns, die tief in Managementfehlern, politischen Grabenkämpfen und einer fatalen Unterschätzung der Realität verwurzelt ist – und die Frage aufwirft, ob solche ambitionierten Infrastrukturprojekte in einer polarisierten Gesellschaft überhaupt noch realisierbar sind.
Vom Prestigeprojekt zur Kostenfalle: Die Anatomie eines Desasters
Die Vision war grandios: In weniger als drei Stunden sollten Passagiere von Los Angeles nach San Francisco reisen, emissionsarm und effizient, eine echte Alternative zum Flugzeug und Auto. Präsident Obama pries es als „tolles Projekt zum Wiederaufbau Amerikas“. Doch die Realität holte die kühnen Pläne schnell ein. Bereits im Januar 2025, fünf Jahre nach dem ursprünglich geplanten Start, waren gerade einmal die ersten Gleise auf wenigen Kilometern verlegt. Die Kosten für die Gesamtstrecke, die ohnehin nur noch zwischen LA und San Francisco geplant ist, könnten sich auf bis zu 128 Milliarden Dollar belaufen, statt der anfänglichen 33 Milliarden. Selbst das erste Teilstück zwischen Bakersfield und Merced in der kalifornischen Wüste soll nun frühestens 2033 fertig sein, wobei selbst dieser Zeitplan als „unwahrscheinlich“ gilt.
Die Gründe für dieses Debakel sind vielschichtig und hausgemacht. Ein zentraler Faktor war das „Ego“ des ehemaligen Gouverneurs Jerry Brown, der das Projekt als sein Prestigevorhaben sah und es im Eiltempo durchsetzen wollte, um 2020 die Jungfernfahrt zu erleben. Dabei wurden die komplexen Herausforderungen im Central Valley, wie die Notwendigkeit, den Bau während der dreimonatigen Erntezeit wegen der vielen Frachtgleise zu unterbrechen, offenbar unterschätzt. Langwierige Gerichtsverfahren wegen Grundstücksenteignungen, wie bei einem Warenhaus nahe Fresno, das zweieinhalb Jahre dauerte, trugen ebenfalls zu Verzögerungen und Kostensteigerungen bei. Diese Aspekte, so der Vorwurf, hätten von Anfang an einkalkuliert und kommuniziert werden müssen, anstatt unrealistische Zeitpläne und Budgets zu präsentieren.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Hinzu kamen die selbstauferlegten hohen Ansprüche. Kalifornien hat strenge Umweltschutzregeln, die bei Großprojekten wie diesem zwar lobenswert sind, aber zu erheblicher Bürokratie führen können. Eine 2012 in Auftrag gegebene Überprüfung der Umweltauflagen war Jahre später immer noch nicht abgeschlossen. Man wollte eine „Utopia“ realisieren und baut nun für viel mehr Geld die „Realität“ – ein Vorgehen, das Fragen nach der ursprünglichen Pragmatik aufwirft. Auch externe Faktoren wie Inflation, wiederholte Planänderungen, höhere als erwartete Landerwerbskosten und die Covid-Pandemie trugen zur Kostenexplosion bei. Nicht zu vergessen ist der massive Widerstand der Fluggesellschaften, die die lukrativen Routen zwischen Los Angeles und dem Raum San Francisco dominierten und das Projekt durch Lobbyarbeit um mindestens zwei Jahrzehnte verzögerten. Logistische Hürden, wie die Durchquerung der Gebirge nördlich von Los Angeles und die Nähe zur San-Andreas-Verwerfung, waren ebenfalls nicht vollständig gelöst. Schließlich wird auch der Missbrauch von Umweltgesetzgebungen durch kleine Interessengruppen kritisiert, die damit sinnvolle Entwicklungen blockieren, welche der Mehrheit zugutekämen.
Demokraten im Zwiespalt: Zwischen Vision und Wählergunst
Das Projekt ist längst zu einer Belastung für die Demokraten in Kalifornien geworden, die es einst mit breiter Unterstützung auf den Weg brachten. Es dient Kritikern als Paradebeispiel für das angebliche Versagen der Demokraten beim Regieren – ein Narrativ, das Donald Trump genüsslich ausschlachtet. „Demokratische Seifenblasen“ sei es, was die Partei verspreche – wohlklingende Visionen, die aber an der Realität zerschellen und den Steuerzahler teuer zu stehen kommen.
Die Uneinigkeit innerhalb der Partei ist unübersehbar. Während einige demokratische Kandidaten für die Nachfolge von Gouverneur Gavin Newsom, wie Tony Atkins, am Projekt festhalten wollen („Weiter, immer weiter“), fordern andere, wie Katie Porter, einen Stopp, „wenn es nichts wird“. Diese Zerrissenheit nährt das Vorurteil der „dauerzankenden Demokraten“, die es allen recht machen wollen und damit niemandem gefallen. Newsom selbst, der 2028 Präsidentschaftsambitionen hegt, agiert vorsichtig. 2019, nach seiner Wahl zum Gouverneur, bezeichnete er die damalige Planung als „zu teuer“ und „zu langwierig“, als die Prognose noch bei 77 Milliarden Dollar lag. Obwohl Kalifornien vor drei Jahren einen Haushaltsüberschuss von 75 Milliarden Dollar verzeichnete, verzichtete Newsom auf massive Zusatzinvestitionen in das Bahnprojekt. Eine mögliche Erklärung: Das Projekt war bereits so verzögert, dass er keine politischen Lorbeeren mehr hätte ernten können, sondern sich im Präsidentschaftswahlkampf für weitere Fehlinvestitionen hätte rechtfertigen müssen.
Die Prioritäten verschieben sich auch angesichts anderer drängender Probleme. Eine aktuelle Umfrage ergab zwar, dass eine Mehrheit der kalifornischen Wähler und insbesondere der Demokraten das Hochgeschwindigkeitsprojekt grundsätzlich unterstützt. Gleichzeitig nannten die Befragten jedoch „Wohnungsbau und Obdachlosigkeit“ als das mit Abstand wichtigste Problemfeld, das Aufmerksamkeit erfordert. Dies spiegelt sich in den Debatten um die Verwendung der Mittel aus dem Cap-and-Trade-Programm wider, der Hauptfinanzierungsquelle des Zugprojekts. Einige demokratische Gesetzgeber wollen mehr Geld für Initiativen zur Bezahlbarkeit oder andere Klimaprogramme verwenden, die schnellere und greifbarere Vorteile versprechen als ein Schienenprojekt, dessen Nutzen für die urbanen Zentren noch Jahrzehnte entfernt scheint. Die Konzentration der Bauarbeiten auf das dünn besiedelte Central Valley, eine Bedingung für frühe Bundesmittel, sorgt zusätzlich für geografische Reibungen, da die demokratischen Machtzentren in den Küstenmetropolen erst viel später profitieren würden.
Trump und die Republikaner: Der Zug als politische Waffe
Für Donald Trump und die Republikaner ist das kalifornische Debakel ein gefundenes Fressen. Trump bezeichnete die Kostensteigerungen als die „schlimmste, die ich je gesehen habe“ und spottete, ein „Gratis-Limo-Service“ wäre billiger gewesen. In beiden Amtszeiten hat er versucht, dem Projekt Bundesmittel zu entziehen oder deren Verwendung zu untersuchen. Im Februar 2025 ordnete sein Verkehrsministerium eine Untersuchung von 4,1 Milliarden Dollar an Fördermitteln an, die unter Präsident Biden bewilligt worden waren. Verkehrsminister Sean Duffy erklärte unumwunden, das Projekt sei „massiv – kein Wortspiel beabsichtigt – vom Kurs abgekommen“ („severely – no pun intended – off track“) und werde „nicht passieren“. Trump selbst kündigte an: „Diese Regierung wird nicht für dieses Ding zahlen“.
Diese Interventionen sind Teil einer umfassenderen Strategie, „Blue State Priorities“ ins Visier zu nehmen, wie auch das Beispiel der New Yorker Staugebühr zeigt. Unterstützt wird Trump dabei von republikanischen Abgeordneten in Kalifornien, die das Projekt als „kolossalen Fehlschlag“ bezeichnen und fordern, die jährlich rund eine Milliarde Dollar an Staatsmitteln stattdessen für den Schutz vor Waldbränden oder die Sicherung der Wasserinfrastruktur auszugeben. Elon Musk, ein Berater Trumps und langjähriger Gegner der kalifornischen Hochgeschwindigkeitsstrecke, der einst sein „Hyperloop“-Konzept vorschlug, um das Bahnprojekt zu stören, fordert zudem die Privatisierung von Amtrak und bezeichnet den US-Schienenverkehr als „traurig“. Die Angriffe zielen nicht nur auf die finanzielle Ader des Projekts, sondern auch auf dessen Symbolkraft. Indem das Projekt als Inbegriff von Verschwendung und Inkompetenz dargestellt wird, soll die Handlungsfähigkeit der demokratischen Regierung diskreditiert werden. Newsom konterte, ein Rückzug würde China einen Infrastrukturvorteil verschaffen und bezeichnete Trump als „König der Schulden“ („King of Debt“).
Ein finanzielles Drahtseilakt: Die ungewisse Zukunft der Finanzierung
Die Finanzierung des kalifornischen Mammutprojekts war von Beginn an wackelig. Ursprünglich sollte ein Drittel der Kosten durch Wähleranleihen, ein Drittel durch Bundesmittel und ein Drittel durch private Investoren gedeckt werden. Doch private Geldgeber zeigten bis heute kein Interesse. Die Hauptlast der Finanzierung trägt somit der Staat, insbesondere durch das Cap-and-Trade-Programm, das den Ausstoß von Treibhausgasen bepreist. 25 Prozent der Einnahmen aus diesem Programm, seit 2012 rund 32 Milliarden Dollar, fließen in das Bahnprojekt. Dieses Programm muss jedoch neu autorisiert werden, und die Konkurrenz um die Mittel ist groß. Gouverneur Newsom unterstützt zwar eine Verlängerung des Cap-and-Trade-Programms und will jährlich eine Milliarde Dollar für die Bahn sichern, hat aber auch signalisiert, dass er mehr Geld für E-Auto-Rabatte und Maßnahmen zur Senkung der Lebenshaltungskosten einsetzen möchte.
Die Gewerkschaften, deren Mitglieder von den fast 15.000 durch das Projekt geschaffenen Bauarbeitsplätzen profitieren, machen massiven Druck, den Anteil für die Hochgeschwindigkeitsbahn beizubehalten. Sie sehen einen Wegfall der Mittel aus Sacramento als reale Bedrohung. Demgegenüber argumentieren Klimaexperten, dass das Geld in anderen Bereichen, wie Forstwirtschaft oder der Unterstützung einkommensschwacher Haushalte bei den Stromrechnungen, effektiver für den Klimaschutz eingesetzt werden könnte, da der Zug erst in vielen Jahren Emissionsreduktionen bringen würde. Selbst für das erste Teilstück im Central Valley klafft eine Finanzierungslücke von rund 4 Milliarden Dollar. Die California High-Speed Rail Authority (HSRA) betont zwar, das Projekt könne vier Jahre Trump überstehen, bezeichnet aber die Cap-and-Trade-Gelder als „entscheidend“ und fest in den Finanzplänen verankert. Ein möglicher Entzug der bereits bewilligten Bundesmittel durch die Trump-Administration würde die Situation weiter verschärfen und könnte laut Analysten dazu führen, dass auf den neuen Gleisen nur langsamere Dieselzüge verkehren könnten.
Mehr als nur ein Zug: Ein Symbol im politischen und kulturellen Kampf
Das kalifornische Hochgeschwindigkeitsbahnprojekt ist längst mehr als ein Infrastrukturvorhaben; es ist ein Symbol mit vielfältigen Aufladungen. Für Kritiker, insbesondere im konservativen Lager, steht es sinnbildlich für die Ineffizienz des Staates und das Scheitern progressiver Politik. Die „Demokratischen Seifenblasen“, die schönen Versprechungen ohne realistische Grundlage, dienen als Argument gegen eine aktive Rolle des Staates. Elon Musk nährt diese Skepsis, indem er die „epischen Hochgeschwindigkeitszüge“ im staatlich subventionierten China lobt und gleichzeitig den US-Schienenverkehr als „traurig“ abkanzelt, um für Privatisierungen zu werben.
Gouverneur Newsom hingegen beschwört die Gefahr, durch ein Aufgeben des Projekts China einen „generationenübergreifenden Infrastrukturvorteil“ zu überlassen. In dieser Lesart geht es um nicht weniger als die Zukunftsfähigkeit Amerikas im globalen Wettbewerb. Die Debatte spiegelt auch eine kulturelle Kluft wider: In den USA, so ein Zitat, sei man nicht auf Schienensysteme „verkauft“, sondern auf Autos. Dies deutet auf eine tiefere gesellschaftliche Verankerung des Individualverkehrs hin, die es Schienenprojekten schwerer macht als in Europa oder Asien. Das Projekt berührt auch die Diskussion über eine „Politik des Überflusses“ (politics of abundance) versus eine „Politik der Knappheit“ (politics of scarcity), wie sie Ezra Klein in der New York Times thematisierte. Kann ein solch ambitioniertes Projekt in Zeiten, in denen viele Bürger drängendere Alltagssorgen haben, noch überzeugen? Die ursprünglichen Versprechen von Umweltfreundlichkeit und Effizienz stehen im Kontrast zu den unmittelbaren Bedürfnissen der Bevölkerung nach bezahlbarem Wohnraum oder Lösungen für die Obdachlosigkeit, insbesondere da der ökologische Nutzen erst in ferner Zukunft zu erwarten ist.
Letztendlich verkörpert der Kampf um den kalifornischen Hochgeschwindigkeitszug eine fundamentale Auseinandersetzung über die Rolle des Staates, die Prioritäten einer Gesellschaft und die Fähigkeit, langfristige Visionen trotz kurzfristiger politischer und finanzieller Hürden zu verfolgen. Ob aus den teuren Fehlern gelernt wird und zumindest ein funktionsfähiges Teilstück entsteht, oder ob das Projekt als Mahnmal unvollendeter Ambitionen in die Geschichte eingeht, bleibt eine der spannendsten Fragen der kalifornischen und amerikanischen Politik. Die Antwort wird weit über die Grenzen des Golden State hinausweisen.