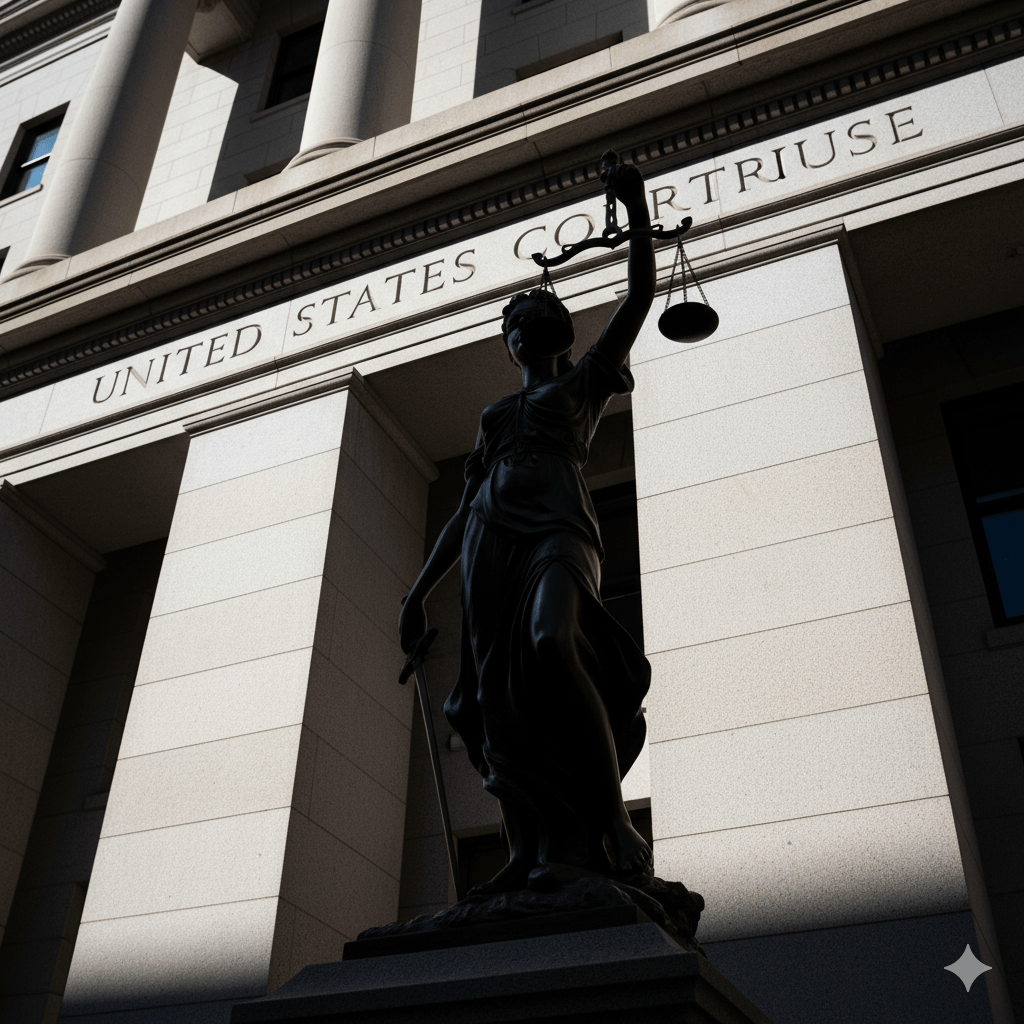Mit der gestrigen Ankündigung, die Importzölle auf Stahl und Aluminium drastisch auf 50 Prozent zu verdoppeln, zündet Donald Trump die nächste Stufe seiner protektionistischen Handelspolitik. Die Massnahme, flankiert von einem umstrittenen Deal zwischen U.S. Steel und Nippon Steel, verspricht amerikanischen Stahlarbeitern goldene Zeiten, birgt jedoch erhebliche Risiken für die US-Wirtschaft, internationale Handelsbeziehungen und die Stabilität des Rechtsstaats. Es zeichnet sich das Bild einer Politik ab, die auf kurzfristige Effekte und markige Worte setzt, dabei aber langfristige Verwerfungen und eine Erosion des Vertrauens in Kauf nimmt.
Die neuerliche Eskalation in der Handelspolitik des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump schlug gestern hohe Wellen: In einer Rede vor Stahlarbeitern in Pennsylvania kündigte er die Verdoppelung der Einfuhrzölle auf Stahl von 25 auf 50 Prozent des Warenwerts an. Wenig später folgte via Truth Social die Bestätigung, dass auch Aluminiumimporte mit einem Satz von 50 Prozent belegt werden sollen. Diese Zölle, die laut Trump bereits ab dem kommenden Mittwoch (4. Juni) gelten sollen, sind das jüngste Kapitel in einer Saga aus Strafabgaben, Drohgebärden und juristischen Scharmützeln, die Trumps Präsidentschaft prägen. Der selbsternannte Meister des Deals, für den „Zölle sein absolutes Lieblingswort“ sind, begründet diesen Schritt einmal mehr mit dem Schutz der nationalen Sicherheit und der Stärkung der heimischen Stahlindustrie. Doch hinter der Fassade patriotischer Rhetorik verbergen sich komplexe wirtschaftliche Kalküle, innenpolitische Manöver und eine bemerkenswerte Flexibilität in der Auslegung eigener Prinzipien, wie der Fall U.S. Steel und Nippon Steel exemplarisch zeigt.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die wirtschaftliche Doppelwirkung: Segen für die Einen, Fluch für die Anderen?
Unmittelbares Ziel der drastischen Zollerhöhungen ist es, die US-Stahlindustrie weiter abzuschirmen und die heimische Produktion sowie Beschäftigung zu fördern. Trump versprach den Arbeitern in Pennsylvania vollmundig, niemand werde ihre Industrie mehr stehlen können; bei 50 Prozent Zoll könnten ausländische Wettbewerber „nicht mehr über diesen Zaun gelangen“. Mittelfristig dürfte diese Politik tatsächlich dazu führen, dass Stahlimporte in die USA erschwert werden und der Preis für Stahl im Inland steigt. Davon könnten US-Produzenten profitieren, die ohne diesen Schutzschirm angesichts eines globalen Stahlüberangebots – laut OECD betrug der Überschuss 2023 das Vierfache der EU-Produktion – kaum profitabel wirtschaften könnten.
Doch die Medaille hat eine Kehrseite: Höhere Stahlpreise bedeuten steigende Kosten für zahlreiche andere Wirtschaftszweige, die auf das Metall angewiesen sind – von der Automobilindustrie über den Maschinenbau bis hin zur Bauwirtschaft. Diese Kostensteigerungen könnten entweder die Gewinne der Unternehmen schmälern oder an die Konsumenten weitergegeben werden, was wiederum die Inflation anheizen und die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Produkte auf dem Weltmarkt beeinträchtigen könnte. Auch wichtige Handelspartner, darunter Alliierte wie Kanada, Brasilien, Mexiko und die Europäische Union, insbesondere Deutschland, dürften die Auswirkungen spüren. Deutschland, der grösste Stahlproduzent der EU, exportierte zuletzt jährlich rund eine Million Tonnen Stahl, zumeist Spezialstahl, in die USA, die als wichtigster Absatzmarkt für die europäische Stahlindustrie gelten. Ob Ausnahmeregelungen für enge Partner wie Kanada und Mexiko vorgesehen sind, mit denen die USA eine Freihandelszone bilden, blieb zunächst unklar – bei den ursprünglichen 25-Prozent-Zöllen gab es keine.
Zwischen nationaler Sicherheit und Wahlkampfgetöse: Die Motive hinter den Zöllen
Offiziell begründet die US-Regierung die Abgaben auf Stahl und Aluminium mit dem Schutz der nationalen Sicherheit, gestützt auf Section 232 des Trade Expansion Act von 1962. Kritiker sehen darin jedoch häufig einen Vorwand, um protektionistische Massnahmen zu legitimieren, die eher innenpolitischen oder verhandlungstaktischen Zielen dienen. Die Ankündigung der Zollerhöhung erfolgte medienwirksam während einer Wahlkampfveranstaltung in einem Stahlbetrieb in Pennsylvania, einem Schlüsselstaat für politische Mehrheiten. Trump inszeniert sich gerne als Beschützer der amerikanischen Arbeiterklasse, und Zölle sind ein zentrales Element dieser Erzählung. Dass er Zölle als sein „absolutes Lieblingswort“ bezeichnet, unterstreicht die ideologische Aufladung des Themas.
Darüber hinaus dienen Zollandrohungen Trump oft als Verhandlungstaktik, um Handelspartner zu Zugeständnissen zu bewegen. Viele Länder, darunter auch die Europäische Union, befinden sich bereits in Verhandlungen mit den USA, um neue Zölle zu vermeiden oder bestehende Handelsabkommen anzupassen. Im Falle der EU wurden angedrohte zusätzliche Zölle auf Importe zuletzt bis Anfang Juli ausgesetzt, um mehr Zeit für Verhandlungen zu schaffen. Diese Strategie des permanenten Drucks und der Ungewissheit mag kurzfristig taktische Erfolge ermöglichen, untergräbt aber langfristig verlässliche Handelsbeziehungen und internationale Kooperationsmechanismen.
Die Akte U.S. Steel und Nippon: Ein „Deal“ voller Widersprüche und offener Fragen
Exemplarisch für Trumps sprunghafte und von persönlichen Interventionen geprägte Handelspolitik steht der geplante Zusammenschluss von U.S. Steel und dem japanischen Konkurrenten Nippon Steel. Nachdem Präsident Joe Biden einen früheren Fusionsversuch aufgrund nationaler Sicherheitsbedenken blockiert hatte, und auch Trump sich im Dezember noch vehement gegen den Verkauf des „einst grossen und mächtigen U.S. Steel“ an ein ausländisches Unternehmen ausgesprochen und versprochen hatte, den Deal als Präsident zu blockieren, vollzog er nun eine Kehrtwende. Er preist die Verbindung nun als „blockbuster agreement“ und „Partnerschaft“, die er selbst orchestriert habe und die 70.000 amerikanische Arbeitsplätze schaffen sowie 14 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft spülen soll. Den Arbeitern von U.S. Steel versprach er neben der Verdoppelung der Stahlzölle einen Bonus von 5.000 Dollar, keine Entlassungen, kein Outsourcing und den Erhalt aller Hochöfen für die nächsten zehn Jahre.
Doch die Details dieser „Partnerschaft“ bleiben nebulös und werfen zahlreiche Fragen auf. Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro betonte, Nippon werde „keine Kontrolle“ über das Unternehmen haben, was im Widerspruch zu Äusserungen etwa des Gouverneurs von Pennsylvania steht, der von einer Akquisition durch Nippon sprach. Unklar ist, wie eine milliardenschwere Investition ohne entsprechende Kontrollrechte für den Investor ausgestaltet sein soll. Die Gewerkschaft United Steelworkers zeigte sich entsprechend skeptisch und beklagte, keine Einblicke in die genauen Bedingungen des Deals zu haben. Ihre Kernbedenken gegenüber Nippon Steel als einem ausländischen Unternehmen mit einer dokumentierten Geschichte von Verstössen gegen US-Handelsgesetze blieben bestehen. Angeblich sollen als Schutzmassnahmen ein amerikanischer CEO, eine amerikanische Mehrheit im Management und Vorstand sowie eine „goldene Aktie“ für die US-Regierung vorgesehen sein. Dennoch verdeutlicht Trumps plötzlicher Sinneswandel – er selbst sagte, Nippon habe immer wieder gefragt und er habe abgelehnt, bis die immer besseren Angebote ihn umstimmten („They really want it. And they’re putting up, you know, billions of dollars…. Nobody would put up money like that.“ ) – wie sehr seine Entscheidungen von situativen Faktoren und persönlichen Präferenzen statt von einer konsistenten Strategie geleitet zu sein scheinen.
Justitia unter Druck: Trumps Feldzug gegen die richterliche Unabhängigkeit
Die Handelspolitik Trumps ist von Beginn an von juristischen Auseinandersetzungen begleitet. Viele seiner Zölle, insbesondere jene, die mit einem Notstand zur Reduzierung des Handelsdefizits begründet wurden, sind Gegenstand von Gerichtsverfahren. Ein US-Gericht für internationale Handelsangelegenheiten stufte diese Zölle kürzlich als gesetzeswidrig ein und ordnete ihre Rückabwicklung an, auch wenn ein Berufungsgericht die Erhebung vorerst weiter erlaubte, ohne in der Sache entschieden zu haben. Die nun angekündigten erhöhten Stahlzölle, die sich auf eine andere Rechtsgrundlage (Section 232) stützen, sind von diesem speziellen Rechtsstreit zwar nicht betroffen. Dennoch zeigt sich hier ein Muster: Trump ist bereit, sich über juristische Bedenken hinwegzusetzen und notfalls bis vor den Supreme Court zu ziehen, dessen Richterschaft er während seiner ersten Amtszeit weit nach rechts verschoben hat.
Besonders bezeichnend ist Trumps Reaktion auf ihm unliebsame Urteile. Er scheut nicht davor zurück, Richter persönlich anzugreifen und ihnen „Hass“ oder destruktive Absichten gegenüber der Nation zu unterstellen. Seine Kritik richtet sich dabei auch gegen das konservative Rechtsestablishment und Schlüsselfiguren wie Leonard Leo von der Federalist Society, denen er vorwirft, ihn bei Richterernennungen schlecht beraten zu haben. Einer der Richter, der an dem für Trump negativen Zoll-Urteil beteiligt war, wurde von ihm selbst nominiert. Diese Angriffe auf die Justiz und die Instrumentalisierung von Richterernennungen für politische Loyalität – wie die kürzliche Nominierung seines ehemaligen persönlichen Anwalts Emil Bove zum Bundesberufungsrichter zeigt – stellen eine bedenkliche Entwicklung für die Gewaltenteilung und die Stabilität des amerikanischen Rechtssystems dar. Es ist ein Versuch, die richterliche Unabhängigkeit zu untergraben und ein Justizsystem zu schaffen, das primär den politischen Zielen der Exekutive dient.
Ein unsicheres Spiel mit ungewissem Ausgang
Donald Trumps erneuter Vorstoss mit drastisch erhöhten Stahl- und Aluminiumzöllen sowie sein erratisches Agieren im Fall U.S. Steel-Nippon fügen sich in ein bekanntes Muster ein. Es ist eine Politik, die auf Konfrontation statt Kooperation setzt, die nationale Interessen über internationale Verpflichtungen stellt und die rechtsstaatliche Prinzipien für den vermeintlichen kurzfristigen Vorteil zu opfern bereit ist. Während die heimische Stahlindustrie und ihre Arbeiter kurzfristig profitieren mögen, drohen langfristig höhere Kosten für Verbraucher und andere Industriezweige, angespannte Beziehungen zu wichtigen Handelspartnern und eine weitere Erosion des Vertrauens in die Verlässlichkeit amerikanischer Politik. Die Handelspartner, allen voran die Europäische Union, stehen erneut vor der Herausforderung, auf eine Politik zu reagieren, die von Unberechenbarkeit und dem permanenten Spiel mit Drohungen und „Deals“ geprägt ist. Ob Verhandlungen unter diesen Umständen zu stabilen und fairen Lösungen führen können, bleibt mehr als fraglich. Vielmehr deutet alles darauf hin, dass die Weltwirtschaft sich auf weitere Turbulenzen einstellen muss, solange das Zoll-Roulette nach Trumps Regeln gespielt wird. Die Frage, ob diese Politik einer konsistenten Strategie folgt oder lediglich Ausdruck einer flexiblen, oft widersprüchlichen und stark personalisierten Machtausübung ist, dürfte Beobachter und Betroffene noch lange beschäftigen.