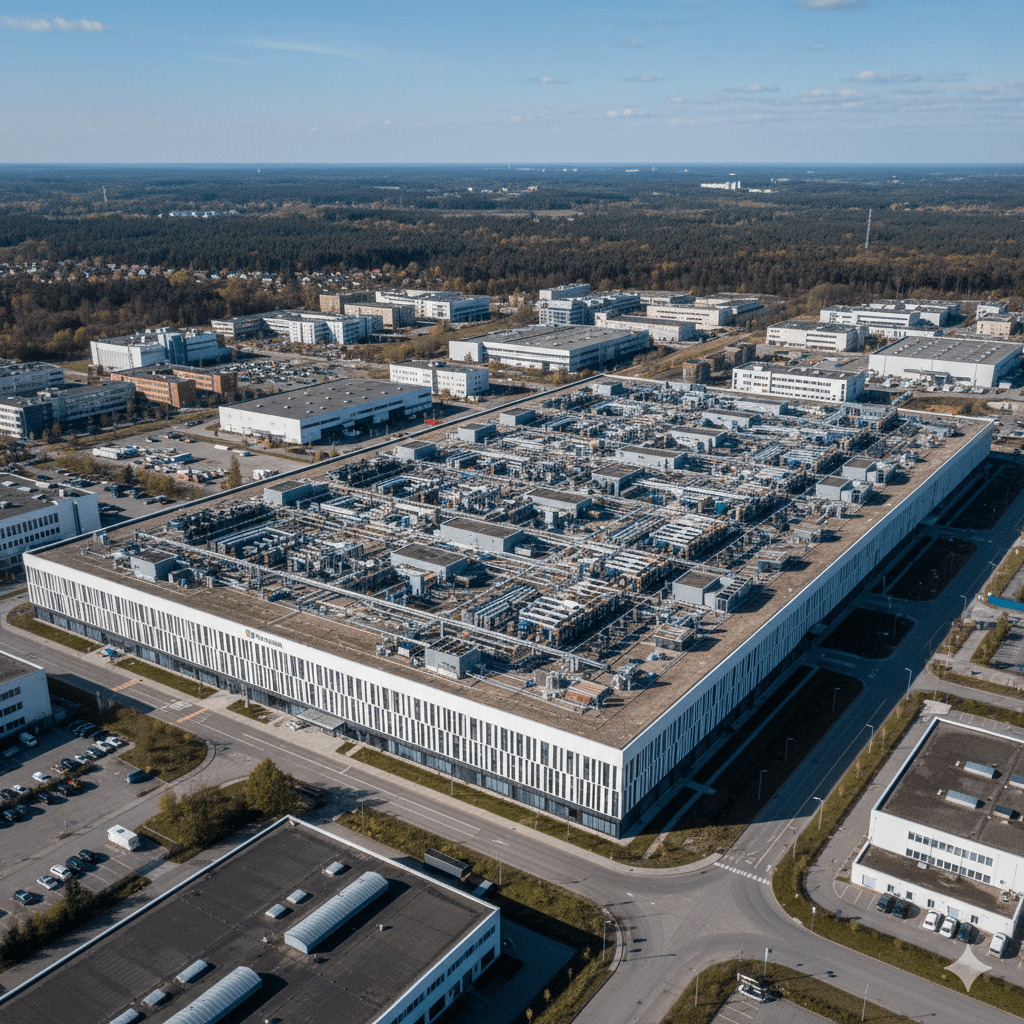Ein Paukenschlag aus New York hallt durch die Korridore der Macht in Washington und die Handelszentren der Welt: Ein Bundesgericht hat Präsident Donald Trumps umfassende Zollstrategie, die auf umstrittenen Notstandsbefugnissen fußt, als rechtswidrig eingestuft. Die Entscheidung des U.S. Court of International Trade (CIT) vom Mittwoch ist weit mehr als eine juristische Niederlage für die Administration; sie ist eine Zäsur mit potenziell weitreichenden Folgen für die amerikanische Handelspolitik, das fragile Gleichgewicht der Staatsgewalten und die globale Wirtschaft. Sie entlarvt die Risiken einer Politik, die mit maximaler Geschwindigkeit und minimaler Konsultation Fakten schaffen will, und stellt die Gretchenfrage nach den legitimen Grenzen präsidialer Autorität im 21. Jahrhundert.
Der juristische Kern: Notstandsbefugnisse sind kein Freibrief für Zollpolitik
Im Zentrum der richterlichen Rüge steht Präsident Trumps extensive Auslegung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) von 1977. Mit Verweis auf angebliche nationale Notlagen – wie den Schmuggel von Fentanyl und persistierende Handelsdefizite – hatte Trump Zölle auf Importe aus zahlreichen Ländern verhängt, darunter auch spezifische Abgaben gegen Kanada, Mexiko und China. Das dreiköpfige Richtergremium des CIT, besetzt mit Richtern, die von Präsidenten beider Parteien ernannt wurden, urteilte einstimmig, dass der Präsident mit dieser Vorgehensweise seine gesetzlichen Kompetenzen überschritten habe.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die Richter machten deutlich, dass der IEEPA dem Präsidenten keine „ungebundene Autorität“ („unbounded authority“) zur Verhängung von Zöllen verleihe. Dieses Gesetz, so die Argumentation, sei primär für Embargos und Sanktionen gedacht und erwähne Zölle nicht einmal explizit. Die Zölle, die Trump unter dem IEEPA erlassen hatte, wurden daher als nicht von diesem Gesetz gedeckt angesehen. Die Administration hatte hingegen argumentiert, die Gerichte sollten die Notstandsentscheidungen des Präsidenten nicht überprüfen und verwies auf den Präzedenzfall von Präsident Nixon in den 1970er Jahren, der damals Notstandsbefugnisse für Zölle nutzte. Doch das CIT sah hier klare Unterschiede: Trumps Maßnahmen, so das Gericht, seien nicht geeignet gewesen, die deklarierten Notstände – wie Drogenschmuggel oder Handelsdefizite – tatsächlich zu adressieren, sondern dienten eher als Druckmittel in Verhandlungen. Genau diese Zweckentfremdung stuften die Richter als nicht mit den Anforderungen des IEEPA vereinbar ein.
Fragwürdige Notstände und die Last der Betroffenen
Die von Trump deklarierten „nationalen Notstände“ standen von Beginn an in der Kritik. Kläger wie der Bundesstaat Oregon und ein Zusammenschluss weiterer elf Staaten sowie diverse Kleinunternehmen, darunter der New Yorker Weinhändler V.O.S. Selections, hatten die Rechtmäßigkeit der Zölle bestritten. Sie argumentierten, ein seit fast einem halben Jahrhundert bestehendes Handelsdefizit stelle keinen plötzlichen Notstand dar, der solch drastische Maßnahmen rechtfertige. Vielmehr seien die Zölle „rechtswidrig, rücksichtslos und wirtschaftlich verheerend“ und ein Resultat präsidialer Willkür. Die Kläger beklagten erhebliche finanzielle Einbußen und Störungen ihrer Lieferketten. Die Entscheidung des CIT öffnet nun potenziell die Tür für Rückforderungen bereits gezahlter Zölle, was eine weitere finanzielle Belastung für die US-Regierung bedeuten könnte. Die Exekutive hingegen beharrte darauf, dass Handelsdefizite sehr wohl eine nationale Krise darstellten, die amerikanische Arbeitsplätze und die industrielle Basis gefährdeten.
Beben an den Märkten, Unsicherheit in der Wirtschaft
Die unmittelbare Reaktion der Finanzmärkte auf das Urteil sprach Bände: Asiatische Aktienkurse und US-Futures verzeichneten einen Sprung nach oben, und der Dollar legte gegenüber dem Yen zu. Dies signalisiert eine vorläufige Erleichterung über die mögliche Abwendung einer weiteren Eskalation im globalen Handelskonflikt. Doch die längerfristigen wirtschaftlichen Konsequenzen bleiben ein Feld der Unsicherheit. Für Importeure und von den Zöllen betroffene Branchen könnte das Urteil eine Atempause bedeuten. Experten warnten jedoch, dass die abrupte Kehrtwende die Verhandlungsposition der USA in laufenden Gesprächen mit wichtigen Handelspartnern wie Japan, Indien und der EU schwächen könnte. Unternehmen, die ihre Lieferketten in Erwartung der Zölle bereits umgestellt hatten, stehen nun vor neuen Kalkulationen. Auch die Hoffnung, dass die Zölle Einnahmen zur Reduzierung des Haushaltsdefizits generieren oder im großen Stil Fabrikjobs zurück in die USA bringen würden, wie von Trump versprochen, erfährt durch das Urteil einen Dämpfer. Die ursprünglichen Zölle hatten bereits zuvor Sorgen vor Inflation und einer wirtschaftlichen Abkühlung geschürt.
Ausblick: Berufung, Alternativen und der Ruf nach dem Kongress
Die Trump-Administration hat umgehend Berufung gegen die Entscheidung des CIT angekündigt. Der Fall dürfte somit seinen Weg durch die Instanzen bis hin zum Obersten Gerichtshof finden. Ob die Regierung dort obsiegen wird, ist fraglich. Rechtsexperten äußerten schon früh Zweifel an der Tragfähigkeit der IEEPA-basierten Zollstrategie. Der Hauptgrund für die Wahl des IEEPA war wohl die Möglichkeit, schnell und ohne langwierige parlamentarische Zustimmung oder öffentliche Anhörungen agieren zu können.
Sollte das Urteil Bestand haben, müsste die Administration nach alternativen Wegen suchen, um ihre protektionistische Agenda zu verfolgen. Genannt werden hier beispielsweise Section 232 des Trade Expansion Act von 1962, die Zölle aus Gründen der nationalen Sicherheit erlaubt und bereits für Stahl-, Aluminium- und Autoimporte genutzt wurde, oder Section 122 des Trade Act von 1974, die temporäre Zölle von maximal 15% für 150 Tage gegen Länder mit hohen Handelsüberschüssen ermöglicht. Diese Instrumente sind jedoch an engere Voraussetzungen geknüpft, erfordern oft Untersuchungen und Konsultationen und bieten nicht die gleiche umfassende und schnelle Handhabe wie der IEEPA in Trumps Auslegung. Einige Experten bezweifeln, dass die Regierung unter anderen Gesetzen ähnlich weitreichende Zollmaßnahmen erlassen könnte.
Über die unmittelbaren handelspolitischen Verwerfungen hinaus wirft das Urteil ein Schlaglicht auf die grundlegende Frage der Gewaltenteilung in den USA. Die Verfassung weist dem Kongress die primäre Zuständigkeit für die Handelspolitik und die Erhebung von Zöllen zu. Abgeordnete wie Don Beyer forderten bereits, der Kongress müsse seine verfassungsmäßige Autorität zurückgewinnen. Die Gerichtsentscheidung könnte somit als Weckruf dienen, die in den letzten Jahrzehnten schleichend gewachsene Machtfülle der Exekutive im Bereich der Handelspolitik kritisch zu hinterfragen und neu zu justieren. Die kommenden Monate werden zeigen, ob dieses Urteil nur ein temporärer Stolperstein für eine erratische Handelspolitik war oder den Beginn einer nachhaltigen Rückbesinnung auf rechtsstaatliche Prinzipien und die Balance der Gewalten markiert.