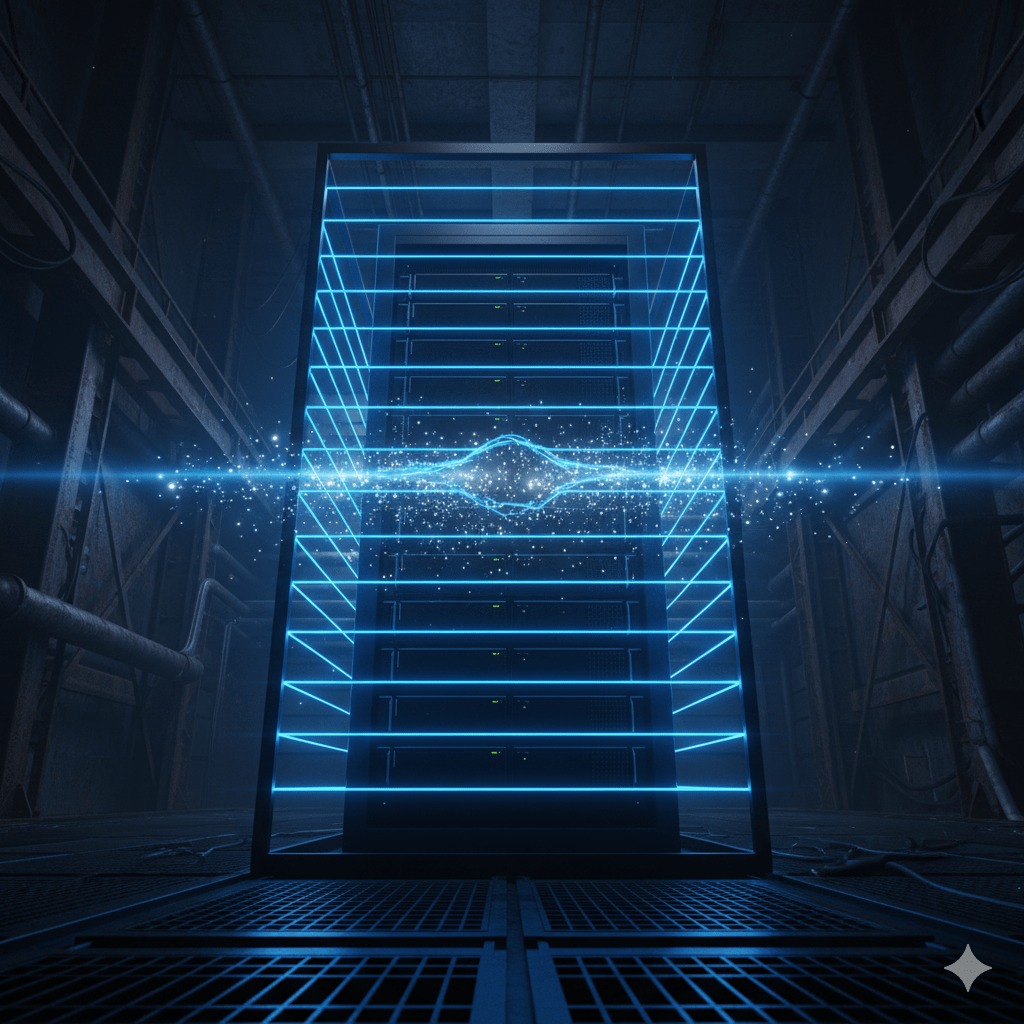Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus markiert nicht nur ein erstaunliches politisches Comeback, sondern den Beginn einer Präsidentschaft, die frühere Grenzüberschreitungen in den Schatten stellt. Seine aktuelle Amtszeit ist geprägt von einem rücksichtslosen Machtwillen, einer tiefgreifenden Verachtung für etablierte Normen und einer personalisierten Herrschaft, die Amerikas Institutionen und seine globale Rolle neu definiert – oder vielmehr deformiert. Doch während Trump glaubt, das Land und die Welt zu lenken, zeigen sich bereits Risse in der Fassade seiner vermeintlichen Allmacht.
Die politische Wiederauferstehung Donald Trumps, nur wenige Jahre nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 und einer anfänglichen Phase der Isolation, in der ihn selbst soziale Medien verbannten und Unternehmensspender mieden, gehört zu den bemerkenswertesten Phänomenen der amerikanischen Geschichte. Dieses Comeback gründete auf einer vielschichtigen Strategie: Einerseits gelang es ihm, durch die unverbrüchliche Loyalität seiner Basis und die strategische Neuausrichtung wichtiger republikanischer Figuren wie Kevin McCarthy, seine innerparteiliche Stellung zu zementieren. Andererseits nutzte Trump seine Zeit im politischen Exil, um aus Fehlern der ersten Amtszeit zu lernen. Die Auswahl absolut loyaler Mitarbeiter, allen voran Stabschefin Susie Wiles, die seine Direktiven ohne Widerspruch umsetzt, wurde zum Fundament seiner neuen Machtstruktur. Parallel dazu baute er ein alternatives Medienökosystem auf, das ihm auch ohne Twitter und Facebook eine direkte Kommunikation mit seinen Anhängern ermöglichte. Ein entscheidender Faktor war zudem seine Fähigkeit, juristische Niederlagen und sogar eine Verurteilung in 34 Anklagepunkten nicht als Schwäche, sondern als Beweis einer politischen Hexenjagd umzudeuten und so seine Anhängerschaft weiter zu mobilisieren und Spendenrekorde zu erzielen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Trump 2.0: Die entfesselte Präsidentschaft
Die aktuelle Amtsführung Trumps unterscheidet sich fundamental von seiner ersten Präsidentschaft. Wo früher noch interne Widerstände und die Unerfahrenheit seines Teams Bremsspuren hinterließen, agiert er nun mit einer Entschlossenheit, die keinen Zweifel an seinem Willen zur radikalen Umgestaltung lässt. Bereits in den ersten Tagen seiner zweiten Amtszeit überzog er das Land mit einer Flut von Exekutivanordnungen – 98 an der Zahl, davon 26 allein am ersten Tag. Diese reichten von der Begnadigung von Hunderten seiner Anhänger, die an der Erstürmung des Kapitols beteiligt waren, über die Auflösung von Diversitätsbemühungen in der Bundesregierung bis zur Entlassung unabhängiger Regulierungsbeamter und der systematischen Schwächung ganzer Behörden. Auch die Demontage von nach Watergate geschaffenen Ethik- und Antikorruptionsmechanismen sowie die direkte Einflussnahme auf das Justizministerium, das er als sein persönliches Instrument zur Verfolgung von Gegnern und zum Schutz von Verbündeten betrachtet, zeugen von einem neuen, ungehemmten Machtverständnis. Politischen Gegnern wird mit dem Entzug von Sicherheitsfreigaben gedroht oder dieser vollzogen, selbst wenn sie dadurch iranischen Morddrohungen ausgesetzt sind. Diese Präsidentschaft operiert nach dem Prinzip der Stärke, der Einschüchterung und der Beseitigung jeglicher Hindernisse, die Trumps Agenda im Wege stehen könnten. Seine Devise scheint klar: „Ich leite das Land und die Welt“.
Die Konzepte bedingungsloser persönlicher Loyalität und politischer Vergeltung sind die Eckpfeiler dieser zweiten Amtszeit. Trump hat aus seiner Sicht die Lehren aus den Jahren 2017 bis 2021 gezogen, als ihm immer wieder eigene Mitarbeiter in den Arm fielen. Nun umgibt er sich fast ausschließlich mit Personen, deren Ergebenheit außer Frage steht. Bei der Auswahl von Kabinettsmitgliedern und hochrangigen Beratern ist nicht fachliche Expertise, sondern die Vergangenheit im Sinne von Trump-Treue das entscheidende Kriterium. Wer sich ihm widersetzt oder widersetzt hat, muss mit Konsequenzen rechnen. Dies gilt für republikanische Senatoren, die bei Kabinettsnominierungen zögern und daraufhin massivem Druck aus dem Trump-Lager ausgesetzt werden, bis hin zu ehemaligen Verbündeten, die öffentlich abqualifiziert werden. Die Botschaft ist unmissverständlich: Widerstand wird nicht toleriert, Loyalität wird erwartet und Abtrünnigkeit bestraft. Er selbst mag zwar im Interview mit The Atlantic behaupten, er gehöre zu jenen, die das Land voranbringen wollen, und nicht primär auf Rache aus seien, doch seine Handlungen, wie die Anweisung an das Justizministerium, ActBlue, die Hauptspendenplattform der Demokraten, zu untersuchen, sprechen eine andere Sprache.
Die Inszenierung der Allmacht und die bröckelnde Realität
Donald Trump inszeniert sich als eine Figur von historischer Bedeutung, unbesiegbar und fähig, die Realität nach seinem Willen zu formen. „Realität, für Trump, ist formbar“, konstatieren die Journalisten von The Atlantic. Seine Anhänger bestärken ihn in dieser Sichtweise, und er selbst glaubt, dass die zahlreichen Anklagen und Verurteilungen ihn nur stärker gemacht hätten. Er brüstet sich damit, die „Wahl DREI Mal gewonnen“ zu haben, eine Behauptung, die jeder faktischen Grundlage entbehrt, aber seine Verachtung für nachprüfbare Wahrheiten unterstreicht. Die Einrichtung des Oval Office mit Goldverzierungen aus Palm Beach und die Überlegungen zu einem Kristallleuchter sind äußere Zeichen dieses Selbstbildes als eine Art Sonnenkönig. Doch hinter dieser Fassade der Unbesiegbarkeit zeigen sich erste Risse. Die chaotische Einführung neuer Zölle führte zu Verwerfungen an den Finanzmärkten und stieß selbst bei loyalen Unterstützern auf Kritik. Die „Signalgate“-Affäre, bei der versehentlich Angriffspläne auf Huthi-Ziele in einem Gruppenchat mit Journalisten landeten, ließ die Administration inkompetent erscheinen und erinnerte an das Chaos seiner ersten Amtszeit. Auch außenpolitisch erweist sich die Realität als widerspenstig: Sein Versprechen eines schnellen Friedens in der Ukraine unter russischer Ägide scheitert an Wladimir Putins Unnachgiebigkeit. Bundesgerichte beginnen erneut, seine Pläne zu blockieren, und Massenproteste nehmen zu.
Trumps Verhältnis zur Wahrheit und zu den Medien ist dabei so komplex wie eh und je. Einerseits attackiert er Journalisten und Medienhäuser unentwegt als „Feinde des Volkes“ oder Verbreiter von „Fake News“, andererseits sucht er aktiv deren Öffentlichkeit und scheint die Auseinandersetzung zu genießen, solange er glaubt, die Narrative kontrollieren zu können. Sein Beharren auf dem „gestohlenen“ Wahlsieg von 2020 ist dabei mehr als nur eine Marotte; es ist ein zentrales Element seiner politischen Identität und ein Mittel, seine Basis gegen eine vermeintlich feindliche Elite zu einen. Die Strategie im Umgang mit kritischer Berichterstattung ist oft eine Mischung aus direkter Konfrontation, dem Streuen von Desinformation über eigene Kanäle wie Truth Social und dem Versuch, durch schiere Masse an Aktionen und Äußerungen die kritische Berichterstattung zu marginalisieren oder zu ertränken.
Akteure im Schatten und die Taktik des Überwältigens
In dieser zweiten Amtszeit agieren zudem einflussreiche Figuren im direkten Umfeld Trumps, die seine Agenda maßgeblich mitgestalten. Der Unternehmer Elon Musk etwa erhielt weitreichende Befugnisse, um Teile der Bundesregierung quasi in den „Holzhäcksler“ zu werfen und deren Betriebssysteme zu kontrollieren – ein Vorgang, der trotz massiver Interessenkonflikte von Trump normalisiert wird. Berater wie Stephen Miller, bekannt für seine harte Linie in der Migrationspolitik, erhalten noch mehr Einfluss, um Trumps Versprechen einer aggressiven Abschiebepraxis umzusetzen. Diese Akteure agieren oft im Verbund mit einer gezielten Strategie des „Shock and Awe“, die bereits am ersten Tag der Amtszeit mit einer Flut an Exekutivanordnungen und den J6-Begnadigungen begann. Ziel dieser Methode ist es, so ein Berater, Medien und politische Gegner permanent im „Schleudergang“ zu halten, ihre Reaktionsfähigkeit zu lähmen und so den eigenen Handlungsspielraum maximal zu erweitern. Die schiere Menge und Geschwindigkeit der Entscheidungen macht es schwierig, einzelne Maßnahmen effektiv zu analysieren oder politischen Widerstand zu organisieren.
Ökonomischer Nationalismus als Staatsräson
Trumps radikale handelspolitische Entscheidungen, insbesondere die Einführung umfassender Zölle auf Importe aus nahezu allen Ländern, basieren auf einer tief verwurzelten ökonomischen Philosophie des Nationalismus und Protektionismus. Er sieht die USA seit Jahrzehnten von anderen Nationen, Freund wie Feind, „ausgenommen“ und glaubt, durch Zölle nicht nur die heimische Industrie zu schützen, sondern auch die Staatskasse erheblich zu füllen. Historische Vergleiche, etwa mit der amerikanischen Wirtschaftspolitik des späten 19. Jahrhunderts, dienen ihm dabei als argumentative Stütze. Die Artikel bewerten diese Argumentation jedoch als selektiv und die prognostizierten Auswirkungen als potenziell verheerend. Die Störung globaler Handelsströme, die Verunsicherung der Finanzmärkte und die Gefahr einer De-Dollarisierung werden als reale Risiken benannt. Obwohl Trump behauptet, der Aktienmarkt sei ihm bei diesen Entscheidungen nicht der primäre Ratgeber, und er sei bereit, eine wirtschaftliche Abkühlung in Kauf zu nehmen, um seine Ziele zu erreichen, mehren sich die Anzeichen für eine bevorstehende Rezession.
Amerikas Scheideweg: Demokratie unter Druck und das transatlantische Beben
Die Auswirkungen dieser Präsidentschaft auf die demokratischen Institutionen der USA sind tiefgreifend. Die systematische Untergrabung unabhängiger Behörden, die Politisierung des Justizsystems und die ständige Infragestellung demokratischer Prozesse durch den Präsidenten selbst stellen eine ernste Belastungsprobe dar. Journalisten im Umfeld von The Atlantic äußern die Sorge, dass die USA sich in Richtung Autoritarismus bewegen könnten. Auch das transatlantische Verhältnis steht unter enormem Druck. Trumps abfällige Äußerungen über traditionelle Verbündete, seine Bewunderung für autoritäre Herrscher wie Putin und seine Drohung, die NATO-Beistandspflicht in Frage zu stellen, wenn europäische Partner nicht ausreichend in Verteidigung investieren, haben tiefe Gräben gerissen. Sein Machtanspruch, „das Land und die Welt zu leiten“, kollidiert frontal mit den Prinzipien einer auf Partnerschaft und gemeinsamen Werten basierenden internationalen Ordnung. Jeffrey Goldberg, Chefredakteur von The Atlantic, sieht gar die Gefahr, dass Russland im Weißen Haus ein „offenes Ohr“ findet, eine beispiellose Entwicklung.
Ob diese zweite Amtszeit zu einer nachhaltigen Ernüchterung bei Trumps Wählern führt, bleibt abzuwarten. Die Analogie einiger seiner Anhänger, Trump sei wie eine „experimentelle Chemotherapie“ für ein todkrankes Land – schmerzhaft, vielleicht nutzlos, aber ein letzter Versuch – verdeutlicht die Verzweiflung, aus der sich seine Unterstützung speist. Doch die ersten Monate seiner zweiten Amtszeit deuten darauf hin, dass die „Nebenwirkungen“ dieser „Therapie“ – wirtschaftliche Instabilität, internationale Isolation und eine weitere Erosion demokratischer Normen – für viele Amerikaner spürbarer werden könnten, als sie es sich bei der Wahl erhofft oder befürchtet hatten. Die Frage, die sich Amerika und die Welt stellen müssen, ist, ob die von Trump entfesselten Kräfte noch beherrschbar sind oder ob seine zweite Symphonie der Zerstörung das Land und seine Allianzen nachhaltig beschädigen wird. Die Risse in der Fassade sind da, aber ob sie zum Einsturz führen, ist die offene Wunde dieser Präsidentschaft.