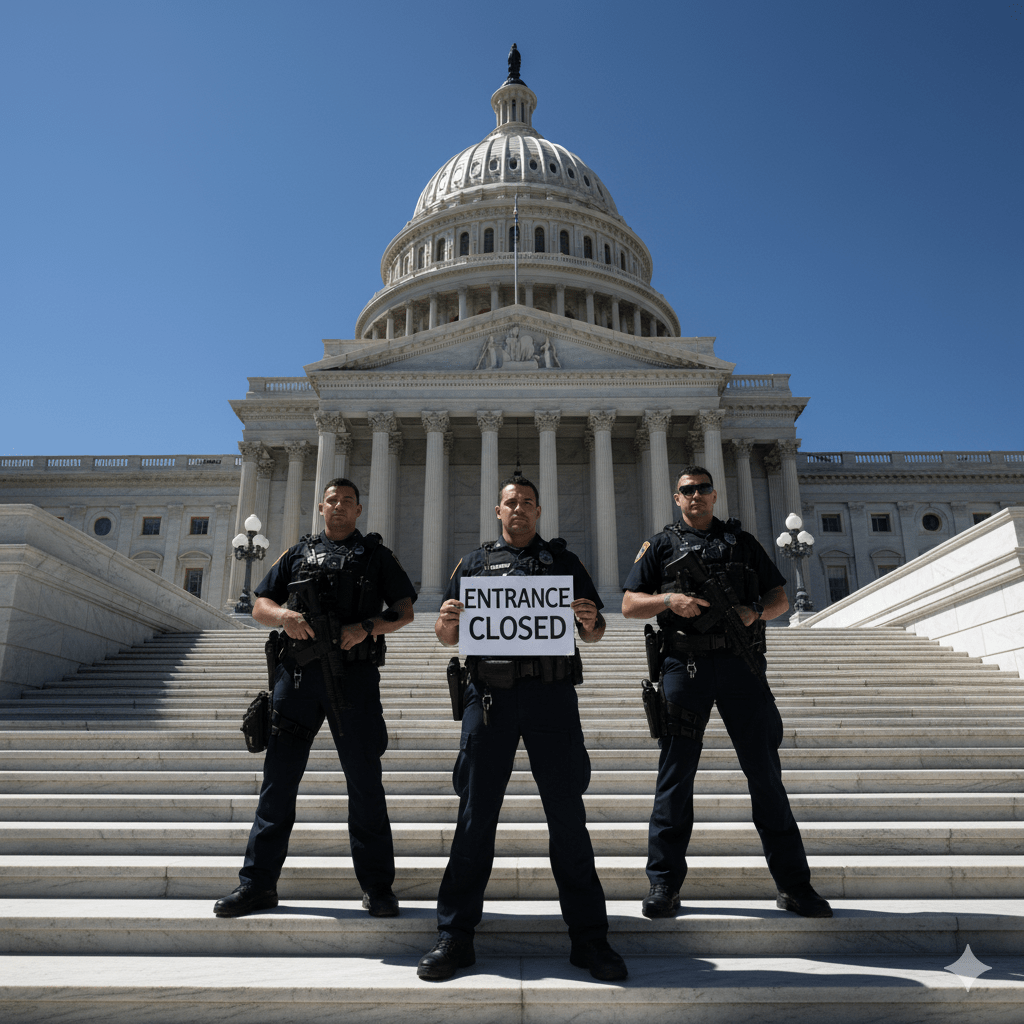Es war eine dieser Ankündigungen, die selbst im Universum Donald Trumps für Stirnrunzeln sorgten: Per Social Media ordnete der US-Präsident an, die seit über 60 Jahren geschlossene, legendenumwobene Gefängnisinsel Alcatraz wiederaufzubauen, zu erweitern und als Haftanstalt für Amerikas „skrupelloseste und gewalttätigste“ Straftäter neu zu eröffnen. Ein „Symbol für Recht, Ordnung und Gerechtigkeit“ solle „The Rock“ wieder werden, so Trump. Doch hinter der martialischen Rhetorik verbirgt sich eine Realität, die Trumps Plan nicht nur als unpraktikabel, sondern als gefährlich realitätsfern entlarvt. Die Idee, Alcatraz wiederzubeleben, ignoriert nicht nur die kolossalen Kosten und den maroden Zustand der Insel, sondern auch die tiefgreifenden Krisen im US-Strafvollzugssystem, die Trump damit zu übertünchen scheint. Es ist ein Vorstoß, der mehr über performative Politik als über ernsthafte Kriminalitätsbekämpfung aussagt.
Alcatraz: Mehr als nur ein Gefängnis – Ein Symbol wird instrumentalisiert
Alcatraz ist weit mehr als nur der Felsen in der Bucht von San Francisco, der als ausbruchsicheres Hochsicherheitsgefängnis Berühmtheit erlangte. Tatsächlich besitzt die Insel eine vielschichtige, oft düstere Geschichte. Lange bevor Al Capone oder George „Machine Gun“ Kelly hier ihre Strafen absaßen, diente die Insel unter Präsident Millard Fillmore ab 1850 militärischen Zwecken, befestigt mit über 100 Kanonen als Teil eines Verteidigungsdreiecks. Sie beherbergte den ersten Leuchtturm an der US-Westküste (1854) und fungierte im Sezessionskrieg als Lager für konföderierte Kriegsgefangene.
Doch die Geschichte der Inhaftierung auf Alcatraz begann früher und brutaler als oft erinnert: Schon um die Jahrhundertwende wurden hier indigene Amerikaner eingesperrt, darunter 19 Hopi, die sich der Zwangassimilation ihrer Kinder widersetzten. Im Ersten Weltkrieg folgten Kriegsdienstverweigerer, wo Berichte von entsetzlichen Bedingungen in dunklen, rattenverseuchten Verliesen zeugen. Erst 1934 wurde Alcatraz zum Bundesgefängnis für jene „Unverbesserlichen“, die in anderen Anstalten als zu schwierig galten – oft, weil sie Wärter oder Mitinsassen getötet hatten.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Diese brutale Vergangenheit als Bundesgefängnis (1934-1963) prägt das Bild bis heute, verstärkt durch Hollywood-Mythen. Doch auch nach der Schließung blieb Alcatraz ein symbolisch aufgeladener Ort: Von 1969 bis 1971 besetzten Aktivisten verschiedener indigener Stämme die Insel, forderten sie als Land für alle Stämme und machten sie zum Ausgangspunkt einer neuen Ära indigenen Protests gegen die Bundespolitik. Erst danach wurde Alcatraz zur Touristenattraktion und zum National Historic Landmark unter der Verwaltung des National Park Service, jährlich besucht von über einer Million Menschen und zugleich ein wichtiges Vogelschutzgebiet.
Trump ignoriert diese Komplexität. Er reduziert Alcatraz auf das simple Narrativ des ultimativen Knasts, ein Symbol der Stärke einer vermeintlich „ernsthafteren Nation“. Er instrumentalisiert den Mythos, um seine eigene „Law and Order“-Agenda zu unterstreichen, und blendet dabei sowohl die tatsächlichen Gründe für die Schließung als auch die späteren, emanzipatorischen Kapitel der Inselgeschichte aus. Die Berufung auf die Vergangenheit wird zur selektiven Geschichtsklitterung für politische Zwecke.
Der Fels zerbröckelt: Die unüberwindbaren Hürden einer Wiedereröffnung
Die Idee einer Wiedereröffnung scheitert krachend an den harten Fakten. Alcatraz wurde 1963 nicht aus Mangel an Härte geschlossen, sondern weil der Betrieb schlichtweg untragbar teuer und die Substanz marode war. Schon damals wurden die täglichen Kosten pro Häftling auf mehr als das Dreifache einer vergleichbaren Anstalt in Atlanta beziffert. Alles – von Lebensmitteln über Treibstoff bis hin zum Trinkwasser (fast eine Million Gallonen pro Woche) – musste per Schiff auf die isolierte Insel gebracht werden. Die Bausubstanz litt massiv unter dem Salzwasserfraß; bereits 1962 schätzte man den Sanierungsbedarf auf 3 bis 5 Millionen Dollar (heute etwa 53 Millionen Dollar, ohne Berücksichtigung moderner Standards).
Heute, über 60 Jahre später, ist der Zustand katastrophal. Alcatraz wird heute als „stabilisierte Ruine“ beschrieben. Gebäude verfallen, haben keine Dächer oder intakten Wände mehr. Zellen haben zerbrochene Toiletten ohne Wasseranschluss. Die Außenmauern der Zellentrakte sind so brüchig, dass sie mit Netzen gesichert werden müssen, um herabfallenden Beton aufzufangen. Es gibt keine funktionierende Wasser-, Abwasser- oder Stromleitung vom Festland. Die Abwässer wurden früher direkt in die Bucht geleitet – heute ein klarer Verstoß gegen Umweltgesetze. Eine moderne Kläranlage wäre nötig, Strom müsste aufwendig erzeugt oder per Seekabel herangeführt werden.
Experten und Historiker, wie der ehemalige Ranger John A. Martini, bezeichnen eine Wiederinbetriebnahme als „astronomisch teuer“ und „außerordentlich schwierig“. Die Rede ist von hunderten Millionen Dollar. Hinzu kommen immense bürokratische Hürden: Alcatraz ist ein National Historic Landmark und Teil der Golden Gate National Recreation Area unter Verwaltung des National Park Service. Eine Rückumwandlung in ein Gefängnis würde wohl ein Bundesgesetz und einen komplexen interinstitutionellen Kampf erfordern – ironischerweise genau die Art von Bürokratie, die Trump zu bekämpfen vorgibt. Die Insel ist zudem ein wichtiges Nistgebiet für Seevögel, was weitere naturschutzrechtliche Konflikte birgt.

Symbolpolitik trifft Systemversagen: Alcatraz als Ablenkung von der BOP-Krise
Die Realität der Bundesgefängnisbehörde (BOP) steht dazu im scharfen Kontrast: Chronische Unterbesetzung (über 4.000 offene Stellen), ein Sanierungsstau von 3 Milliarden Dollar, bröckelnde Infrastruktur, die zur Schließung von Tausenden Betten führt, weitverbreitete Gewalt, Schmuggel und Korruption unter Mitarbeitern prägen das Bild. Allein in den knapp zwei Monaten vor Trumps Ankündigung starben elf Insassen in Bundeshaft, teils durch Gewalt, teils durch Suizid unter ungeklärten Umständen.
AP-Recherchen deckten massive Missstände auf, von Dutzenden Ausbrüchen über ungehinderten Drogenfluss bis hin zu systemischem sexuellem Missbrauch in Frauengefängnissen wie dem inzwischen geschlossenen FCI Dublin, nur wenige Meilen von Alcatraz entfernt. Das BOP schloss kürzlich mehrere Einrichtungen wegen Personalmangels und maroder Substanz. Gleichzeitig wurde die Behörde unter Trump neu ausgerichtet, um Tausende von Einwanderungshäftlingen aufzunehmen, was die Ressourcen weiter strapaziert.
Vor diesem Hintergrund wirkt Trumps Befehl, Hunderte Millionen in die Wiederbelebung einer längst aufgegebenen, logistisch extrem aufwendigen Inselruine zu stecken, geradezu absurd. Es erscheint als Versuch, mit einem potenten Symbol von den tatsächlichen, tiefgreifenden und kostspieligen Problemen des Systems abzulenken, für deren Lösung er keine überzeugenden Konzepte präsentiert. Statt die realen Baustellen anzugehen, wird eine neue, noch teurere aufgemacht – rein aus symbolischen Gründen. Der neu ernannte BOP-Direktor William K. Marshall III versicherte zwar umgehend, die Anweisung des Präsidenten „energisch zu verfolgen“ und eine Prüfung einzuleiten, doch die Diskrepanz zur Realität bleibt eklatant.
Von Hollywood inspiriert? Der Mythos Alcatraz und Trumps Motivation
Die Faszination für Alcatraz speist sich nicht nur aus seiner realen Geschichte, sondern maßgeblich aus seiner medialen Inszenierung. Filme wie „Der Gefangene von Alcatraz“ (1962), „Flucht von Alcatraz“ (1979) mit Clint Eastwood oder der Action-Blockbuster „The Rock“ (1996) haben den Mythos des uneinnehmbaren, brutalen Felsens weltweit zementiert. Hartnäckig hält sich die Spekulation, dass Trump selbst von diesen Mythen beeinflusst sein könnte. Konkret wird berichtet, dass der Film „Flucht von Alcatraz“ just am Wochenende vor Trumps Ankündigung im Fernsehen in Südflorida lief, wo Trump sich aufhielt. Kommentatoren auf Social Media spotteten, ob der Präsident seine Politik nun beim Zappen auf dem Sofa entwickle.
Trump selbst befeuerte diese Lesart, indem er in Erklärungen auf die Film-Lore Bezug nahm – etwa auf die (falsche) Behauptung, niemand sei je entkommen, oder die Geschichte von angeblichen Hai-Angriffen auf Flüchtige. Seine Beschreibung der Insel als Ort, der „sowohl schrecklich als auch schön und stark und elend, schwach“ sei, klingt eher nach einer Filmkritik als nach einer politischen Analyse. Ob nun direkt vom Film inspiriert oder nicht – Trumps Alcatraz-Vorstoß bedient sich der Dramaturgie und der einfachen Narrative Hollywoods: der Kampf Gut gegen Böse, die Notwendigkeit ultimativer Härte gegen das absolut Böse, symbolisiert durch einen ikonischen Ort. Diese Vereinfachung verfängt möglicherweise bei seiner Basis, ignoriert aber jede reale Komplexität.
„Nicht ernsthaft“: Politik als Spektakel und die Reaktionen
Die Reaktionen auf Trumps Plan fielen erwartungsgemäß überwiegend kritisch bis spöttisch aus. Kalifornische Politiker wie die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi (deren Wahlkreis Alcatraz umfasst), Senator Scott Wiener („häuslicher Gulag“) oder der Sprecher von Gouverneur Gavin Newsom wiesen den Vorschlag als „nicht seriös“, „absurd“ oder reines „Ablenkungsmanöver“ zurück. Kommentatoren in Zeitungen und sozialen Medien zerpflückten die Idee wegen ihrer offensichtlichen Unpraktikabilität und der horrenden Kosten. Viele schlugen sarkastisch vor, Trump selbst solle der erste Insasse sein. Selbst Touristen vor Ort äußerten Unglauben und bezeichneten die Idee als „Witz“ oder Ausdruck von Trumps „unberechenbarem Verhalten“.
Die Ankündigung reiht sich ein in eine Serie weiterer provokanter Maßnahmen und Äußerungen Trumps aus derselben Zeit: die Androhung von 100%-Zöllen auf ausländische Filme (die er ebenfalls mit dem Schutz der nationalen Sicherheit und der Rettung einer „sterbenden“ Industrie begründete), das Angebot von Geldzahlungen für „Selbstdeportationen“ illegalisierter Einwanderer, die Infragestellung verfassungsmäßiger Rechte für Nicht-Bürger, die mögliche Ernennung des Hardliners Stephen Miller zum Nationalen Sicherheitsberater, Angriffe auf Kanadas Premier oder die mexikanische Präsidentin. Dieses Muster legt nahe, dass es Trump weniger um konkrete, durchdachte Politik als um kontinuierliche Provokation, das Setzen von Symbolen und das Beherrschen der Schlagzeilen geht – klassisches politisches Theater.
Fazit: Ein Denkmal der Vergangenheit, kein Gefängnis der Zukunft
Die Wahrscheinlichkeit, dass Alcatraz tatsächlich wieder zu einem Hochsicherheitsgefängnis wird, tendiert gegen Null. Die praktischen, finanziellen und juristischen Hürden sind immens, der politische Wille außerhalb des Weißen Hauses nicht vorhanden und die dahinterstehende Logik ignoriert sämtliche Lehren aus der Geschichte der Insel sowie die aktuellen Realitäten des US-Strafvollzugs.
Trumps Vorstoß ist somit vor allem eines: ein weiteres Beispiel für seine Politik des Symbols über der Substanz. Er nutzt den potenten Mythos von Alcatraz, um sich als starker Mann zu inszenieren, der mit vermeintlich einfachen Lösungen auf komplexe Probleme reagiert. Doch der Felsen in der Bucht von San Francisco ist und bleibt wohl eher das, was er seit Jahrzehnten ist: ein faszinierendes, aber verfallendes Denkmal einer vergangenen Ära, ein Mahnmal für die Brutalität des Strafvollzugs, ein Ort indigenen Protests und eine millionenfach besuchte Touristenattraktion. Als Symbol wird Alcatraz fortbestehen – aber nicht als jenes für Trumps „Recht und Ordnung“, sondern als vielschichtiges Zeugnis amerikanischer Geschichte, dessen Zukunft eher im Bewahren als im martialischen Wiederaufbau liegt. Die eigentlichen Baustellen des US-Justizsystems bleiben derweil unangetastet.