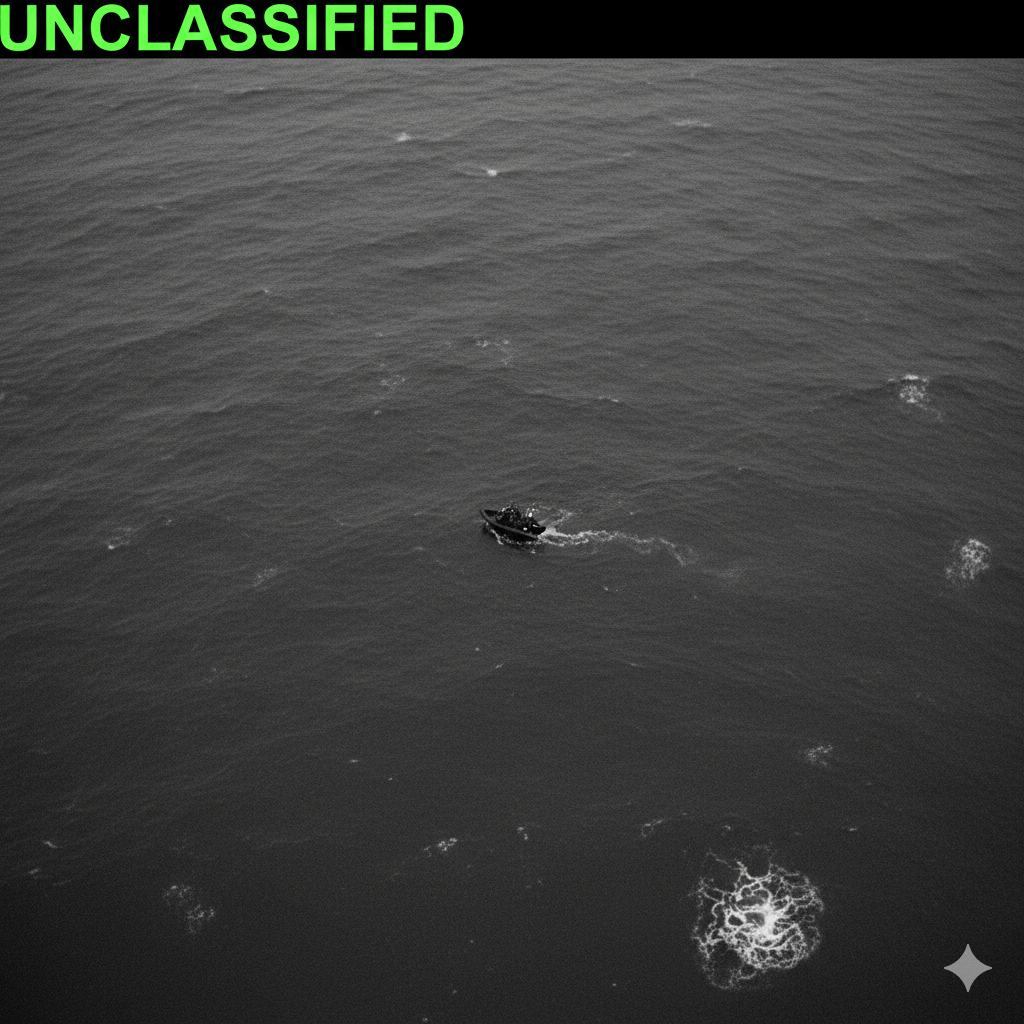Die Anordnung kam per Dekret, unmissverständlich und mit weitreichenden Implikationen: Die Trump-Regierung will den Geldhahn für die beiden wichtigsten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der USA, National Public Radio (NPR) und Public Broadcasting Service (PBS), zudrehen. Was auf den ersten Blick wie eine weitere Maßnahme zur Sanierung des Haushalts wirken mag, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als ein tiefgreifender, politisch motivierter Angriff auf unabhängige Medien und eine Eskalation in einem seit langem schwelenden Kulturkampf. Es ist ein Manöver, das weit über fiskalische Erwägungen hinausgeht und Fragen zur Zukunft der Pressefreiheit und des Informationszugangs in den Vereinigten Staaten aufwirft.
Die Anklagebank: Voreingenommenheit, Propaganda und verschwendete Steuergelder?
Die offizielle Begründung aus dem Weißen Haus liest sich wie eine Generalabrechnung. NPR und PBS werden als parteiisch, voreingenommen und als Verbreiter linker Propaganda gebrandmarkt. Man wirft ihnen vor, Steuergelder zu missbrauchen, um „radikale, woke“ Inhalte zu fördern, die als Nachrichten getarnt seien. Konkrete Beispiele sollen diese Vorwürfe untermauern: Eine Analyse der Sendung „PBS News Hour“ habe ergeben, dass der Begriff „Rechtsextreme“ unverhältnismäßig häufiger verwendet werde als „Linksextreme“. Auch eine Studie, die eine negativere Berichterstattung über republikanische Kongressabgeordnete im Vergleich zu Demokraten belegt haben soll, wird ins Feld geführt.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die Kritik gipfelte in einer Kongressanhörung unter dem vielsagenden Titel „Anti-American Airwaves“, geleitet von der Trump-nahen Abgeordneten Marjorie Taylor Greene. Hier wurden die Sender als „linksradikale Echokammern“ bezeichnet, Vorwürfe zur Berichterstattung über die angebliche Russland-Kollaboration Trumps und den Laptop von Hunter Biden erhoben sowie die Ausstrahlung von Inhalten mit Drag Queens als Indoktrination von Kindern kritisiert. Selbst ein kritischer Essay eines ehemaligen NPR-Redakteurs über eine vermeintlich verloren gegangene „offene Kultur“ des Senders wird von den Kritikern instrumentalisiert.
Darüber hinaus argumentiert die Regierung, das Modell der staatlichen Medienfinanzierung sei im heutigen „reichen, diversen und innovativen“ Medienumfeld schlicht überholt und unnötig – ein Relikt aus dem Gründungsjahr der zuständigen Corporation for Public Broadcasting (CPB) 1967. Die Finanzierung untergrabe zudem den Anschein journalistischer Unabhängigkeit.
Sparzwang als Vorwand? Der Angriff im Kontext von Budget-Krieg und Kulturkampf
Die Stoßrichtung gegen NPR und PBS fügt sich nahtlos in ein größeres Muster der Trump-Regierung ein. Zum einen ist sie Teil eines umfassenden Plans, die Bundesausgaben drastisch zu kürzen und die Regierung zu verkleinern. Bereiche wie Umwelt, erneuerbare Energien, Bildung und Auslandshilfe sollen massive Einschnitte von über 160 Milliarden Dollar erfahren. Unterstützt wird dieser Schrumpfkurs durch die von Milliardär Elon Musk geleitete Effizienzbehörde DOGE, deren Methoden allerdings rechtlich umstritten sind. Musk selbst hat Einsparungen in dreistelliger Milliardenhöhe versprochen.
Gleichzeitig plant die Regierung jedoch eine massive Aufstockung des Verteidigungs- und nationalen Sicherheitsbudgets auf über eine Billion Dollar, was das Argument der reinen Sparmaßnahme konterkariert. Vielmehr scheint die Streichung der Mittel für NPR und PBS Teil einer Strategie zu sein, unliebsame Institutionen finanziell unter Druck zu setzen. Dies reiht sich ein in frühere Angriffe auf traditionelle Medien, die von Trump regelmäßig als „Fake News Media“ diffamiert werden, sowie konkrete Maßnahmen wie den Ausschluss der Associated Press aus dem Pressepool des Weißen Hauses oder die Demontage des Auslandssenders Voice of America.
Die Auseinandersetzung ist auch keine neue Entwicklung. Der Vorwurf der Linkslastigkeit gegen NPR und PBS ist seit Jahrzehnten ein wiederkehrendes Motiv konservativer Kritik. Schon in den 1960er, 1990er (unter Newt Gingrich) und während der Präsidentschaft George W. Bushs gab es Versuche, die Finanzierung zu beschneiden oder ganz zu streichen. Bisher scheiterten diese meist am Widerstand im Kongress, auch weil Programme wie die „Sesamstraße“ populär sind und selbst republikanische Abgeordnete aus ländlichen Regionen den Wert der Sender für ihre Wähler erkannten. Mit republikanischen Mehrheiten in beiden Kammern könnten die Erfolgsaussichten für Trumps Vorstoß diesmal jedoch anders aussehen.
Die drohenden Folgen: Ein Informationsvakuum vor allem auf dem Land?
Die Auswirkungen eines vollständigen Finanzierungsstopps wären nach Einschätzung der Betroffenen und Beobachter gravierend. Obwohl die direkten Bundeszuschüsse nur einen relativ kleinen Teil der Gesamtbudgets von NPR (unter 5% laut NPR-Chefin, teils als 1% beziffert) und PBS (ca. 15-16%) ausmachen, ist die Situation komplexer. Die CPB, die jährlich über 500 Millionen Dollar an Bundesmitteln verteilt, leitet den Großteil an über 1500 lokale Mitgliedsstationen weiter. Diese lokalen Sender, die durchschnittlich 8-10% (NPR-Affiliates) oder mehr ihrer Mittel von der CPB erhalten, nutzen das Geld für eigene Produktionen oder zum Einkauf von Programmen bei NPR und PBS.
Ein Wegfall dieser Gelder träfe daher vor allem die lokalen Stationen hart. Experten warnen, dass dies insbesondere in ländlichen und abgelegenen Gebieten, wo kommerzielle Sender oft nicht rentabel arbeiten, zu einem Informationsvakuum führen könnte. Gerade dort sind die Sender oft unverzichtbar für lokale Nachrichten, Wetterwarnungen und Informationen im Katastrophenfall. Eine interne NPR-Analyse von 2011 prognostizierte bei einem Finanzierungsstopp die Schließung von bis zu 18% der Stationen und den Verlust des Zugangs für rund 30% der Hörer, vor allem im Mittleren Westen, Süden und Westen. Paradoxerweise könnten also gerade jene ländlichen Regionen, die oft als konservative Hochburgen gelten, am stärksten unter den Kürzungen leiden.
Verteidigungslinien: Zwischen Unabhängigkeitsbeteuerung und rechtlichen Manövern
Die Führungsetagen von NPR und PBS weisen die Vorwürfe der Voreingenommenheit zurück und betonen ihre redaktionelle Unabhängigkeit sowie die Bedeutung ihrer Programme für Millionen von Amerikanern. PBS-Chefin Paula Kerger hob die Rolle bei der Berichterstattung über lokale Ereignisse und als vertrauenswürdige Informationsquelle hervor. Man lege Wert auf vielfältige Standpunkte. NPR-Chefin Katherine Maher räumte zwar Fehler bei der Berichterstattung zum Hunter-Biden-Laptop ein und bedauerte frühere persönliche Tweets über Trump, verteidigte aber grundsätzlich den Anspruch auf unparteiische, faktenbasierte Berichterstattung. Beide verweisen auf das hohe Vertrauen, das der öffentliche Rundfunk laut Umfragen genießt – 60% der Amerikaner vertrauen ihm – und darauf, dass laut Pew Research nur eine Minderheit (24%) für eine Streichung der Gelder ist, während 43% sie beibehalten wollen.
Unterstützung kommt auch von Organisationen wie Reporter ohne Grenzen, die eine „besorgniserregende Verschlechterung“ der Pressefreiheit in den USA beklagen.
Rechtlich steht die Anordnung der Regierung auf wackligen Füßen. Da der Kongress die Budgethoheit hat und die Mittel für die CPB bereits bis 2027 bewilligt sind, ist die unmittelbare Wirksamkeit des Dekrets fraglich. Die Regierung plant zwar, den Kongress formal um eine Rücknahme („Rescission“) bereits bewilligter Mittel in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar zu bitten, doch dieser müsste dem innerhalb von 45 Tagen zustimmen. Zudem hat die CPB selbst die Regierung verklagt, nachdem diese versucht hatte, Vorstandsmitglieder zu entlassen. Die CPB argumentiert, sie sei als private Non-Profit-Organisation keine Bundesbehörde und unterliege daher nicht der direkten Weisungsbefugnis des Präsidenten. Es ist daher wahrscheinlich, dass auch das Finanzierungsdekret gerichtlich angefochten wird.
Letztlich offenbart der Vorstoß gegen NPR und PBS die tiefen Gräben in der amerikanischen Gesellschaft und Medienlandschaft. Er ist mehr als nur ein budgetpolitischer Schachzug; er ist ein Symptom einer Regierung, die kritische Berichterstattung als Angriff empfindet und bereit scheint, langjährige Institutionen des öffentlichen Diskurses im Namen politischer Opportunität zu opfern. Ob dieser Angriff erfolgreich sein wird, hängt nun von den Gerichten, dem Kongress und letztlich auch vom Willen der amerikanischen Öffentlichkeit ab, für ihre Informationsquellen einzustehen.