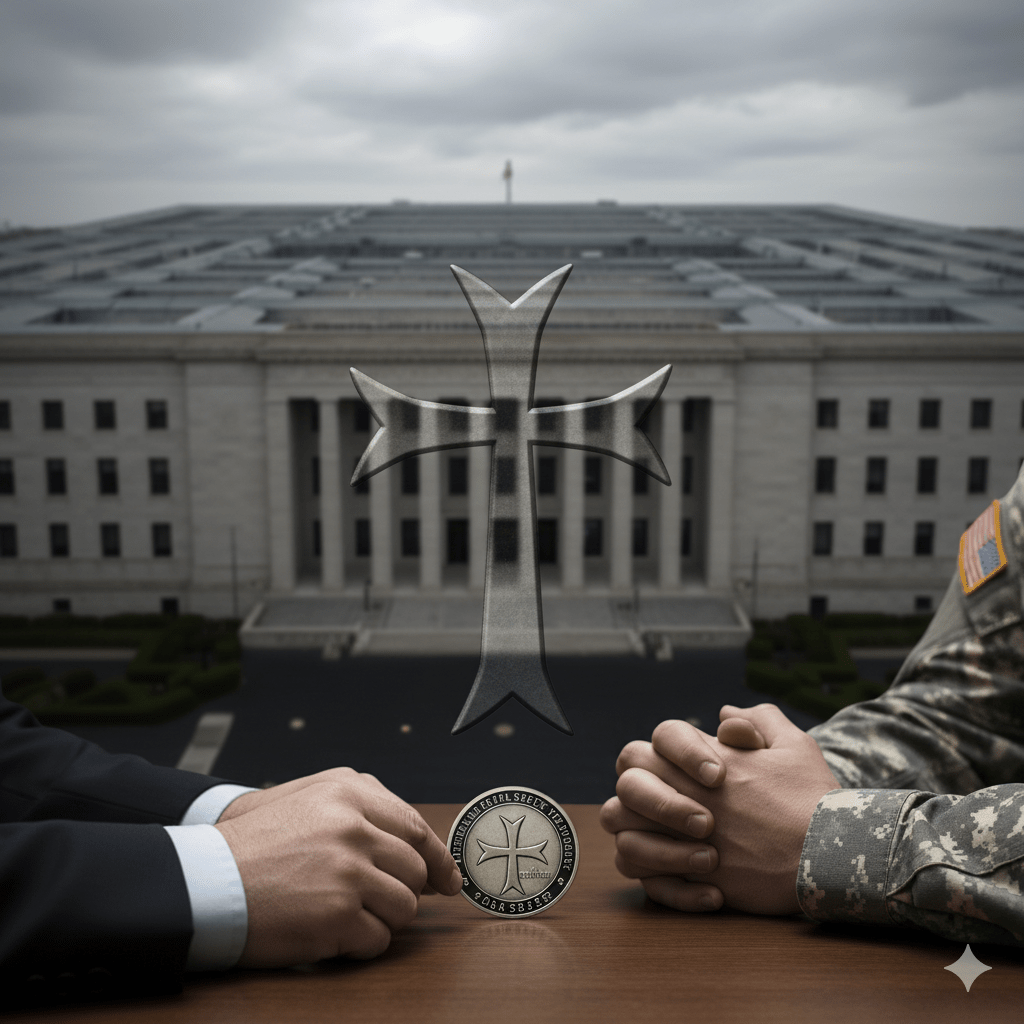Die Nachricht schlug ein wie ein weiterer Paukenschlag aus dem Weißen Haus unter Donald Trump: Michael Waltz, der erst vor wenigen Monaten angetretene Nationale Sicherheitsberater, muss seinen Posten räumen. Zwar wird der Abgang durch die zeitgleiche Nominierung zum UN-Botschafter kaschiert, doch dieser „sanfte Rauswurf“ kann nicht über die tieferliegenden Turbulenzen hinwegtäuschen. Der Fall Waltz ist weit mehr als eine bloße Personalrochade; er ist ein Brennglas, das die internen Machtkämpfe, die ideologischen Verwerfungslinien und den oft laxen Umgang mit nationalen Sicherheitsfragen in der zweiten Trump-Administration beleuchtet. Die Affäre offenbart eine Regierung, die zwar nach außen hin versucht, das offene Chaos der ersten Amtszeit zu vermeiden, intern jedoch von denselben Kräften getrieben wird: Loyalitätsdruck, Fraktionskämpfe und eine beunruhigende Geringschätzung etablierter Prozesse.
Die Chat-Affäre: Symptom oder Ursache?
Vordergründig stolperte Waltz über die sogenannte „Signal-Affäre“. Im März organisierte er einen Gruppenchat über die kommerzielle Messaging-App Signal, um mit anderen hochrangigen Regierungsmitgliedern – darunter Vizepräsident J.D. Vance und Verteidigungsminister Pete Hegseth – einen bevorstehenden Militärschlag gegen Huthi-Milizen im Jemen zu besprechen. Das allein sorgte bereits für Stirnrunzeln in Sicherheitskreisen: Die Nutzung einer nicht-staatlich kontrollierten App für potenziell geheime Kriegspläne widerspricht gängigen professionellen Standards. Vollends zur Blamage wurde die Angelegenheit, als bekannt wurde, dass Waltz versehentlich Jeffrey Goldberg, den Chefredakteur des Magazins „The Atlantic“ und erklärten Trump-Kritiker, zu diesem Chat hinzugefügt hatte. Goldberg machte die Kommunikation publik, was der Regierung höchst unliebsame Schlagzeilen bescherte.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Die Reaktionen auf diesen Vorfall waren gespalten. Das Weiße Haus und Waltz selbst versuchten, die Angelegenheit herunterzuspielen, bestritten, dass klassifizierte Informationen geteilt wurden, und bezeichneten die Nutzung von Signal – zumindest einer modifizierten, archivierenden Version namens „TM SGNL“ – als für Regierungsmitarbeiter genehmigt. Waltz‘ Erklärungsversuche, wie die Nummer des Journalisten in sein Telefon gelangt sei, wirkten unbeholfen und wenig überzeugend. Er sprach davon, die Nummer sei womöglich „eingesaugt“ worden und bezeichnete Goldberg als „Abschaum“, den er nie getroffen habe – Behauptungen, die Goldberg umgehend dementierte.
Demokraten und zahlreiche Sicherheitsexperten hingegen zeigten sich entsetzt über die offensichtliche Fahrlässigkeit im Umgang mit sensiblen Daten. Sie warfen Waltz „Inkompetenz“ vor und sahen die nationale Sicherheit gefährdet. Screenshots des Chats, die später auftauchten, zeigten detaillierte Informationen über den Militärschlag, inklusive Startzeiten von Kampfjets, was die Behauptung, es seien keine geheimen Informationen ausgetauscht worden, weiter in Zweifel zog. Die Kritik richtete sich dabei nicht nur gegen Waltz, sondern auch massiv gegen Verteidigungsminister Hegseth, der nicht nur im Chat Details preisgab, sondern laut Medienberichten auch seine Frau und seinen Bruder über einen weiteren Signal-Chat informiert haben soll. Viele Demokraten, wie etwa Senatorin Tammy Duckworth, forderten daher nicht nur die Entlassung von Waltz, sondern vor allem auch die von Hegseth, den sie als größeres Sicherheitsrisiko einstuften. Dass Trump Hegseth jedoch kurz nach Waltz‘ Abberufung öffentlich für dessen „fantastische“ Arbeit lobte, unterstreicht die selektive Wahrnehmung von Fehlverhalten im Trump-Universum. Die Tatsache, dass Waltz selbst noch am Tag vor seiner Entlassung bei einer Kabinettssitzung dabei fotografiert wurde, wie er die modifizierte Signal-App nutzte, verstärkte den Eindruck eines nonchalanten Umgangs mit Sicherheitsrisiken, auch wenn das Weiße Haus erneut auf die Zulässigkeit der App verwies.
Machtkampf im Weißen Haus: Falken gegen Isolationisten
Die Signal-Affäre mag der unmittelbare Auslöser für Waltz‘ Abgang gewesen sein, doch die Wurzeln seiner prekären Position reichen tiefer. Bereits seit Monaten stand er auf dünnem Eis. In den Augen vieler Trump-Berater und der MAGA-Basis galt der ehemalige Green Beret und Kongressabgeordnete als zu sehr „Falke“, als zu traditionell republikanisch in seiner außenpolitischen Haltung. Seine harte Linie gegenüber Russland und Iran sowie seine Skepsis gegenüber einem schnellen Abkommen mit Teheran standen im Kontrast zu Trumps Wahlkampfversprechen, amerikanische Interventionen im Ausland zurückzufahren und Beziehungen zu traditionellen Gegnern wie Russland zu normalisieren. Waltz‘ Eintreten für eine Verschärfung der Russland-Sanktionen und seine frühere Opposition gegen den Afghanistan-Abzug passten nicht ins Bild des von Trump gewünschten Kurses.
Sein Sturz wird daher auch als Ergebnis eines schwelenden Machtkampfes innerhalb der Administration interpretiert. Dieser Konflikt wird oft vereinfachend als Kampf zwischen „Neocons“ (wie Waltz) und „Neo-Isolationisten“ (verbunden mit Vizepräsident J.D. Vance) beschrieben. Eine weitere einflussreiche Gruppe sind die sogenannten „Oligarchen“ – milliardenschwere Freunde Trumps wie Steve Witkoff, der als Sondergesandter für heikle Verhandlungen mit Russland und Iran eingesetzt wurde, obwohl ihm erfahrene Diplomaten die Eignung absprechen. Waltz, der eher dem traditionellen republikanischen Establishment zugerechnet wird, schien in diesem Gefüge von Anfang an einen schweren Stand gehabt zu haben. Die Chemie zwischen dem disziplinierten Ex-Militär und dem sprunghaften Präsidenten stimmte offenbar nicht.
Zusätzlichen Druck erzeugten externe Akteure der radikalen Rechten. Die Influencerin Laura Loomer etwa intervenierte erfolgreich bei Trump und erreichte die Entlassung mehrerer Mitarbeiter aus Waltz‘ Team im Nationalen Sicherheitsrat (NSC), denen sie Illoyalität und eine zu große Nähe zu demokratischen Regierungen oder „neokonservativen“ Kreisen vorwarf. Auch Waltz‘ Stellvertreter Alex Wong, ein erfahrener Sicherheitsexperte, der aber als moderater galt und in Trumps erster Amtszeit für Nordkorea zuständig war, wurde ins Visier genommen und musste ebenfalls gehen. Diese Vorgänge verdeutlichen, wie sehr Personalentscheidungen im Weißen Haus von externem Druck aus dem MAGA-Umfeld und von Loyalitätsbekundungen gegenüber Trump persönlich beeinflusst werden – oft zulasten von Fachexpertise oder etablierten Sicherheitsstrukturen.
Rubios Aufstieg und die Bürde multipler Ämter
Die Ernennung von Außenminister Marco Rubio zum Interims-Nachfolger von Waltz ist ein weiterer bemerkenswerter Aspekt dieser Rochade. Rubio, der 2016 noch ein scharfer Rivale Trumps war, hat sich offenbar das Vertrauen des Präsidenten erarbeitet – durch Unterwürfigkeit, unbedingte Unterstützung und häufige Wochenendbesuche, wie Insider berichten. Mit der Übernahme des Nationalen Sicherheitsberater-Postens zusätzlich zu seinen Aufgaben als Außenminister, kommissarischer Leiter der weitgehend demontierten Entwicklungshilfebehörde USAID und kommissarischer Leiter des Nationalarchivs hält Rubio nun vier Schlüsselpositionen inne.
Diese Ämterhäufung ist historisch fast beispiellos in der US-Regierung. Zuletzt vereinte Henry Kissinger unter Nixon und Ford kurzzeitig die Rollen des Außenministers und des Nationalen Sicherheitsberaters – ein Experiment, das von Historikern überwiegend als gescheitert betrachtet wird, da der Sicherheitsberater eigentlich als neutraler Makler zwischen verschiedenen Ressorts (Außenministerium, Pentagon, Geheimdienste) fungieren soll. Die Konzentration so vieler Ämter in einer Person wirft erhebliche Fragen bezüglich der Effektivität und möglicher Interessenkonflikte auf. Wie soll Rubio die komplexen Aufgaben aller vier Behörden bewältigen, insbesondere unter einem Präsidenten, der traditionelle Regierungsstrukturen oft ignoriert? Die Tatsache, dass selbst Rubios eigene Sprecherin im Außenministerium von seiner Ernennung zum Sicherheitsberater erst durch Journalisten während einer Pressekonferenz erfuhr, spricht Bände über die ad-hoc und oft chaotisch anmutende Entscheidungsfindung im Weißen Haus.
Der UN-Posten: Degradierung auf Raten?
Für Michael Waltz selbst stellt die Nominierung zum UN-Botschafter zwar einen Ausweg dar, der ihm einen völligen Gesichtsverlust erspart – anders als bei vielen geschassten Mitarbeitern aus Trumps erster Amtszeit. Der Posten hat Kabinettsrang und ist traditionell prestigeträchtig. Doch in der Welt Donald Trumps, der die Vereinten Nationen wiederholt als ineffektive Zeit- und Geldverschwendung abgetan hat, ist die Bedeutung dieses Amtes relativ gering. Dass der Posten seit Trumps Amtsantritt vakant war, nachdem die ursprünglich vorgesehene Kandidatin Elise Stefanik aus parteitaktischen Gründen zurückgezogen wurde, unterstreicht diese Einschätzung. Viele Beobachter werten die Versetzung nach New York daher als klare Degradierung – eine „Strafversetzung“ weit weg vom Machtzentrum Washington, die gleichzeitig eine personelle Lücke füllt. Vizepräsident Vance versuchte zwar, die Personalie als „Beförderung“ darzustellen, doch dies wirkt wenig glaubhaft. Waltz mag zwar formal im Kabinett bleiben, doch sein Einfluss auf die Gestaltung der US-Außenpolitik dürfte marginalisiert werden.
Ausblick: Ein steiniger Weg im Senat
Bevor Waltz jedoch seinen neuen Posten antreten kann, muss er eine weitere Hürde nehmen: die Bestätigung durch den US-Senat. Zwar verfügen die Republikaner dort über eine knappe Mehrheit, doch die Anhörungen vor dem Auswärtigen Ausschuss dürften für Waltz zu einem Spießrutenlauf werden. Die Demokraten haben bereits angekündigt, ihn „gründlich“ und mit „spitzen Fragen“ zu konfrontieren. Im Fokus werden dabei nicht nur die Signal-Affäre und sein genereller Umgang mit sensiblen Informationen stehen. Die Anhörung bietet den Demokraten eine seltene Gelegenheit, einen hochrangigen (Ex-)Mitarbeiter der Trump-Regierung unter Eid zu Themen zu befragen, zu denen das Weiße Haus bisher oft nur spärliche Informationen preisgibt: die Entlassungswellen, der Einfluss externer Akteure, die Verhandlungen mit Russland und der Ukraine, der Militäreinsatz im Jemen, die umstrittene Handelspolitik und der generelle Zustand der nationalen Sicherheit unter Trump. Senator Chris Coons (D-Delaware) deutete bereits an, dass er Waltz auch grundsätzlich zu dessen Verständnis von Amerikas Sicherheit und Rolle in der Welt befragen wolle, da viele Entscheidungen der Trump-Regierung das Land seiner Meinung nach „weniger sicher gemacht“ hätten. Der Spott über die Chat-Panne ist Waltz ohnehin sicher.
Chaos 2.0: Gelernt oder nur anders verpackt?
Die Art und Weise, wie Waltz‘ Abgang orchestriert wurde – verzögert, als Versetzung getarnt –, unterscheidet sich von den oft brutalen und öffentlichen Rauswürfen der ersten Trump-Amtszeit, die ein Bild permanenten Chaos zeichneten und eine Reihe verbitterter Ex-Mitarbeiter produzierten, die später scharfe Kritik an Trump übten (wie John Kelly oder John Bolton). Offenbar versucht Trump nun, solche Schlagzeilen zu vermeiden und das Narrativ einer stabileren Regierungsführung aufrechtzuerhalten. Berichten zufolge zögerte er die Entlassung hinaus, um seine Hundert-Tage-Bilanz nicht zu belasten und nicht den Eindruck zu erwecken, er gebe dem Druck der Medien nach.
Doch die Episode zeigt, dass die zugrundeliegenden Dynamiken fortbestehen: abrupte Personalwechsel, interne Machtkämpfe, die von Loyalität und Ideologie statt von Expertise geprägt sind, und eine Anfälligkeit für externe Einflüsse aus dem radikalen Spektrum. Die Konzentration von Macht bei Rubio und der Einsatz von Vertrauten ohne Fachkenntnis wie Witkoff in Schlüsselpositionen deuten ebenfalls nicht auf eine Rückkehr zu geordneten Regierungsverfahren hin. Das Chaos mag subtiler verpackt sein, aber die Signale deuten weiterhin auf eine Administration hin, die von Unberechenbarkeit und internen Spannungen geprägt ist. Die Frage bleibt, ob diese Vorgehensweise eine effektive und kohärente Außen- und Sicherheitspolitik in einer komplexen Weltlage ermöglicht. Der „sanfte Rauswurf“ des Mike Waltz sendet jedenfalls ein beunruhigendes Signal – nicht nur an potenzielle Widersacher im eigenen Lager, sondern auch an Amerikas Verbündete und Gegner in aller Welt.