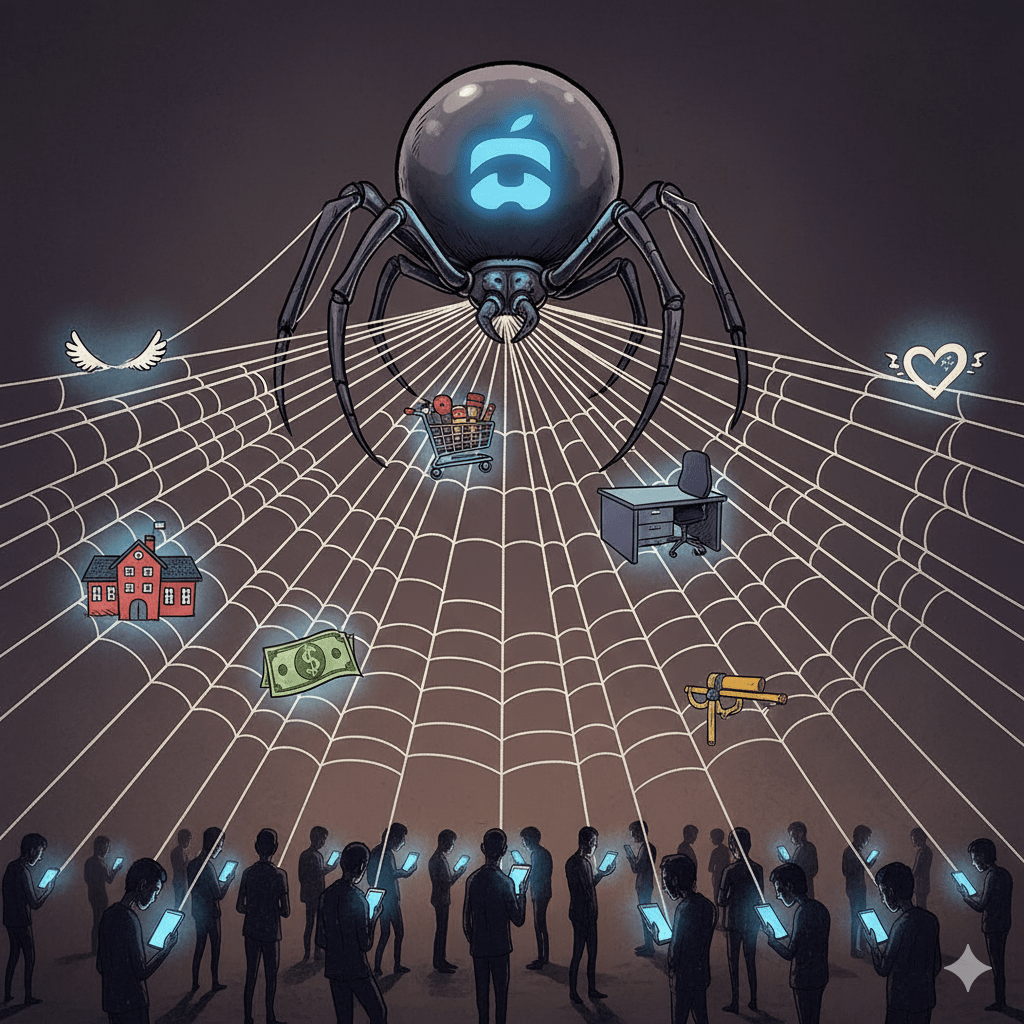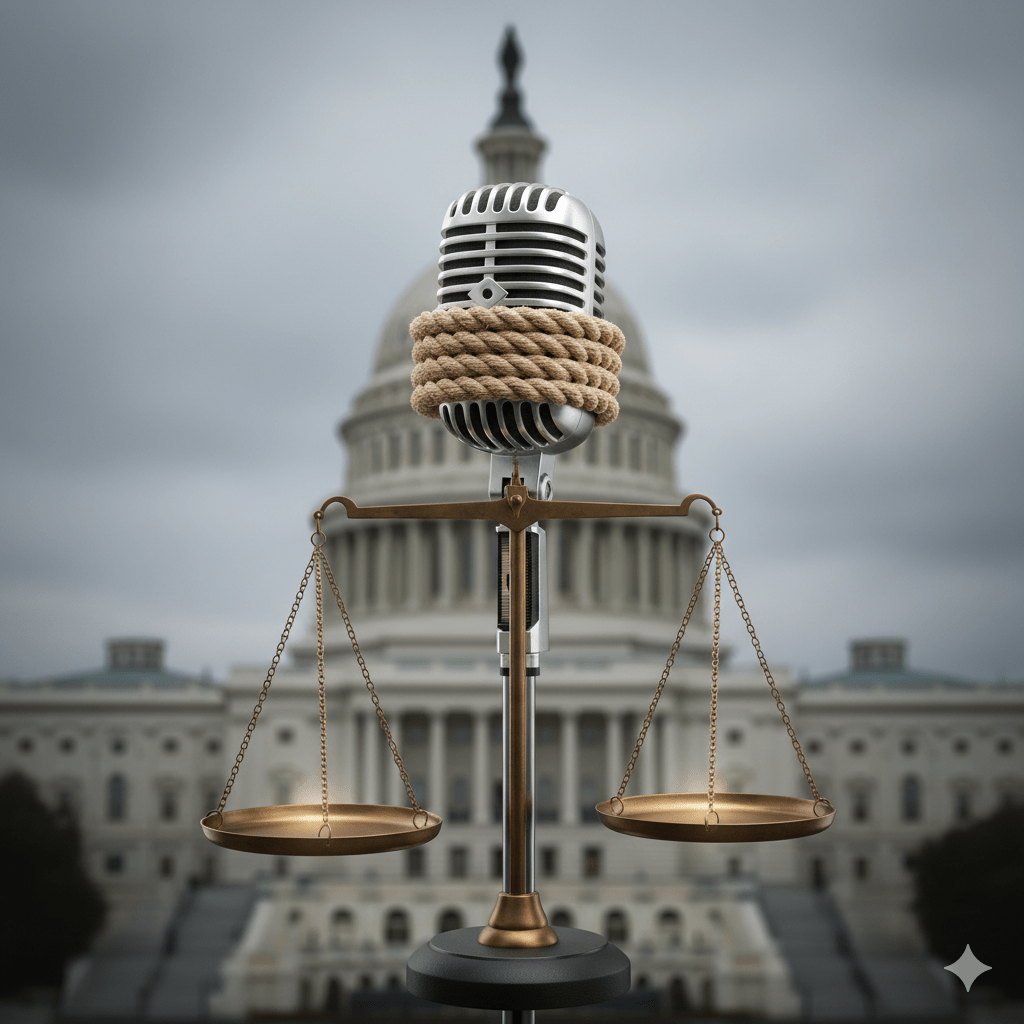Die Trauerfeier für Papst Franziskus in Rom bot die Bühne für eine unerwartete diplomatische Episode: ein Vier-Augen-Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Angesichts der eisigen Beziehung zwischen den beiden seit einem Eklat im Oval Office und inmitten festgefahrener Verhandlungen über einen von den USA forcierten, für Kiew inakzeptablen Friedensplan, wirft dieses Treffen Fragen auf. Führte die Begegnung im Petersdom tatsächlich zu einem Umdenken bei Trump, oder war es nur eine weitere Volte in seiner unberechenbaren Außenpolitik?
Vom Beinahe-Bruch zur plötzlichen Härte gegen Putin
Nur wenige Stunden nach dem etwa 15-minütigen Austausch vollzog Trump eine bemerkenswerte rhetorische Wende. Hatte er kurz zuvor noch die Ukraine und Selenskyj für die Blockade seines Friedensdeals verantwortlich gemacht und Russland die Krim quasi zugesprochen, klang er nun deutlich anders. Auf seiner Social-Media-Plattform warf er plötzlich dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, den Krieg möglicherweise gar nicht beenden zu wollen und ihn „an der Nase herumzuführen“. Trump kritisierte explizit die jüngsten russischen Raketenangriffe auf zivile Ziele und deutete sogar neue, schärfere Sanktionen gegen Moskau an, bis hin zu Sekundärsanktionen. Dieser Tonwechsel ist frappierend, gerade weil Trump zuvor eher Putin hofiert und einen Friedensplan präsentiert hatte, der von Kritikern als Belohnung für den Aggressor gesehen wird. Die unmittelbare Ursache scheint das direkte Gespräch mit Selenskyj gewesen zu sein, der die Begegnung hoffnungsvoll als „potenziell historisch“ bezeichnete.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Symbolik, Skepsis und die Rolle der Persönlichkeiten
Die Bilder aus dem Petersdom – die beiden Präsidenten auf eng beieinander stehenden Stühlen, scheinbar konzentriert im Gespräch – entfalteten eine starke Symbolkraft. Sie standen im Kontrast zur demütigenden Szene im Oval Office und nährten Spekulationen über eine mögliche Annäherung. Beobachter interpretierten Trumps Körpersprache als ungewohnt zurückhaltend, fast lauschend. Doch die Skepsis überwiegt. Trumps Politik ist bekannt für ihre Sprunghaftigkeit und Widersprüchlichkeit. Sein blitzartiger Rom-Besuch – kaum 14 Stunden – und die Priorisierung der Rückkehr zum Golfplatz lassen Zweifel an der Tiefe seines Engagements aufkommen. Seine Motivationen bleiben oft im Persönlichen verhaftet; die Betonung von „Respekt“, der demonstrative Auftritt in blauer Krawatte inmitten schwarzgekleideter Trauergäste und die abschätzige Bemerkung über ein mögliches Treffen mit Joe Biden unterstreichen dies. Putins Reaktion – die plötzliche Bereitschaft zu direkten Verhandlungen ohne Vorbedingungen, die vom Kreml aber nicht mit Trumps Drohungen, sondern mit Gesprächen mit dessen Sondergesandten begründet wurde – passt ins Bild eines Kalküls, das auf Zeit spielt und Trumps Ungeduld einkalkuliert.
Während Selenskyj in Rom auch die Unterstützung wichtiger europäischer Partner wie Macron, Starmer und von der Leyen demonstrierte, die sich für einen „gerechten und dauerhaften Frieden“ einsetzen, bleibt die Frage, ob die „Beerdigungsdiplomatie“ mehr als eine flüchtige Episode war. Der US-Friedensplan, der die faktische Aufgabe ukrainischer Gebiete vorsieht, stößt bei Kiew und in Europa weiterhin auf massive Ablehnung. Trumps plötzliche Härte gegenüber Putin könnte ebenso schnell wieder verfliegen wie sie aufkam. Ein echter Wendepunkt erfordert mehr als einen symbolträchtigen Moment – er verlangt eine kohärente Strategie und verlässliche Partner. Beides scheint unter der aktuellen US-Regierung schwer zu finden.