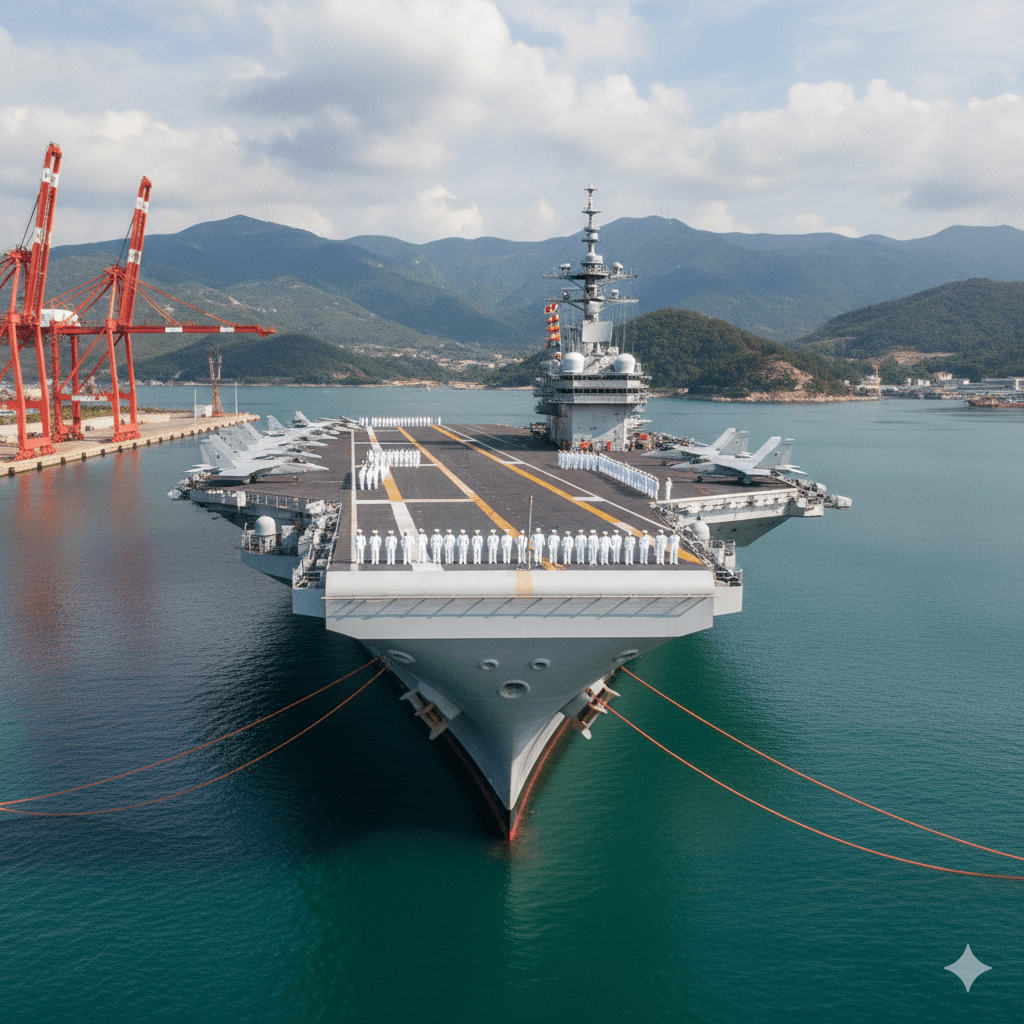Donald Trumps erneute Breitseite gegen den globalen Handel, mit empfindlichen Zöllen auf europäische Waren, zwingt die Europäische Union zu einer Reaktion. Nachdem die üblichen Mittel der Gegenzölle auf amerikanische Produkte angesichts des transatlantischen Ungleichgewichts im Güterhandel nur begrenzt Wirkung versprechen, rückt nun ein Instrument in den Fokus, das die tektonischen Platten der globalen Wirtschaftspolitik verschieben könnte: eine Abgabe auf digitale Dienstleistungen der US-amerikanischen Tech-Giganten. Doch inmitten der fieberhaften Suche nach einer angemessenen Antwort droht die EU, sich in einem Minenfeld unkalkulierbarer Risiken zu bewegen und möglicherweise die eigenen Bürger und Unternehmen stärker zu belasten als den eigentlichen Adressaten des Zorns.
Der digitale Keil: Eskaliert die EU den Handelskrieg mit einer Steuer auf Google & Co.?
Die Idee ist verlockend: Dort, wo Europa ein deutliches Handelsdefizit gegenüber den USA aufweist – im Sektor der digitalen Dienstleistungen – könnte ein gezielter Schlag die amerikanische Wirtschaft empfindlich treffen. Unternehmen wie Google, Meta, Amazon und Apple generieren in der EU Milliardenumsätze, zahlen aber aufgrund ihrer ausgeklügelten Steuervermeidungsstrategien in Niedrigsteuerländern oft nur marginale Beträge an den europäischen Fiskus. Hier wittern einige europäische Politiker eine doppelte Chance: Einerseits könnten die Einnahmen aus einer Digitalsteuer zur Kompensation der durch Trumps Zölle entstandenen Schäden beitragen. Andererseits könnte ein solcher Schritt den US-Präsidenten und seine finanzstarken Unterstützer im Silicon Valley direkt treffen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben
Doch die potenziellen Fallstricke sind immens. Ökonomen warnen davor, dass eine Digitalsteuer, ähnlich wie andere umsatzbasierte Abgaben, am Ende von den europäischen Konsumenten getragen würde, da die betroffenen Unternehmen die Kosten in Form höherer Preise weitergeben könnten. Gerade in Bereichen, in denen US-Konzerne quasi-monopolartige Stellungen innehaben, wie bei Bürosoftware oder Suchmaschinen, wäre die Preiselastizität gering und die Nutzer hätten kaum Alternativen. Somit könnte die EU mit dem Versuch, amerikanische Tech-Riesen zu bestrafen, ironischerweise die eigene Bevölkerung zur Kasse bitten.
Zudem ist die Einführung einer Digitalsteuer keineswegs ein unkomplizierter Akt. In der Vergangenheit scheiterten ähnliche Initiativen am Widerstand einzelner EU-Mitgliedstaaten, die aufgrund niedriger Unternehmenssteuern und der Ansiedlung internationaler Konzerne Vorteile zogen. Eine erneute Uneinigkeit innerhalb der EU würde das Signal der Geschlossenheit im Angesicht der amerikanischen Herausforderung empfindlich schwächen. Und schließlich birgt der Vorstoß in Richtung Digitalsteuer die Gefahr einer massiven Eskalation des Handelskonflikts. Die US-Regierung hat bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass sie europäische Regulierungsbestrebungen im Tech-Sektor als protektionistische Maßnahmen ansieht und mit Gegenmaßnahmen drohen könnte. Ein offener Handelskrieg im digitalen Raum könnte weitreichende Konsequenzen für beide Seiten haben und die transatlantischen Beziehungen nachhaltig belasten.
Mehr Schein als Sein? Die fragwürdige Wirksamkeit der digitalen Vergeltung
Die EU steht vor einem Dilemma. Die von Trump entfesselte Zollpolitik ist ein Frontalangriff auf das Fundament des globalen Handels und trifft europäische Exporte im Wert von Hunderten von Milliarden Euro. Symbolische Gegenzölle auf Whiskey und Motorräder mögen als politisches Signal dienen, doch ihre tatsächliche wirtschaftliche Wirkung verpufft angesichts der Dimensionen der amerikanischen Strafmaßnahmen. Der Ruf nach härteren Bandagen, nach einer „Bazooka“ gegen das Herz der amerikanischen Wirtschaft – die Technologiebranche – ist in Brüssel unüberhörbar geworden.
Die Digitalsteuer als vermeintliche Wunderwaffe erweist sich jedoch bei näherer Betrachtung als ein zweischneidiges Schwert. Zwar ist es nachvollziehbar, dass die EU nach Wegen sucht, den unfairen Wettbewerbsvorteilen der US-Tech-Konzerne entgegenzuwirken und eine gerechtere Besteuerung anzustreben. Doch die Instrumentalisierung der Steuerpolitik als primäres Mittel der Handelspolitik ist riskant. Sie verwischt die Grenzen zwischen legitimen steuerpolitischen Zielen und protektionistischen Motiven und könnte die ohnehin fragilen Verhandlungen mit der US-Regierung weiter erschweren.
Statt in eine möglicherweise selbstschädigende Eskalation zu münden, sollte die EU ihre Stärken besinnen. Als größter Binnenmarkt der Welt verfügt sie über ein enormes wirtschaftliches Gewicht, das sie in Verhandlungen mit den USA selbstbewusst einsetzen könnte. Die Stärkung von Handelsbeziehungen mit anderen globalen Partnern, wie sie parallel zur Reaktion auf Trumps Zölle angestrebt wird, ist ein strategisch kluger Schachzug, um die Abhängigkeit von einem unberechenbaren Partner zu reduzieren.
Die von einigen EU-Politikern geforderte Digitalsteuer mag als ein Zeichen der Stärke und Entschlossenheit wahrgenommen werden. Doch die Gefahr, dass dieser Schuss nach hinten losgeht und primär europäische Bürger und Unternehmen trifft, ist eklatant. Anstatt in einen vergeltungssüchtigen Aktionismus zu verfallen, bedarf es einer wohlüberlegten Strategie, die sowohl die kurzfristigen Schäden der US-Zölle abmildert als auch langfristig auf eine Wiederherstellung fairer und regelbasierter Handelsbeziehungen abzielt. Der Griff nach der Digitalsteuer als Mittel der Wahl in der aktuellen Krise könnte sich als ein verzweifelter und letztlich wenig zielführender Akt erweisen – ein digitaler Keil, der tiefe Spalten in die europäische Wirtschaft und Gesellschaft treiben könnte.